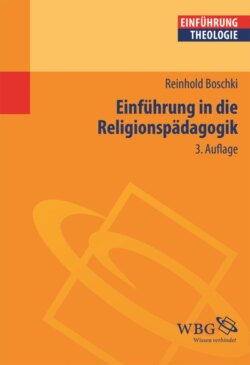Читать книгу Einführung in die Religionspädagogik - Reinhold Boschki - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erste Begriffsklärungen
Оглавлениеzentrale Begriffe
RELIGION kann höchst verschieden definiert und verstanden werden (u.a. Lang/Waldenfels 2005). Vom lateinischen religari (zurückbinden) kann es Rückbindung an Transzendenz bedeuten (transcendere: überschreiten), also an das, was die Erfahrungswelt übersteigt. Als Phänomen ist Religion das äußerlich Vorfindbare, der ‚sichtbare‘ Ausdruck religiöser Handlungen. Überall dort, wo Menschen sich auf Transzendenz beziehen, sind religiöse Phänomene beobachtbar: Orte, an denen sie sich zum Gebet oder zum Gottesdienst versammeln, Gebäude mit ihren Ausstattungen (Kirchen, Moscheen, Synagogen oder Tempel), religiös gestaltete Zeiten (Feste, Gebetszeiten), Rituale und Liturgien, heilige Bücher und Lehrtexte, Religionsvertreterinnen und -vertreter (u.a. Priester, Imame, Rabbinerinnen und Rabbiner, Nonnen und Mönche), Institutionen, Strukturen und vieles mehr. Der Begriff ‚Religion‘ steht demnach für die objektiven Gegebenheiten.
RELIGIOSITÄT ist demgegenüber die subjektive, die individuelle Seite von Religion, das, was der und die Einzelne als seine und ihre Religion lebt, wie er oder sie religiös denkt, sich verhält, fühlt, handelt (Kropač et al. 2015; Angel 2006).
SPIRITUALITÄT ist ein Modebegriff, fast schon ein ‚Allerweltswort‘, obwohl dahinter eine reichhaltige Tradition im Christentum und in anderen Religionen steht. Von dem französischen spiritualité her kommend (19. Jahrhundert), bedeutet Spiritualität in christlicher Sicht ein „Leben aus dem Geist“ (Karl Rahner), also eine Lebensweise, die sich von einer engen Beziehung zu Gottes Heiligem Geist getragen weiß. Allgemein kann Spiritualität für eine bestimmte Ausdruckgestalt des religiösen Lebens stehen, z.B. durch regelmäßige Gebete, Körperhaltungen, Riten, Stille, Meditation, Lektüre der Heiligen Schrift, Teilnahme an Gottesdiensten (Eckholt et al. 2016; Altmeyer et al. 2006).
GLAUBE ist im christlich-theologischen Verständnis eine Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus und dem Heiligen Geist (Rahner 2014 [1976]; Biser/Lenzen 2005). Damit ist Glaube weit mehr als ein Für-wahr-Halten von Dogmen und Glaubenssätzen. Seit Augustinus unterscheidet man in der christlichen Theologie zwischen fides qua creditur (wörtl.: Glaube, insofern er geglaubt wird), also dem persönlichen Akt des Glaubens, und fides quae creditur (Glaube, der geglaubt wird), also den bestimmten Inhalten, an die man glaubt, z.B. an das kirchliche Glaubensbekenntnis. Biblisch gesehen ist Glaube stets ein tiefes Vertrauen auf den persönlichen Gott und betrifft die ganze Existenz des Menschen; er setzt persönliche Umkehr und einen Akt der bewussten Entscheidung voraus. Glaube ist ein Aufeinander-zu-Gehen von Gott und Mensch, wobei Gott immer den ersten Schritt tut und bereits getan hat (durch Schöpfung, Menschwerdung, Heilsstiftung).
RELIGIÖSES LERNEN ist ein Vorgang, bei dem sich eine Veränderung im Denken und Handeln eines Menschen in religiöser Hinsicht ereignet. Wer religiös lernt, erweitert seine Weltorientierung, sein Sinnverstehen, sein Selbstverständnis und seine Beziehung zur Transzendenz (zu Gott). ‚Lernen‘ bezeichnet den Vorgang, der sich im ‚Inneren‘ eines Menschen vollzieht, der dann aber nach außen sichtbar werden kann, z.B. in Ausdruck und Handeln. Verwendet man den Terminus ‚religiöses Lernen‘, hat man die Subjekte des Lernens im Blick (6.2.).
RELIGIÖSE ERZIEHUNG UND ‚RELIGIÖSES LEHREN‘ fokussieren dagegen eher auf den äußeren Vorgang, auf die Erziehenden und Lehrenden, auf deren Handeln und Intentionen (6.1.). ‚Erziehen‘ wird v.a. für die Lernorte Familie und Kita (Kindertagesstätte) verwendet, ‚Lehren‘ für Unterricht in Schule und Kirchengemeinde.
RELIGIÖSE BILDUNG ist der umfassendste Begriff (ausführlich in 6.2. bis 6.5.). Er umgreift sowohl die Subjekte des Lernens (Selbstbildung) und deren Verstehensvoraussetzungen als auch die Inhalte, Ziele, Kompetenzen und Bedingungen des Lehrens und Lernens (Schweitzer 2014a). Der Bildungsbegriff hat immer eine emanzipatorische Komponente: (Religiöse) Bildung will den Menschen zur Mündigkeit befähigen. Wichtig ist es, den Begriff der ‚Bildung‘ nicht auf die Themen und Inhalte (also den zu vermittelnden ‚Stoff‘) zu verengen.
Theorie-Praxis-Zirkel
RELIGIONSPÄDAGOGIK will Menschen begleiten und unterstützen, die religiös lehren oder lernen, und reflektiert religiöse Bildungsprozesse. Religionspädagogik kann eher praktisch orientiert sein und die konkreten Lernprozesse im Blick haben. Hier spricht man von Religionsdidaktik (Teil D, insbes. Kap. 11) oder von religionspädagogischem Handeln. Religionspädagogik ist aber auch eine wissenschaftliche Disziplin. Sie versucht in einer Zirkelbewegung zwischen Theorie und Praxis (‚Theorie-Praxis-Zirkel‘) die Praxis religiösen Lehrens bzw. Lernens mit wissenschaftlichen Mitteln zu reflektieren und gleichzeitig die Theorie (theologische Entwürfe, Glaubenstradition, pädagogische Ansätze, Bildungstheorie, sozialwissenschaftliche Erkenntnisse etc.) auf die Praxis hin und von der Praxis her zu durchdenken. Dabei hat sie wissenschaftstheoretisch gesehen immer zwei grundlegende Perspektiven, die zwei fundamentalen Bezugswissenschaften zugeordnet sind: Theologie und Sozialwissenschaften.
Gleich einem ‚Fernglas‘ richtet die Religionspädagogik ihren Blick auf den gleichen Gegenstand, nämlich religiöses Lehren und Lernen in Kirche, Schule und Gesellschaft, sieht ihn aber durch zweierlei Perspektiven und muss beide Blickwinkel zu einem einzigen Bild vereinigen. Religionspädagogik wird in diesem Buch als theologische und im gleichen Atemzug als pädagogische Wissenschaft verstanden (Boschki et al. 2007; Boschki 2003; Schweitzer 2006).
Zusammenfassend kann gesagt werden: Religion ist in unserer Gesellschaft ein weiterhin sichtbarer und nachweisbarer Faktor, der in den Biografien der Menschen aber auch in Kultur und Öffentlichkeit eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Religion als objektive, Religiosität als subjektive Größe, christlicher Glaube als Beziehung zu Gott und Spiritualität als dessen Ausdrucksgestalt müssen unterschieden werden. Religionspädagogik unterstützt den Prozess des religiösen Lehrens und Lernens bzw. religiöser Bildung in Theorie und Praxis. Sie ist eine theologische und gleichzeitig eine pädagogische (bzw. sozialwissenschaftliche) Disziplin. Aus dieser doppelten Bestimmung von Religionspädagogik ergibt sich die Notwendigkeit, das Fach von diesen beiden Seiten her näher zu begründen (Teile A und B).