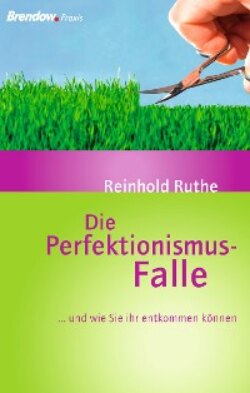Читать книгу Die Perfektionismus-Falle - Reinhold Ruthe - Страница 6
ОглавлениеKAPITEL 1
Die Triebfeder des Perfektionisten
Was ist die Triebfeder von Perfektionismus? Bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir zunächst klären: Was sind die treibenden Kräfte im Menschen überhaupt?
▪ Was gibt ihm Impulse,
▪ die ihn nach vorne ziehen,
▪ die ihn motivieren,
▪ die ihn aktiv werden lassen,
▪ die ihn beeinflussen, klare oder unbewusste Ziele anzusteuern?
Jeder Mensch verfolgt Ziele
Das heißt: Der Mensch verfolgt immer Ziele, die ihm nicht ständig durchschaubar sein müssen. Die Zielstrebigkeit des Menschen ist nicht nur eine Anschauung, sie ist eine Grundtatsache seiner Existenz.
– Immer will der Mensch etwas erreichen,
– strebt der Mensch etwas an,
– setzt ihn etwas in Bewegung,
– machen ihn Motive mobil.
Vielleicht wenden Sie ein: »Moment mal, da gibt es Menschen, die wollen gar nichts mehr tun, die wollen sterben.«
Richtig. Aber verfolgen sie keine Ziele, wenn sie sterben wollen?
Macht euch die Erde untertan!
In den ersen Versen macht Gott deutlich, was er vom Menschen erwartet und wozu er ihn in die Welt gesetzt hat:
Dann sagte Gott: »Nun wollen wir den Menschen machen, ein Wesen, das uns ähnlich ist! Er soll Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde.« Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, er schuf Mann und Frau. Er segnete die Menschen und sagte zu ihnen: »Vermehrt euch! Breitet euch über die Erde aus und nehmt sie in Besitz!« (Mose 1, 26 – 28).
Gott hat also den Menschen mit Energie, mit Macht und mit einem Lebenstrieb ausgestattet, der es ihm ermöglicht, Ziele zu verfolgen, die ER ihm genannt hat.
Wie lauten nun die Ziele dieses Bewegungsgesetzes, dieses Lebenstriebes, dieser Lebensenergie? Wenn wir das formulieren können, wird unter anderem deutlich, was der Mensch mit Perfektionismus bewusst oder unbewusst erreichen will.
In jedem Menschen sind unbewusste und bewusste Kräfte am Werk. Sie werden durch Vererbung, durch Erziehung, durch Sozialisation und durch die Schlussfolgerung, die jeder Mensch aus diesen Faktoren gezogen hat, inspiriert.
Das kleine Kind, das von Erwachsenen umgeben ist, will werden wie sie. Es verfolgt das Ziel,
– groß zu sein,
– stark zu werden,
– etwas darzustellen,
– und identifiziert sich mit Personen seiner Umgebung.
Es ist ein innerer Drang, von unten nach oben zu kommen, aus dem Kleinsein ein Großsein zu entwickeln. Oder anders ausgedrückt:
– Das Kind strebt Überlegenheit an,
– das Kind will sich zeigen,
– das Kind sucht Selbsterhöhung,
– das Kind demonstriert ein Verlangen, sich selbst, die anderen und die Welt – im weitesten Sinne – zu beherrschen.
Ein Weg, Überlegenheit zu gewinnen, ist Perfektionismus
Gott hat den Menschen in die Welt gesetzt, sich die Erde untertan zu machen. Im Paradies hat ihm die Sünde allerdings einen bitteren Streich gespielt. Gute, positive und menschenfreundliche Strategien sind nun mit negativen und destruktiven Verhaltensmustern durchsetzt. Seit der Vertreibung aus dem Paradies hat der Mensch lebensfeindliche, selbstschädigende und krank machende Einstellungsmuster entwickelt, die bis heute dem Mitmenschen und dem Menschen selbst zu schaffen machen.
Dazu zählt auch der Perfektionismus.
Weil dem Leben ein immanentes Streben
– nach Sicherheit,
– nach Überlegenheit,
– nach Vollkommenheit,
– nach Fehlerlosigkeit und
– nach Gottähnlichkeit
innewohnt, entwickeln viele Menschen einen unbeschreiblichen Ehrgeiz, andere durch ein Vollkommenheitsstreben zu übertrumpfen.
Konkurrenzkampf und Perfektionismus
Der Konkurrenzkampf wird gefordert und gefördert, um die Fähigen zu einer größeren Arbeitsleistung anzustacheln. Eine gehobene Stellung wird ihnen versprochen. So wird der Beruf weniger als Beitragsleistung für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für den Leib Christi gewertet, sondern vielmehr als Belastung im Prestigekampf gesehen und empfunden.
Je höher die Stellung, desto höher das Ansehen, das Prestige. Und das Ergebnis?
Der Konkurrenzkampf, oft verbunden mit Ehrgeiz und Perfektionismus, treibt viele Menschen an, macht sie krank und unglücklich. Einer glaubt, den anderen überholen zu müssen.
Auf der Strecke bleiben das Gemeinschaftsgefühl und die Nächstenliebe.
– Die Angst zu versagen,
– die Angst, dem Stress nicht gewachsen zu sein,
– die Angst, das Erreichte nicht halten zu können,
– die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren,
treibt viele in den Zusammenbruch, in den Burn-out.
Der bedeutende Psychiater und Psychotherapeut Rudolf Dreikurs konnte schon Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts schreiben:
»Unsere Strafanstalten, unsere Nervenheilanstalten und Spitäler sind mit überehrgeizigen Menschen bevölkert, deren Versagen im Leben direkt auf ihren übermäßigen Ehrgeiz zurückgeführt werden kann.«
Wenn Ehrgeiz sich dann noch mit Perfektionismus verbindet, ist das Maß voll. Die offenen und versteckten Ziele dieses Überanspruchs treiben Menschen in psychosomatische Störungen und Krankheiten, weil das Ziel, einen sinnvollen Arbeitsbeitrag für die Gemeinschaft zu leisten, verfehlt wird.
Was ist der Sinn unseres Lebens?
Wenn wir Gott über alles lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. In diesen beiden Bestrebungen kommt der Sinn unseres Lebens zum Ausdruck.
– Jede Übertreibung durch Ehrgeiz und Perfektionismus ist eine Zielverfehlung,
– jede Übertreibung ist Egoismus und Selbstsucht,
– jede Übertreibung untergräbt unsere Gesundheit,
– jede dieser Übertreibungen ist Sünde.
Viele Perfektionisten sind auf Fehlersuche programmiert.
Wie hängt das zusammen?
Wer von Ehrgeiz und Konkurrenzstreben beherrscht wird, hat immer wieder das Gefühl, zu versagen und überrundet zu werden.
Minderwertigkeitsgefühle und Selbstwertstörungen untergraben das Selbstvertrauen. Unzulänglichkeitsgefühle und Selbstanklagen reißen den Menschen in die Depression. Zufriedenheit und Gelassenheit haben diesen Menschen den Rücken gekehrt. Sie stehen ständig unter Dampf und reagieren hektisch.
Warum?
– Sie sehen den Mangel und nicht den Erfolg,
– sie sehen die Probleme und nicht ihre Lösung,
– sie sehen die Größe ihres Versagens und nicht die Größe Gottes.
Es leuchtet ein, dass man sich so krank machen kann. Der Mensch führt Krieg gegen sich. Er zerstört seine Gesundheit und ruiniert sein Leben. Der Sinn seines Lebens ist verfehlt.
Aber was gibt dem Dasein Sinn? Wovon lebt der Mensch?
In seinem Roman »Krebsstation« beschreibt Alexander Solschenizyn den Mann Jefrem, einen ungeschlachten Burschen, der durch den Krankensaal geht und alle Menschen fragt, wovon sie denn nun leben. Schwierige Frage! »Von der Luft«, meint einer.
»Vom Wasser und vom Essen«, ein anderer. »Vom Arbeitslohn oder von der Qualifikation«, meinen wieder andere. Jefrem gibt sich nicht zufrieden. »Von der Heimat«, meint einer, »daheim ist alles leichter.« Jefrem fragt nun den Funktionär, der gerade ein Hühnerbein abnagt. »Darüber kann doch kein Zweifel sein«, erwidert der ohne Zögern, »die Menschen leben von der Ideologie und den gesellschaftlichen Interessen.«
Reicht das aus? Was ist der Sinn des Lebens? Wofür leben wir?
Wenn Ehrgeiz und Perfektion das Leben motivieren
Auf der Krebsstation schauen viele dem Tod ins Auge. Und bei uns? Viele fragen nicht, sie schuften. Und wenn man schuftet, bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Der Ehrgeiz treibt einen vorwärts, wohin auch immer. Man will etwas erreichen, man will überlegen sein, man will Besitz schaffen. Man will dazugehören.
In der Beratung und Seelsorge sind mir immer wieder Menschen begegnet, die sich überarbeitet haben. Sie powern irrealen Zielen entgegen. Wenn dann der Organismus streikt, wenn seelische oder körperliche Krankheiten den so genannten »Fortschritt« stoppen, dann gibt es ein böses Erwachen.
Fragen tauchen auf:
– Was mache ich eigentlich?
– Was will ich zutiefst erreichen?
– Welche sinnvollen Ziele strebe ich an?
– Ist Arbeit der Sinn des Lebens?
Hitler ließ über dem Eingang zu einigen Konzentrationslagern in weithin sichtbaren Buchstaben den provozierenden Satz »Arbeit macht frei!« anbringen. Eine Unverschämtheit!
Wer arbeitet, ist beschäftigt und kommt nicht auf dumme Gedanken. Auch heute gilt:
– Wer schwer arbeitet, hat keine Zeit, über sein Leben nachzudenken.
– Wer schuftet, fragt nicht. Das Tier wird getrieben, der Mensch kann fragen.
– Wer wie ein Besessener arbeitet, verdrängt die existenziellen Fragen nach dem Leben, dem Sinn und dem Warum.
Auch da erscheint der Teufel als geschickter Durcheinanderbringer.
Skepsis und Skeptizismus haben sich als Prinzip weltweit breitgemacht. Skepsis bedeutet in Wirklichkeit: Sich der Wahrheit stellen. Skepsis ist kein Synonym für Unglauben. Der wahre Skeptiker stellt sich der Wahrheit. Und diese Wahrheit ist Christus und der christliche Glaube. Wer Christus vertraut, wird über Arbeit, über Ehrgeiz und Perfektionismus eine veränderte Sicht bekommen.
Darum sollen im nächsten Kapitel die vielen Gesichter des Perfektionismus, um nicht zu sagen die Fratzen des Vollkommenheitsstrebens, untersucht werden.