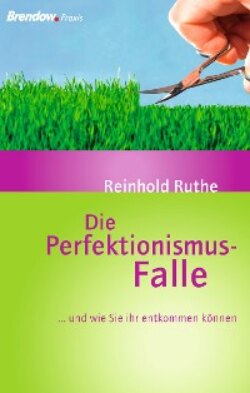Читать книгу Die Perfektionismus-Falle - Reinhold Ruthe - Страница 8
Perfektionismus hat viele Gesichter
ОглавлениеDen Perfektionismus gibt es nicht. Sein Erscheinungsbild ist vielschichtig, seine Ausdrucksformen zahlreich.
Jeder ist seines Stresses Schmied
Perfektionismus ist eine schlechte Angewohnheit. Er kann unser Denken und Handeln bestimmen.
Wie sagte schon der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel vor ein paar tausend Jahren: »Nicht die Tatsachen entscheiden über unser Leben, sondern wie wir sie deuten.«
▪ Unsere Gedanken machen eine Sache gut oder schlecht.
▪ Unsere Gedanken beflügeln oder lähmen uns.
▪ Unsere Gedanken machen uns gelassen oder produzieren einen inneren Aufruhr.
Eine nachdenkliche Geschichte kommentiert diese Aussage:
Es war einmal ein Mann. Man nannte ihn Adam. Er hatte viele Jahre mehr schlecht als recht gelebt. Viele Probleme trieben ihn um, über die er sich Gedanken machte und die ihn über die Maßen stressten. Alle Kleinigkeiten dramatisierte er. Das machte schließlich ein Nervenbündel aus ihm.
Eines Tages bekam er Krebs. Zuerst wurde er operiert und dann mit Strahlen behandelt. Leider blieben alle Eingriffe erfolglos. Er siechte dahin und der Tod klopfte an seine Tür.
Kurz vor dem Sterben, sein handgeschriebenes Testament lag neben ihm, zog sein Leben noch einmal wie ein Film an seinem inneren Auge vorbei. Einige Ereignisse machten ihn hellhörig. Ein erster Freund, er war zehn Jahre alt, hatte sich über ihn lustig gemacht. Jedenfalls glaubte er das. Er trennte sich von ihm und wollte ihn sein Leben lang nicht wiedersehen. Mit 17 Jahren verliebte er sich das erste Mal. Das Mädchen hielt ein Rendezvous nicht ein und er wandte sich enttäuscht und verbittert von ihm ab. Ein Jahr lang war er untröstlich. Als er verheiratet war und die Katze des Nachbarn auf sein gepflegtes Rosenbeet einen Haufen setzte, führte er einen erbitterten Rechtsstreit, der ihm den ersten Herzinfarkt bescherte. Viele Beispiele mit ähnlichen Reaktionen streiften sein Gehirn. Er schüttelte den Kopf und musste ernsthaft lachen. Dann nahm er seinen Füllfederhalter und schrieb seinen Kindern folgenden Satz ins Testament: »Ihr Lieben, denkt immer daran, im Angesicht der Ewigkeit sind tausend Probleme unseres Lebens, die wir viel zu wichtig genommen haben, wie ein Windhauch – ohne jede Bedeutung.«
Adam hat recht. Im Angesicht des Todes sind die meisten Probleme unseres Lebens, die wir verstärkt dramatisiert, zergrübelt und aufgeblasen haben, völlig überflüssige Aufregungen.
Es sind also negative Gedanken, die den eigentlichen Stress beinhalten. Perfektionismus ist ein hässlicher Stressfaktor, der unser Leben einschnürt, es belastet und viele Energien unnötig auffrisst. Aber hinter dem Perfektionismus steckt eine falsche Leitidee:
– »Nur wenn du vollkommen bist, hat man dich lieb!«
– »Nur wenn du fehlerfrei arbeitest, kannst du bestehen!«
– »Gut ist nicht gut genug. Hol das Letzte aus dir heraus!«
Dieser innere Antreiber kann sich lebensbedrohlich auswirken.
Der introvertierte und der extrovertierte Perfektionist
Da ist Frau Fischer. Eine penetrant ordentliche und zuverlässige Frau. Sie ist Buchhalterin in einer Textilfirma und bei der Firmenleitung beliebt. Ihre Arbeit ist einwandfrei. Wenn sie nicht fertig wird, macht sie Überstunden. Sie will die Arbeit erledigen. Was nicht erledigt ist, bereitet ihr enorme Kopfschmerzen. Am Ende des Jahres war ihr »ein kleiner Patzer« bei der Jahresabschlussbilanz unterlaufen. Sie war untröstlich. Die Firmenleitung beklagte sich nicht, aber Frau Fischer lag mit sich im Krieg. Sie konnte zu Hause ihren Haushalt nicht schaffen, war unglücklich und nicht zu genießen.
»Ich bin eine dumme Pute. Der Fehler hätte nicht geschehen dürfen. Eine ordentliche Buchhalterin ist gegen solche Fehler gefeit. Wenn mir das wieder passiert, werfen mich die Chefs raus. Ein Buchhalter muss perfekt sein, sonst kann er gleich gehen.«
Was sind die Kennzeichen eines introvertierten Perfektionisten?
– Er ist unerbittlich gegen sich selbst.
– Er kann sich Fehler und Sünden nicht vergeben.
– Er kann Fehler bei anderen entschuldigen, aber nicht bei sich.
– Er wertet sich selbst ab.
– Er leidet an sich.
Herr Weber ist ein extrovertierter Perfektionist. Er ist Kontrolleur in einer Elektrofirma. Er ist genau und überkorrekt. Aber er hat eine Schwäche. Ihn ärgert ungemein, wenn eine Kollegin oder ein Kollege etwas vergisst. Jede Großzügigkeit des anderen ist ihm ein Dorn im Auge. Als Kontrolleur – auf diesem Posten ist er goldrichtig – sieht er alles, hört er alles und weiß alles. Seine Kollegen meiden ihn, weil sie in ihm einen »Stänkerer« sehen. Den Spitznamen trägt er seit Jahren. Wenn in der Firma von »Stänker« die Rede ist, weiß jeder, wer gemeint ist.
Herr Weber ist verheiratet und hat zwei Söhne von 13 und 15 Jahren. Das Verhältnis zu ihnen ist mehr als schlecht. Wenn der Vater nach Hause kommt, geht die Kritik los. Irgendwas findet er immer. Einer seiner Söhne hat ihm eines Tages das böse Wort in Riesenlettern an sein Arbeitszimmer geheftet: »Wer sucht, der findet. Wer nicht sucht, findet auch immer.« Der Vater kann darüber nicht lachen. Ihn ärgert diese Kritik, weil er darin eine unverschämte Rebellion sieht.
Was sind die Kennzeichen eines extrovertierten Perfektionisten?
– Er sieht bei andern Fehler und Schwächen.
– Er kritisiert die Unvollkommenheiten anderer.
– Er kann sich leichter verzeihen.
– Er macht lieber die Arbeit selbst, um nicht die Unvollkommenheit anderer ertragen zu müssen.
– Er hat ständig Schwierigkeiten mit anderen Menschen.
– Er leidet an anderen.
Perfektionismus: Irrationale Idee Nr. 11
Der amerikanische Therapeut Dr. Albert Ellis, der Begründer der Rational-Emotiven-Therapie, hat in einem seiner Bücher elf »irrationale Ideen« veröffentlicht, die psychische Störungen verursachen und aufrechterhalten. Er geht davon aus, dass wir in unseren Familien und in unserer Gesellschaft von abergläubischen und unsinnigen Ideen indoktriniert werden. Solche Vorurteile und irrationalen Vorstellungen gelten als Hauptursache für Neurosen, Verhaltensauffälligkeiten und psychosomatische Störungen. Die Formulierung der irrationalen Idee Nr. 11 lautet:
»Die Vorstellung, dass es für jedes menschliche Problem eine absolut richtige, perfekte Lösung gibt und dass es eine Katastrophe sei, wenn diese perfekte Lösung nicht gefunden wird.«1
In der Welt der Unvollkommenheit und Unsicherheit glauben viele Menschen, nicht glücklich sein zu können. Sie suchen Sicherheit, absolute Beherrschung der Lage, die vollkommene Wahrheit und die totale Kontrolle.
Alle diese »irrationalen Überzeugungen« sind falsche Erwartungen, beinhalten übertriebene Hoffnungen und enden in großen Enttäuschungen. Ellis geht davon aus, dass der Mensch, der diesen »irrationalen Ideen« nachläuft, genau die Katastrophe herbeiführt, die er vermeiden will. Irren ist menschlich und perfektionistische Lösungen werden zum Albtraum.
Perfektionismus und Magersucht
Überall wird deutlich: Den Perfektionismus gibt es nicht. Es gibt lediglich verschiedene Perfektionismus-Aspekte, die bei unterschiedlichen Personen spürbar werden.
Da sind die Magersüchtigen. Sie haben perfektionistische Neigungen. Wahrscheinlich ist ihr Vollkommenheitsstreben eine der Hauptwurzeln für ihr Elend. Sie haben die Überzeugung, sie seien zu dick und nicht gut genug.
Sandra Litty, eine ehemalige Magersüchtige, schrieb über ihr Leben:
»Ich war weit gelaufen auf dem Weg, den ich meinen eigenen nannte, denn ich hatte ihn selber gewählt. Ich perfektionierte alles in meinem Leben, weil Perfektion das Ziel unserer Gesellschaft ist. Ich wanderte jahrelang auf meinem Weg, wollte es allen Menschen recht machen, wollte gut sein, alle Erwartungen erfüllen und Anerkennung sammeln, um mich selber zu mögen. Ich wurde mehr und mehr von meinen Fähigkeiten und – schlimmer noch – von den Unfähigkeiten abhängig. Wie konnte es anders kommen: Ich musste versagen, immer wieder fallen, denn wer kann diese Ansprüche schon erfüllen? … Auch als ich schon viele Bereiche meines Lebens von dem Zwang zur Perfektion befreit hatte, stand das Essen noch unter meiner Herrschaft. Alles hatte ich weggeworfen, aber die Herrschaft über meinen Körper wollte ich nicht aufgeben.«2
Unmissverständlich spricht die Magersüchtige über ihren Perfektionismus. Die Ansprüche sind neurotisch. Das Vollkommenheitsstreben ist lebensfeindlich. Der Zusammenbruch des Lebenswillens voraussehbar. Wie geht die Magersüchtige damit um?
Sandra Litty beschreibt es so: »Wäre ich dick, dann müsste ich vor Gram vergehen. Doch was soll ich tun? Die einzige Alternative war Selbstmord.«3
Sie wurde wie ein Wunder davor bewahrt, aber der Weg war vorgezeichnet. Wer perfektionistische Ziele anstrebt, landet in einer Sackgasse. Die Anstrengungen sind übermenschlich und die Ziele überspannt.
Perfektionismus und Kontrolle
Eine Spielart des Perfektionismus ist Kontrolle. Kontrolle gehört zu bestimmten Lebensstil-Leitmelodien. Sie kennzeichnen die Einmaligkeit dieses Menschen.
– Sie zeigen, was dieser Mensch am höchsten bewundert.
– Sie zeigen, was dieser Mensch am intensivsten anstrebt.
– Sie zeigen, was dieser Mensch auf alle Fälle vermeiden will.
Die Lebensstil-Leitmelodie Kontrolle spiegelt ein Bewegungsgesetz des Menschen wider, eine Stellungnahme zu den Lebensproblemen und zum Zusammenleben in der Gemeinschaft. Man kann sie auch Prioritäten nennen. Prioritäten sind also hervorstechende Eigenschaften, Verhaltens- und Einstellungsmuster, die diesen Menschen besonders wichtig sind.
Die Priorität Kontrolle kennzeichnet ein Wesensmerkmal des Perfektionisten. Dieser Mensch wünscht sich
– Sicherheit,
– überschaubare Verhältnisse,
– Ordnung und Gewissenhaftigkeit,
– Schutz vor unvorhersehbaren Ereignissen.
Kontrolle kann mehr das eigene Leben oder das Leben der andern betreffen. Der Kontrolleur kann in erster Linie auf Selbstkontrolle oder auf Kontrolle der anderen Wert legen. Wer in erster Linie sich im Auge hat, legt auf Gradlinigkeit, Pflichtbewusstsein und Prinzipientreue im eigenen Leben Wert. Er will vorbildhaft und zuverlässig erscheinen. Sein Leben soll berechenbar sein. Wer primär Kontrolle über andere Menschen gewinnen will, kann zum Tyrannen werden. Er reglementiert und bevormundet seine Kinder, den Partner und seine Mitarbeiter. Diese Form des Perfektionismus reizt zum Widerspruch. Sie fördert Rebellion und Widerstand. Beruflich können solche Menschen viel leisten, nur, ihre Beziehungsfähigkeit ist in der Regel schwach entwickelt.
Der Kontrolleur, der andere kontrollieren will, hat es schwer, sich Gott auszuliefern. Er will sich und sein Leben im Griff haben und nicht abhängig sein. Er fürchtet, von Gott reglementiert und kontrolliert zu werden.
Was ist ein Perfektionist?
▪ Er ist tadellos.
▪ Er ist makellos.
▪ Er ist fehlerfrei.
▪ Er ist außerordentlich.
▪ Er ist übergewissenhaft.
▪ Er ist pingelig.
▪ Er ist ein Buchstabendenker.
▪ Er ist ein Sophist.
▪ Er kann zum Wortklauber werden.
▪ Er denkt und handelt moralistisch.
▪ Er vertritt sehr hohe Maßstäbe.
▪ Er strebt das Vortreffliche an.
▪ Er tendiert zur Vollkommenheit.
▪ Er will sich nichts zuschulden kommen lassen.
▪ Er hat hochgesteckte Erwartungen.
▪ Er treibt sich selbst zum unerreichten Ziel an.
▪ Er will alles hundertprozentig machen.
Perfektionisten sind Menschen, die etwas so gut machen wollen, dass es möglichst nicht mehr zu verbessern ist.
Der Perfektionismuswahn
In einem Brief von Gesine Bauer lese ich einen Beitrag, der überschrieben ist: »Tödlicher Perfektionismuswahn«.
Wörtlich heißt es bei ihr: »Ein perfektes Paar, heißt es im Bekanntenkreis. Beide wissen alles übereinander, reden über alles miteinander, sie perfektionieren ihre Körper in demselben Fitness-Center und ihre Karriere nach demselben Strickmuster. Alles, was nicht perfekt ist, wird mit der Gründlichkeit ausgemerzt, mit dem ergrimmte Hobbygärtner resistentem Unkraut zu Leibe rücken. Sie lesen Bücher über Partnerschaft und kehren nie den Dreck unters Sofa.
Die Kinder kommen, alle hübsch, gesund und intelligent, und vor allem perfekt erzogen. Die Schulden fürs Haus sind abbezahlt, keiner geht fremd, beide haben Erfolg. Ein perfektes Paar im perfekten Glück.
Und dann plötzlich ist es aus. Der Freundeskreis des perfekten Paares zerfällt in zwei Teile: In einem schimpft sie unflätig über ihn, packt wochenlang so viel Übles aus, dass allen schon davon schlecht ist, und im anderen Teil praktiziert er das Gleiche mit umgekehrten Vorzeichen. Was ist da passiert?
War alles nur ein einziges Betrugsmanöver, was da wie Liebe aussah? Wer ist schuld an diesem Scherbenhaufen? Schuld ist nur einer: der partnerschaftliche Perfektionismuswahn.«4
Perfektionismus ist ein gefährlicher Bazillus. Alles muss perfekt und komplett sein. In der Lexikonreihe darf kein Stück fehlen, das Gläserservice muss vollständig und die Videothek fehlerfrei sein. Die Partnerschaftsdevise heißt: Glück ist, wenn nichts mehr fehlt. Alles ist fehler- und keimfrei.
Alle Winkel werden vom Staub befreit. Jeder Bazillus wird an die Luft befördert. Die Liebe hält das nicht aus. Perfektionismus evakuiert die Liebe. Sie kommt ins Schleudern, ihr geht die Luft aus. Perfektionismus ist ein Liebeskiller. Perfektionismus ist ein radikales Desinfektionsmittel. Mit Staub und Unordnung ist auch die Liebe weggeschrubbt.
– Beide sind perfekt.
– Beide sind erschöpft.
– Beide sind überarbeitet.
– Beide kapitulieren.
Sehr schön hat der Entertainer Otto Waalkes die perfekte Hausfrau auf die Schippe genommen. Übertrieben ahmt er sie nach. Sie schrubbt und saugt, poliert und desinfiziert. Und dann hört Otto eine Stimme: »Es ist sauber, aber noch nicht rein!«
Otto stürzt sich erneut mit Feuereifer in die Arbeit. Und wieder ertönt die Stimme im Hintergrund. Endlich versteht der Zwangsneurotiker: Seine Arbeit ist unnütz, solange er selbst im Raum ist. Er ist der Unsaubere, der die Reinheit verhindert. Als er die Küche verlässt, hört er eine triumphierende Stimme: »Jetzt ist alles rein.«
Wer scheuert und putzt, desinfiziert und blank poliert, lenkt von sich ab. Er sieht den Schmutz draußen. Er projiziert seinen Schmutz in die Welt. Fanatisch stürzt er sich auf die Säuberung der Umwelt und die Innenverschmutzung bleibt im Dunkeln.
In der Partnerschaft ist das nicht anders. Mit Röntgenblicken wird der andere durchleuchtet. Alle Staubfänger werden unters Mikroskop gezerrt. Es wird geputzt, kritisiert und Staub aufgewirbelt. Zärtlichkeit und Liebe werden ausgefegt. Zurück bleibt ein steriles Paar, das keimfrei in seinen vier Wänden haust.
– Die Liebe hat das Weite gesucht.
– Die Liebe ist desinfiziert.
– Die Liebe hat dem Perfektionismus Platz gemacht.
Perfektionismus und Depression
Es ist signifikant, dass viele depressive Menschen mit Perfektionismus zu tun haben. Depressive Menschen sind geistlich tiefgründig. Sie wollen ernst und ehrlich und nicht oberflächlich ihren Glauben leben.
Der amerikanische Theologe und Seelsorger David Seamands charakterisiert diese Menschen folgendermaßen:
»Es gibt viele verschiedene Arten von Depressionen. Sie unterscheiden sich in ihrer Stärke sehr voneinander. Ich möchte unser Augenmerk auf eine Art Depression richten, die durch ein angeschlagenes Gefühlsleben entsteht, vor allem durch eine geistliche Verzerrung, die man Vollkommenheitsstreben nennt – mit einem Fremdwort: Perfektionismus. … Das Vollkommenheitsstreben ist eine Nachäffung der Glaubensvollkommenheit. Anstatt uns zu heiligen Menschen und ausgeglichenen Persönlichkeiten zu machen – das heißt, zu ganzen Menschen in Christus –, macht das Vollkommenheitsstreben uns zu Pharisäern und Neurotikern.«5
In Seamands Augen ist das Vollkommenheitsstreben das »beunruhigendste seelische Problem« unter gläubigen Christen. Woher kommt das?
▪ Viele Christen haben das Gefühl, nicht genug getan zu haben.
▪ Viele Christen haben das Gefühl, sie müssten mehr leisten und mehr können.
▪ Viele Christen haben das Gefühl, sie gelten nichts und leiden unter einem niedrigen Selbstwert.
▪ Viele Christen haben das Gefühl, sie können sich abrackern und reichen doch nie aus.
▪ Viele Christen haben das Gefühl, dass Schuld, Furchtsamkeit und Selbstverdammung ständig wie ein Damokles-Schwert über ihren Häuptern schweben.
Viele Christen, die eine depressive Struktur widerspiegeln, haben ein überempfindliches Gewissen, reagieren mit übergroßen Schuldgefühlen und neigen zur Gesetzlichkeit. In ihrer Gesetzlichkeit schwingt große Angst mit. Sie klammern sich an Äußerlichkeiten, an Gebote und Verbote, und überbetonen alle Bestimmungen. Je größer das Vollkommenheitsstreben, desto zerbrechlicher das Gewissen. Je größer der Perfektionismus, desto niedriger das Selbstwertgefühl.
Perfektionismus – Ehrgeiz – Depression
Ein Selbsterforschungsfragebogen
Hinweise für den Selbsterforschungsfragebogen
»Perfektionismus – Ehrgeiz – Depression«
▪ Füllen Sie die Aussagen ehrlich aus. Sie beinhalten Tendenzen und keine wissenschaftlich exakten Ergebnisse. Wenn Sie im Zweifel sind, ob Sie »stimmt« oder »falsch« anstreichen sollten, überprüfen Sie, wohin Ihr Gefühl stärker neigt.
▪ Perfektionismus, Ehrgeiz und Depression sind miteinander verschwistert. Die eine Persönlichkeitseigenart unterstützt in der Regel die andere. Im Grunde sind alle vorgestellten Aussagen problematisch. Sie zeigen den gestressten, ehrgeizigen und perfektionistischen Menschen. Auch wenn die Arbeit den Betreffenden auffrisst und Freude macht, sind die Gefahren nicht damit abgewendet.
▪ Je mehr Sie »Stimmt«-Antworten gegeben haben, desto eher haben Sie mit depressiven Symptomen zu tun. Wenn Sie mehr als zehn »Stimmt«-Antworten zählen, ist es ratsam, sich mit einem Facharzt bzw. mit einem Therapeuten oder einem Fachseelsorger zu unterhalten.
▪ Die Selbstüberforderung kann leicht zu körperlichen Symptomen und Krankheiten führen bzw. zu seelischen Zusammenbrüchen und zum Burn-out.
Anzeichen für eine Überforderung sind:
– das Gefühl der Erschöpfung und völlige Durchhänger;
– das Gefühl, nicht weiter durchhalten zu können;
– das Gefühl, nicht abschalten zu können;
– das Gefühl, bedroht zu werden, Angst vor Schlaflosigkeit und Albträumen;
– das Gefühl, von anderen Menschen bedrängt und eingeengt zu werden;
– das Gefühl, von unbestimmten Ängsten heimgesucht zu werden.
Perfektionismus und Zorn
Wer dem Perfektionismus huldigt, produziert im tiefsten Herzen Zorn. Wie ist dieser Zorn zu verstehen? Es ist ein Zorn, der sich schwergewichtig gegen Gott richtet. In den Augen des Perfektionisten
– ist Gott der Fordernde,
– ist Gott der mit uns Unzufriedene,
– ist Gott der Grausame, der die Messlatte höher und höher legt.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Perfektionist eine Karikatur von Gott aufgestellt hat. Der Perfektionist terrorisiert sich selbst und schiebt dem lebendigen Gott die Verantwortung in die Schuhe.
Da aber perfektionistische Christen nicht zornig sein dürfen, unterdrücken sie ihren Zorn und schieben ihn ins Unbewusste ab. Es entstehen seelische Störungen, der Stress schädigt das Organsystem und der innere Druck entlädt sich in schwachen Körperteilen.
Der Franziskanerpater Richard Rohr hat in seinen Erfahrungen mit dem »Enneagramm« sich selbst charakterisiert:
»Es ist für mich als EINS am leichtesten, meine eigene Sünde zu beschreiben. Irgendwann in unserem Leben haben wir die Überzeugung gewonnen, dass nur Vollkommenes liebenswert ist. Man muss das Recht, geliebt zu werden, verdienen. Es ist für EINSer schwer, sich vorzustellen, dass Unvollkommenes und Gebrochenes Liebe verdienen. … Die EINS ist fortwährend von der Realität enttäuscht, weil sie immer hofft: Jetzt kommt endlich mal was Vollkommenes! Diese Enttäuschung verdichtet sich zur Wut. Es ist nicht die Wut auf irgendetwas Bestimmtes, sondern ein gestaltloser, universeller Ärger, der Ärger über die Unvollkommenheit der Welt.«6
Richard Rohr ist sich im Klaren darüber, dass dieser Zorn vorzüglich getarnt wird mit Idealismus und Eifer. Der Christ mit Perfektionismus sieht seine Unvollkommenheit und glaubt, dass Gott nur Vollkommene lieben kann. Darum rackert er sich ab. Er lebt so, als müsste er sich das Himmelreich verdienen. Er weiß es mit dem Kopf, aber mit Füßen, Mund und Händen tut er das Gegenteil. Seine Wurzelsünde ist der Zorn. Richard Rohr hat diese Wurzelsünde auch bei sich erkannt.
Perfektionismus und Unzufriedenheit
Der Perfektionist ist in seinem Vollkommenheitsstreben niemals ein zufriedener Mensch. Zufrieden kann er nicht sein, weil alles, was er denkt, fühlt, glaubt oder tut, verbesserungswürdig ist. Der Versuch, perfekt zu sein, beinhaltet eine enorme Anspannung. Der Mensch fühlt sich ausgelaugt und kann sein Resultat nicht genießen. Die Logik des Perfektionisten lautet:
– »Wenn ich es vollkommen schaffe, kann ich mich annehmen.«
– »Wenn ich es perfekt hinkriege, fühle ich mich gut.«
– »Wenn es mir vollkommen gelingt, bekomme ich die notwendige Anerkennung.«
Weil er seine Ziele nicht perfekt erreicht, bleibt er unglücklich und unzufrieden. Glück spiegelt Zufriedenheit wider. Aber glücklich kann er nicht sein, weil ihm das meiste nicht glücklich gelingt.
Zufriedenheit hat mit Frieden zu tun. Der Zufriedene hat Frieden in sich, mit den anderen und mit Gott. Der Unzufriedene liegt im Streit mit sich, mit den anderen und mit Gott. Seine Friedlosigkeit ist sein Markenzeichen. Friede ist ein hebräisch-aramäisches Wort und bedeutet einen Zustand, in dem man unversehrt, unbeschädigt ist, in dem man keinen feindlichen Angriffen von innen und außen ausgesetzt ist. Andererseits hat Friede auch die Bedeutung von »gutem Einvernehmen«, »verbunden sein« und Gemeinschaft mit Freunden, Nachbarn und Familienangehörigen. Noch heute lautet der Gruß im Orient: »Friede sei mit dir.«
Und diesen umfassenden Frieden vermisst der Perfektionist. Er fühlt sich inneren und äußeren Anfeindungen ausgesetzt. Ihm fehlen die innere Ruhe, die Ausgeglichenheit und das »gute Einvernehmen« mit sich, mit den anderen und mit Gott.
Perfektionismus oder die Ich-sollte-Tyrannei
Perfektionisten haben oft ein entsprechendes Vokabular. Es gibt Ausdrücke, die bei ihnen ständig wiederkehren.
– »Ich muss … «
– »Ich müsste eigentlich … «
– »Ich sollte … «
– »Ich darf nicht … «
Perfektionisten laufen absoluten Forderungen hinterher. Ständig machen sie sich Vorhaltungen und nörgeln an sich herum.
– »Ich muss meine Mutter anrufen. Ihr geht es nicht gut.«
– »Ich müsste unbedingt Herrn X einen Brief schreiben. Das bin ich ihm schuldig.«
– »Ich sollte weniger essen. Mein Cholesterinspiegel ist zu hoch.«
Die Ausdrücke verraten, dass ein Zwang im Hintergrund steht. Jemand sitzt diesen Menschen im Nacken und treibt sie an. Wer diese Ausdrücke verwendet, versetzt sich in die Rolle des Opfers. Auf der anderen Seite wird ein großer Widerstand deutlich. Freiwillig tut er es nicht.
Wer sich ernsthaft entschieden hat, dieses zu tun und jenes zu lassen, sagt:
– »Ich werde heute einen Brief schreiben!«
– »Ich will gleich die Arbeit in Angriff nehmen!«
– »Ich habe beschlossen, dieses oder jenes zu tun.«
Seelsorger sollten ernsthaft den Ratsuchenden hinterfragen, wenn er »Muss-Sätze« oder »Sollte-Sätze« formuliert.
– »Sie benutzen den Begriff ›müsste eigentlich‹. Was wollen Sie damit ausdrücken?«
– »Sie formulieren ›Ich sollte‹. Was tun Sie wirklich und wie gehen Sie mit solchen Gewissensansprüchen um?«
In den Sollte-Sätzen und Muss-Sätzen schwingt die Unzufriedenheit mit. Der Perfektionist leidet unter Kompromissen. Er will nicht einigermaßen arbeiten, er will hundertprozentig arbeiten. Er will nicht halbwegs glauben, sondern felsenfest seinen Glauben bekennen.
In den Formulierungen der Perfektionisten schimmern Schuldgefühle durch. Er ist hinter den Maßstäben, die andere ihm gesetzt haben oder die er sich selbst zumutet, zurückgeblieben. Alfred Adler hat den Satz formuliert: »Schuldgefühle sind die guten Absichten, die wir nicht haben.« Muss-Sätze und Sollte-Formulierungen beinhalten Schuldgefühle, die nicht ernst zu nehmen sind. Perfektionisten leiden unter Schuldgefühlen, sie zeigen Reuegefühle, leiden an sich selbst, aber handeln tun sie trotzdem nicht.
Perfektionismus und Selbstzerstörung
Der Psychotherapeut Peter Schellenbaum hat in seinem Buch »Abschied von der Selbstzerstörung« den griechischen Heroen Sisyphos als Bild für die Selbstzerstörung, für die Gewalt des Menschen gegen sich selbst, beschrieben.
Was ist Selbstzerstörung?
▪ Gewalt gegen sich selbst
▪ Selbstausbeutung
▪ Sich mit falschen Maßstäben zugrunde richten
▪ Härte gegen sich selbst
▪ Radikale Kontrolle über sich selbst gewinnen
▪ Sich selbst keinen Fehler verzeihen können
Sisyphos ist ein Beispiel für die Selbstzerstörung. Er muss einen schweren Stein zum Gipfel hinaufstemmen. Mit übermenschlicher Selbstüberwindung stößt er den Stein in die Höhe. Die Kräfte des Heroen lassen nach, ja näher er dem Gipfel kommt. Bevor er den höchsten Punkt erreicht, nimmt das Gewicht des Steines zu. Sisyphos kann den Stein nicht mehr halten. Die schwere Last rollt zurück. Die Arbeit war vergebens. Aber der Held macht sich wieder an die unlösbare Aufgabe. Immer wieder geschieht das Missgeschick. Der Stein ist stärker, die Last drückt den Heroen. Der Held wird immer entmutigter. Er verkrampft sich.
Schellenbaum sieht in Sisyphos Menschen, die idealistisch höchste Ziele anstreben und gleichzeitig resignieren. Sie wollen unbedingt die Kontrolle in ihrem Leben behalten und fallen doch enttäuscht in die Tiefe. Der Kontrollzwang hat den Sinn, dem befürchteten Chaos entgegenzuwirken und fehlerlos Alltag und Sonntag zu bestehen.
Das Entsetzliche ist, dass der Mensch mit Vollkommenheitsvorstellungen wie ein Besessener gegen Fehler und Versagen ankämpft und dann doch enttäuscht zusammenbricht, weil ihm die Fehlerlosigkeit nicht gelingt. Es ergeht ihm wie Sisyphos, den vor dem Gipfel die Kräfte verlassen und der selbstzerstörerisch aufgibt.
Viele Perfektionisten sind Überflieger. Sie wollen höher, weiter und schneller fliegen als andere. Sie geben das Letzte, und wenn sie scheitern, brechen sie völlig zusammen.
Selbstzerstörung beinhaltet,
– wer nur auf die eigene Leistung schaut,
– wer sich und das Leben völlig kontrollieren will,
– wer sich ständig mit andern vergleicht und sich übernimmt,
– wer an Entscheidungen festhält, die er einmal getroffen hat, und sich nicht verändern kann.
Perfektionisten sind fehlerorientiert
Überspitzt formuliert gibt es zwei Sorten von Menschen. Die einen sind erfolgsorientiert. Sie glauben an sich, haben ein gutes Selbstvertrauen, packen Arbeiten ruhig und zuversichtlich an. Ihnen gelingt in der Regel ihre Arbeit. Sie haben Erfolg.
Und dann gibt es Menschen, die sind fehlerorientiert. Ihre Befürchtungen bremsen ihre Leistungen. Sie haben Angst, Fehler zu machen. In ihnen schwingt fortwährend die Furcht mit, zu versagen oder durchzufallen.
Perfektionismus ist eine Schuld, die viele Christen unwissend praktizieren. Sie glauben daran, tugendhaft, wahrhaftig und perfekt in der Nachfolge zu stehen. Aber sie spüren nicht, wie nörglerisch, kritisch und unzufrieden sie sind.
Friedrich Hebbel hat es einmal so formuliert: »Es gibt Leute, die nur aus dem Grunde in jeder Suppe ein Haar finden, weil sie, wenn sie davorsitzen, so lange den Kopf schütteln, bis eins hineinfällt.«
Perfektionisten, Pessimisten und Unzufriedene schütteln in der Tat den Kopf so lange, bis sie Fehler und Mängel entdecken. Perfektionisten sind fehlerorientiert. Sie glauben an Fehler und Irrtümer.
Eine Jurastudentin zählt sechs Nachteile ihres Perfektionismus auf:
▪ »Erstens macht er mich angespannt und nervös, dass ich manchmal nicht ausreichend Leistungen zustande bringe.
▪ Zweitens fehlt mir oft die für kreative Arbeit nötige Bereitschaft, auch Fehler in Kauf zu nehmen.
▪ Drittens hält er mich davon ab, Neues auszuprobieren.
▪ Viertens macht er mich zu selbstkritisch und verdirbt mir alle Freude am Leben.
▪ Fünftens kann ich nie entspannen, weil ich immer wieder etwas finde, was nicht perfekt ist.
▪ Sechstens macht er mich intolerant gegenüber anderen und man hält mich für eine Nörglerin.«
Der Perfektionist straft sich selbst und ist gnadenlos. Er lebt nicht von der Gnade Gottes. Er durchforscht sich und macht sich verrückt. Alle Freude am Leben ist verdorben. Und was hilft alle Perfektion? Es hilft nur eins, dass wir uns klarmachen: Gott ist für Sünder gestorben, das heißt für Unvollkommene, für Menschen mit Fehlern und Schwächen. Der Perfektionist braucht strenggenommen Jesus nicht.
– Er will selbst makellos und vollkommen dastehen.
– Er rackert sich ab und überfordert sich.
– Er strebt die Reinheit an und nennt es Heiligung.
Perfektionismus und Kontrollzwang
Unsere Welt ist nicht völlig sicher und vollkommen. Und kein Mensch ist frei von Fehlern und Kritik. Doch von Zeit zu Zeit erleben wir alle Tage, in denen wir übertrieben Furcht davor haben, zu versagen, geliebte Dinge oder Menschen zu verlieren, dem Druck der Verantwortung nicht gewachsen zu sein. Und wir begreifen, dass wir nicht perfekt sind.
Viele Menschen fühlen sich tief im Innern bedroht, weil sie unfähig sind, Ungewissheit und Unvollkommenheit zu tolerieren. Ist es nicht auffällig, dass etwa 5 Millionen Amerikaner darunter leiden, dass sie Sicherheit, Vollkommenheit und Vorhersehbarkeit nicht beherrschen und krank werden? Was tun solche Menschen? Sie wollen ihre Befürchtungen und Ängste in den Griff bekommen. Sie wollen ihre Sorgen und unangenehmen Gedanken beherrschen. Eine Möglichkeit: Sie reagieren mit Kontrollzwang.
Kontrollzwänge haben den Sinn, mögliche »Katastrophen« abzuwenden. Sie wollen den Menschen vergewissern,
– dass der Gasherd abgeschaltet ist,
– dass Fenster und Türen verriegelt sind,
– dass ein Schriftstück fehlerfrei erstellt wurde,
– dass Fehler und Versäumnisse vermieden werden,
– dass andere Menschen nicht durch uns zu Schaden kommen.
Der Kontrollzwang kann auch ein bestimmtes Ordnungsverhalten widerspiegeln. Diese Menschen brauchen eine gewisse Symmetrie. Pedantisch genau wird das Bett gemacht. Kein einziges Fältchen darf zu sehen sein. Die Vitamine, die tagsüber eingenommen werden sollen, werden in einem speziellen Muster auf dem Küchentisch platziert. Menschen mit diesem Zwang zur Ordnung verbringen viel Zeit damit, alle Dinge an den richtigen Platz zu stellen. Hat jemand ihre Ordnung zerstört, werden sie wütend und unleidlich.
Wie entwickelt sich so ein Kontrollzwang? – Die Regel lautet: Je verbissener Sie den Gedanken, alles kontrollieren zu müssen, bekämpfen, desto mehr halten Sie ihn aufrecht. Der Kontrollzwang wird also durch einen Widerspruch verstärkt. Je mehr Sie einen solchen Gedanken abwehren wollen, desto stärker werden Sie von ihm verfolgt. Den Menschen, die unter Schlaflosigkeit leiden, ergeht es ähnlich. Was geschieht?
Wenn Sie einem Gedanken Widerstand entgegensetzen, beschäftigen Sie sich mit diesem Gedanken. Sie sind an ihn gebunden. Sie haben eine Beziehung zu ihm aufgenommen. Sie werden ihn nicht mehr los.
Und die Fachärzte beschreiben ein zweites Phänomen. Wenn Sie befürchten, dass ein bestimmter Gedanke wiederkehrt, begibt sich Ihr Körper in Abwehr und schüttet eine biochemische Substanz aus, das sogenannte Epinephrin. Diese Substanz bereitet Ihren Körper auf Kampf vor:
– Ihre Muskeln verspannen sich.
– Ihr Herzschlag und Ihre Atmung werden beschleunigt.
– Ihre Gedanken beginnen zu rasen.
– Sie sind an den Gedanken, den sie loswerden wollen, gefesselt.
Immer, wenn Sie gegen Kontrollzwänge Sturm laufen, wenn Sie gedanklich dagegen ankämpfen und sich Sorgen machen, die Kontrollgedanken könnten Sie wieder einholen, sind sie schon da.
Perfektionismus und Unordnung
Sie denken sicher auch: »Das ist ein Widerspruch. Der Perfektionist ist niemals unordentlich.« Viele Beispiele aus Seelsorge und Beratung lassen sich anführen, um zu beweisen, dass Perfektionisten schluderig sein können.
Ich möchte Ihnen ein Beispiel erzählen. – Herr Wegmann ist ein Perfektionist. Pünktlich um 15 Uhr kommt er zur Beratung. Keine Minute zu früh, keine Minute zu spät. Ordnung ist das halbe Leben. Er hat ein »großes Problem«, sagt er. Ich bitte ihn, sein Problem ausführlich darzustellen.
»Sehen Sie, das ist so. Ich habe ein Auto, einen Audi A 4. Farbe Stratosilber, damit Sie einen Eindruck haben. Im Prinzip bin ich sehr eitel und gewissenhaft. Aber eins verstehe ich nicht. Das Auto ist in der Regel schmutzig und im Kofferraum sieht es aus wie Sodom und Gomorra. Meine Frau versteht mich auch nicht. Denn sie hält mich für einen Perfektionisten, der alles – im Prinzip auch das Auto – tadellos sauber hält. Im Grunde verstehe ich mich auch nicht.«
Ich: »Was verstehen Sie im Grunde nicht?«
Er: »Dass ich das Auto nicht pingelig sauber halte, wie ich es sonst bei allen Dingen, die ich besitze, tue.«
Ich: »Sie halten sich also schon für einen pingeligen Menschen, wie Sie es sagen?«
Er: »Ja, das stimmt, ich bin ein Pedant. Nur das Ordentliche, das Saubere und das Vollkommene zählen.«
Ich: »Was, glauben Sie, hält Sie ab, Ihr Auto auch so pedantisch sauber zu pflegen?«
Er (überlegt sehr lange und sucht eine Antwort): »Vorgenommen habe ich es mir immer schon oft, aber wenn ich an die Stunden denke … «
Ich: »An die Stunden der Arbeit, meinen Sie das?«
Er: »Genau!«
Ich: »Aber wieso muss die Säuberung Ihres Wagens Stunden in Anspruch nehmen? Sie können doch für eine leidliche Ordnung sorgen!«
Er: »Leidliche Ordnung – das gibt es nicht für mich!«
Ich: »Ich verstehe Sie so, dass die Ordnung hundertprozentig sein muss!«
Er (lächelt): »Im Grunde hätte ich es nicht treffender ausdrücken können!«
Ich: »Mit anderen Worten: Sie fangen eine Arbeit nicht an, wenn Sie sie nicht hundertprozentig pingelig erledigen können?«
Er (legt seine Stirn in Falten): »Das ist es. Ja, das ist es. Wenn ich etwas nicht vollkommen erledigen kann, fange ich erst gar nicht an!«
Ich: »Und wie lange dauert normalerweise eine vollkommene Säuberung Ihres Autos?«
Er: »Etwa einen ganzen Tag. Wenn ich an einem Samstag drangehe, bin ich von morgens bis abends beschäftigt. Und das kann ich mir nur selten erlauben.«
Schauen wir uns das Gespräch an. Kann der Perfektionist Unordnung ertragen? Einige Gesichtspunkte:
Gesichtspunkt Nr. 1:
Der Perfektionist kann Unordnung ertragen.
Auch wenn es ihm schwer fällt. Er leidet. Aber Halbheiten hasst er. Eine »leidliche Ordnung« ist keine Ordnung. Er strebt das Vollkommene an, und diese Vollkommenheit braucht Zeit.
Gesichtspunkt Nr. 2:
Der Ratsuchende hat ein »großes Problem«.
Das ist typisch für den Perfektionisten. Er macht aus Mücken Elefanten. Kleinigkeiten werden dramatisiert. Fehler und Mängel zu übersehen fällt ihm schwer. Je perfektionistischer ein Mensch denkt, desto mehr leidet er unter Schwächen und Unvollkommenheiten. Ihm fehlt der Mut zur Unvollkommenheit.
Gesichtspunkt Nr. 3:
Der Pedant und Pingel macht sich das Leben schwer.
Er kann nicht großzügig denken. Es fällt ihm schwer, über sich und andere zu lachen. »Humor ist, wenn man trotzdem lacht!« Wer Fehler übersehen, Schwächen beiseitelegen und Unvollkommenheiten belächeln kann, ist ein glücklicher und zufriedener Mensch. Der Perfektionist versteht es, sich selbst ein Bein zu stellen.
Perfektionismus und die Gaben-Bremse
Perfektionisten wollen keine Fehler machen. Wer aber keine Fehler machen will, muss alle Aktivitäten bremsen. Er tut gut daran, seine Talente zu vergraben.
Da ist die Geschichte, die uns Jesus von einem Mann erzählt, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silbergeld, dem anderen zwei Zentner und dem dritten einen Zentner, je nach ihren Fähigkeiten. Der letzte Halbsatz ist entscheidend. Jesus kennt auch unsere Begabungen. Er schätzt alle Menschen richtig ein. Von Christen mit hohen Begabungen erwartet er mehr als von Menschen mit kleinen Begabungen. Niemand wird von ihm überfordert. Niemand wird getadelt, dass er nur kleine Möglichkeiten zur Verfügung hat. Wenn aber jemand das anvertraute Gut in den Safe packt, wenn jemand seine Talente vergräbt, dann erfährt er Gottes Urteil.
Perfektionisten, die Fehler machen könnten, sind solche Gaben-Bremser. Ihre Befürchtungen sind größer als ihr Wagemut, ihre Ängste sind größer als ihre Fähigkeiten. Perfektionisten wittern tausend Pleiten. Sie grübeln in alle Himmelsrichtungen und lähmen ihre Kräfte. Perfektionisten stehen sich selbst im Weg. Sie blockieren ihr Leben.
Der Benediktiner-Prior Anselm Grün kennzeichnet diese Angsthasen so:
»Der Angsthase. Die Angst vor dem Herrn ist der Grund dafür, dass der Diener sein Talent vergräbt, dass er am Leben vorbeilebt. Er möchte auf jeden Fall vermeiden, einen Fehler zu machen. Er möchte auf Nummer sicher gehen. Und die Angst treibt ihn dazu an, sich und sein Leben zu kontrollieren. Er hat Angst vor dem Tod, Angst vor Versagen, Angst, sich vor anderen zu blamieren.«7
In der Tat, Menschen mit einem mangelhaften Selbstbild haben in der Regel ein mangelhaftes Gottesbild. Die Lebensangst des Perfektionisten blockiert ihn auf allen Gebieten. Der Perfektionist grübelt und sichert zu viel. Jesus geht hart mit diesen Menschen ins Gericht. Ihnen wird alles genommen, was sie haben.
Perfektionismus und Idealismus
Viele Christen versuchen, idealistisch zu leben. Ihre Ansprüche an sich und andere sind riesig. Wie kann sich dieser Idealismus äußern?
▪ Sie können sich Fehler nicht verzeihen.
▪ Sie praktizieren heftige Selbstbeschuldigungen.
▪ Sie wollen alle Leidenschaften niederringen.
▪ Sie reagieren mit übergroßen Schuldgefühlen.
▪ Sie lassen in der Ehe, in der Kindererziehung, im Haushalt und im Glauben nur das Höchste und Beste zu.
Dieser Idealismus macht den Christen unfroh. Er unterzieht sich einem »geistlichen Terror«, der biblisch und geistlich unverantwortlich ist. Christen legen sich Lasten auf, die ihnen Gott nicht auferlegt hat. Ihre Maßstäbe, die sie an alles legen, sind überhöht. Werden diese Maßstäbe nicht erreicht, fallen diese Menschen in Resignation und Bitterkeit. Ihre Enttäuschungen sind selbstzerstörerisch.
Der Franziskaner-Pater Richard Rohr beschreibt mit entwaffnender Ehrlichkeit, wie Perfektionismus und Idealismus zusammenhängen:
»EINSer sind Idealisten, die von einer tiefen Sehnsucht nach einer Welt der Wahrheit, Gerechtigkeit und moralischen Ordnung angetrieben werden. Sie tun sich schwer, eigene und fremde Unvollkommenheiten zu akzeptieren. Ich selbst bin eine EINS. Von klein an haben wir EINSer meistens versucht, Musterkinder zu sein. Schon in sehr jungen Jahren haben wir jene ausgesprochenen oder unausgesprochenen Stimmen internalisiert, die gefunkt haben: ›Sei brav! Benimm dich! Streng dich an! Sei nicht kindisch! Mach es besser!‹… Oft ist eins der beiden Elternteile eine EINS, moralistisch, perfektionistisch oder ewig unzufrieden.«8
Nach dem »Enneagramm« sind die EINSer die Moralischen und die Perfektionisten. Häufig Musterkinder und Idealisten, die die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen trachten. Ihre überehrgeizigen Ziele und ihre überzogenen Ideale machen sie unzufrieden und unglücklich. Ihre Enttäuschung ist groß, weil sie auf vielen Gebieten ständig hinter idealistischen Maßstäben herlaufen. Viele Idealisten üben Verzicht. Ihre Askese ist in erster Linie Selbstbeschränkung. Sie wollen ihre Triebe, ihre Gefühle und alle Bedürfnisse unter Kontrolle behalten. Unter der Hand werden diese Idealisten zu Pharisäern.
Perfektionistische Lebensstile
Ein Selbsterforschungsfragebogen
Hinweise für den Selbsterforschungsfragebogen
»Perfektionistische Lebensstile«
▪ Füllen Sie den Fragebogen ehrlich aus und machen Sie ein Kreuz in eins der drei Fächer.
▪ Ihr Lebensstil beinhaltet Ihre Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster. Er beinhaltet Ihre wichtigsten Glaubens- und Lebensüberzeugungen.
▪ Im Grunde spiegeln alle 20 Aussagen eine perfektionistische Grundeinstellung wider. Wie oft haben Sie »stimmt etwas« bzw. »stimmt voll« angekreuzt?
▪ Wenn Sie etwa 15-mal ehrlich »falsch« angekreuzt haben, sind Sie mit relativer Sicherheit kein Perfektionist und leiden sehr wahrscheinlich nicht unter Unzufriedenheit und Unglücklichsein.
▪ Haben Sie Lebens- und Arbeitsprobleme? Leiden Sie unter Unzufriedenheit und Stress? Spüren Sie psychosomatische Belastungen? Je mehr Sie diese Fragen positiv beantworten müssen, desto mehr sollten Sie sich um eine Korrektur Ihres Lebensstils bemühen, der höchstwahrscheinlich auf Vollkommenheitsstreben hindeutet.