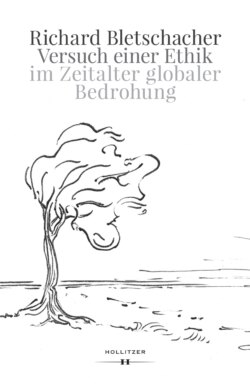Читать книгу Versuch einer Ethik im Zeitalter globaler Bedrohung - Richard Bletschacher - Страница 7
EINLEITUNG
ОглавлениеWenn das Schrifttum eine Sendung hat, so kann es die sein, den Selbstmord der Menschheit zu verhindern.
(Johannes Urzidil)
Wer eine befriedigende moderne Ethik der menschlichen Beziehungen schreiben will, muss vor allem die notwendigen Begrenzungen menschlicher Macht über die außermenschliche Umwelt und die wünschenswerten Einschränkungen der Macht der Menschen übereinander erkennen.
(Bertrand Russel)
Es ist das große und, wie es scheint, nicht enden wollende Bestreben des menschlichen Denkens, sich zu fragen, wie wir auf unserem Weg durch die Wirrnisse dieser Welt vorangehen und handeln sollen, wohin wir gelangen sollen und was wir hoffen dürfen zu erreichen. Die Antwortversuche auf diese Frage sind ohne Zahl, denn die für unser aller Dasein fruchtbringendsten Zweige des viel verästelten Fragebaumes unseres Geistes sind die, die sich nach Erkenntnis recken, nach Auskunft über die Entstehung des Lebens, um es zu erhalten, nach den Bedingungen unseres Handelns und nach dem, was uns in Zukunft beschieden sein mag. Es gibt nicht wenige, die meinen, es sei das Beste, auf den Erfindungsgeist des Menschen zu vertrauen und uns nur irgendwie mit dem zu behelfen was geschieht. Das mag in Zeiten und Kulturen hingegangen sein, in denen man im ererbten Haus nach der Sitte der Altvorderen lebte und im Übrigen den Göttern oder einem aus ihren Reihen Gesandten das Amt überlassen hatte, die Welt zu lenken. Seit aber rings um uns so viele, mündig geworden, sich nicht weiter lenken lassen wollen und den Anspruch erheben, in Belangen der allgemeinen Wohlfahrt selbst das Wort zu ergreifen, seit ein jeder sich müht, es dabei dem anderen zuvorzutun, haben sich im Gestrüpp dieses wild wachsenden Treibens und Zerrens die Meinungen, Urteile und Erwartungen vielfach neu gebildet.
Wenn man den Fortgang unseres Lebens als den kurzen und gefahrvollen Weg von einer undurchschaubaren Finsternis in eine andere bezeichnen darf, so wird man daraus leicht verstehen, dass wir trotz allem sich mehrenden Eigensinns noch immer nach Vorbildern Ausschau halten, nach Kundschaftern, die uns vorausgegangen sind, oder nach Weggefährten, die uns Halt versprechen und denen wir vertrauen können, um nicht zu straucheln. Ihnen verdanken wir die Leitlinien der Ethik, die uns seit zweieinhalbtausend Jahren auf diesem Weg begleitet haben, wenngleich sie nicht auf alle unsere Fragen Antworten zu geben vermochten. Warum und zu welchem Ziel wir unterwegs sind, darüber geben sie keinen Aufschluss. In ihrem Bemühen, uns vom Verderblichen abzuhalten, geraten auch sie immer aufs Neue in unwegsames Gebiet, auf Holzwege, die der Philosoph Aporien nennt, ohne uns dadurch weiter zu helfen. Und darum soll, was hier geschrieben wird kein Lehrbuch werden, das unterrichten will, sondern ein Nachdenkbuch, das unser Handeln und Lassen prüft in einer Zeit erstaunlicher Möglichkeiten und beängstigender Bedrohungen. Es ist an uns zu erkennen, dass wir in einer Epoche leben, die sich mit keiner vorhergehenden vergleichen lässt. Denn wir haben, seit uns Forschung und Technik neue, weit ausgreifende Instrumente in die Hand gegeben haben, nicht allein für unser eigenes und das Leben unserer Nächsten Sorge zu tragen, sondern für die Erde insgesamt. Wenn man manche der Eingriffe des Menschen in die Natur mit Schrecken wahrnehmen muss, will es einem scheinen, als hätten viele von uns den Instinkt verloren, der uns so lange sicher geleitet hat. Die Folgen unserer Handlungen sind von Einzelnen nicht mehr zu verantworten. Darum tut es Not, die Maximen unseres Handelns wiederum zu prüfen und zu urteilen, ob sie als Vorbild für ein allgemeines Tun und Lassen noch gelten können. In unserer Hand liegt mehr denn je das Wohl und Wehe allen Lebens auf diesem blauen Planeten.
Warum die Forderung nach einer neuen – oder doch zumindest um neue Dimensionen erweiterten – Ethik nicht allein an dieser Stelle, sondern vielerorts zu Recht und immer deutlicher erhoben wird, muss nicht lang begründet werden. Wenn die Philosophen von Leibniz bis Hegel an eine allmählich fortschreitende moralische Veredelung des Menschen und an deren Vollendung in der Zukunft als anzustrebendes Ziel glaubten, so haben wir, auch wenn einige die Hoffnung oder auch nur die trotzige Pflichterfüllung zum Prinzip erhoben haben, daran schmerzlich zu zweifeln begonnen.
Die beiden vergangenen Jahrhunderte haben sich abgekehrt von guten wie von schlechten Bräuchen, von kirchlichen Dogmen und von Zukunftsentwürfen der Amerikanischen, der Französischen und der Russischen Revolutionen; sie haben den Wunschtraum der Freiheit missbraucht, um die Triebe der Habgier zu entfesseln. Sie haben neue Richtlinien einer liberalen Ethik geschaffen aus dem Recht, das der Stärkere gewann über den Schwächeren, der Reiche über den Armen und der Listige über den Arglosen. Macht über Macht, Raub über Raub, Betrug über Betrug und Wollust über Wollust waren die Ziele der Kolonisatoren, der Ausbeuter, der Rassenfanatiker, der Militärdiktatoren und sind weiterhin das Ziel der transnationalen Profitmaximierer. Die Zeitungen sind noch immer voll von Klagen darüber und zugleich von Bekundungen der Unterwerfung. Der Dienst der Medien an der Klasse der Reichen und Schönen ist Reklame und Propaganda einer nur mehr dem gemeinen Wohlbefinden verpflichteten Moral. Ihr Lohn ist der der Teilhabe an Macht und Gewinn. Und schon ist auch die Zeit gekommen, dass die bildmächtigen Medien den Gazetten das Wort abschneiden, kaum dass sie es ergriffen haben. Als geschehen gilt seither nur mehr das, worüber berichtet wird. Wahr ist, was von Lautsprechern oftmals und immer wieder behauptet wird. Gerecht ist, was der Markt erfordert. Der Markt, so heißt es, ordne sich selbst. Er allein habe die Kraft der Selbstreinigung. Das Verderbliche verdirbt, so heißt es, und das Gesunde gedeiht. Die Gier betreibt das Geschäft und das Geschäft bestimmt den Erfolg. Und der Erfolg wird in Geld und öffentlichen Auftritten gemessen. Dahin hat es der Mensch gebracht. Er hat die Popstars und Finanzhaie, die Tycoons, die Filmbosse und die Zeitungsmogule, die Bestsellerautoren, die Warlords und Drogenbarone auf die verwaisten Stühle der Könige, Richter, Priester und Lehrer gesetzt. Und die Lobbyisten wirken nun mit an den Gesetzen, im Auftrag der transkontinentalen Vervielfältiger privater Profite. Längst hat die aller staatlichen Kontrolle entzogene anonyme, globale Wirtschaft die Führung der Geschäfte übernommen und hinter und über ihr die von allen materiellen Sicherheiten abgehobene Macht der Finanzen.
Zwar sind aus allen Zeiten und Kulturen schreckensvolle Nachrichten zu uns gekommen, doch haben Verbrechen eines übergroßen Maßstabs erst in der Neuzeit als der Epoche der Kolonisation in den neu entdeckten Ländern jenseits des Atlantik und im fernen Pazifik durch die europäischen Seemächte ihren Anfang und endlich in unseren eigenen Höfen durch ideologische Kriege, Vertilgung anders Denkender und Rassenwahn ihren Fortgang genommen. In der Neuzeit, die in abstrakter Theorie das Menschleben zu ihrem höchsten Wert erhoben hat, wurden so viele Menschen getötet oder auch ohne bestimmte mörderische Absicht dem Tod ausgeliefert wie in keiner anderen Epoche. Nach dem Völkermord an den Indigenen in Amerika und der Versklavung der Schwarzen erreichten die Massenmorde ihren Höhepunkt in den Rassen- und Klassenkämpfen, Kriegen und Vernichtungslagern des 20. Jahrhunderts. Der Philosoph und Friedensaktivist Günther Anders hat unter dem Eindruck der Bomben auf Hiroshima und Nagasaki an den französischen Philosophen Gabriel Marcel geschrieben, dass der Abstand zwischen dem, was der Mensch bewirken, und dem, was er verantworten könne, inzwischen längst zu groß sei, um überbrückt zu werden. Wenn auch der Schrecken über die neuen Vernichtungsmittel der beiden Weltkriege die Welt einen Augenblick hat einhalten lassen, so musste man doch bald erkennen, dass das bedenkenlose Morden auch seither kein Ende genommen, sondern sich vielfach in unverminderter Grausamkeit auf getrennten Kontinenten fortgesetzt hat. Man denke nur an den Algerienkrieg der Franzosen, den Vietnamkrieg der Amerikaner, an die Gräuel des Pol Pot-Regimes in Kambodscha, an die Vernichtungsfeldzüge der Hutu-Milizen in Ruanda, an die Massaker während des Bosnienkrieges und zuletzt an die Bürgerkriege in den arabischen Ländern. Über vier Dutzend Kriegsfälle – und darunter nicht wenige massenmörderische – hat man gezählt seit einer Zeit, da sich alle Welt geschworen hatte, nie mehr die immer furchtbarer gewordenen Waffen gegeneinander zu erheben. Landminen und Sprengfallen fordern nach wie vor ihre Opfer. Die meisten dieser Waffen werden in „friedliebenden“ Ländern gefertigt und in kriegführende verkauft. Um der oft so überzeugend auftretenden Ideen der beiden vergangenen Jahrhunderte willen sind mehr Menschen von Menschen getötet worden als in Jahrtausenden zuvor.
Wenn die militärischen Bedrohungen hier auch zuerst genannt werden, so sind die zivilen um nichts weniger gefährlich für das Überleben der Menschheit. An diesen haben viele mitgewirkt, manch einer hat guten Gewinn gemacht, aber keiner will Schuld daran tragen. Nach der Industrialisierung der Länder wurden die Meere und endlich gar der Himmel industrialisiert, will sagen dem Gewinnstreben unterworfen. Der nicht allein nach Erkenntnis, sondern mehr noch nach Macht und Gewinn strebende Geist, wollte sich durch keine Schranken mehr behindern lassen und achtete nicht auf die Folgen. Man denke an die Vermüllung der Atmosphäre, an die Umweltvergiftung, an die Ausbeutung der irdischen Ressourcen; man denke an die Ausbeutung der Arbeitskräfte im Namen des Kapitals und die daraus entstehenden sozialen Verwerfungen; man denke an die Vertauschbarkeit aller Werte von realem Besitz in entmaterialisierte Valuten, die allen Fingern entwischen; man denke an die Vermarktung des menschlichen Körpers als Ersatzteillager für wohlhabende Kommunen; man denke aber auch an manche gefährlichen Wege, die die übermächtigen Naturwissenschaften im Verfolgen eines imaginären Fortschritts zu gehen bereit sind und die vielleicht zu nicht mehr kalkulierbaren Risiken und Kettenreaktionen führen werden. Es seien hier nur – stellvertretend für viele andere Gefahren – die Datenabsaugungen und -speicherungen durch die großen politischen und kommerziellen Mächte genannt oder die Bestrebungen des sogenannten Transhumanismus, der sich zur Aufgabe gestellt hat, den menschlichen Geist vom Körper zu trennen, um ihn für eine Übertragung auf ferne Gestirne tauglich zu machen. Der Phantasie sind auf diesem Gebiet keine Grenzen gesetzt. Wenn dies sich mehrt und wuchert, stehen uns grimmige Zeiten bevor.
Diese und andere neu erwachsene Bedrohungen machen es erklärbar, warum an vielen Orten Versuche unternommen werden, für all die bisher nicht geahnten Möglichkeiten menschlichen Handelns neue Bedingungen, Wege und Grenzen zu erforschen; denn darin sind sich nun alle Kulturen einig: Nicht alles, was machbar erscheint, darf auch gemacht werden, wenn wir und unsere Nachkommen auf dieser Erde überleben wollen. Die Zivilgesellschaft muss sich erheben im Namen eines ethischen Gewissens, um den politischen und wirtschaftlichen Machthabern in die zerstörenden Arme zu fallen. Die verborgenen lebensfeindlichen Mächte des Geldes müssen namhaft gemacht und ans Licht gezogen werden. Wenn keine Justiz sie wirklich belangen kann, muss die allgemeine Verachtung Rechenschaft von ihnen fordern. Dies ist die Aufgabe einer neu zu vereinbarenden Ethik.
Was unserem Überleben dienlich oder schädlich und darum geboten oder verwerflich sei, meint ein jeder ohne viel Zaudern zu wissen. Fragt man ihn aber, ob er meine, diese Unterscheidung werde nicht nur hierzulande erkannt, sondern auch in fremden oder gar feindlichen Ländern, wird er zu zweifeln beginnen; und fragt man, ob bei den Alten dasselbe Urteil gegolten habe, bei den Kreuzfahrern, den Ketzern, den Hindus, den Malaien, den Indianern, wird er dies entschieden verneinen. Und gar, wenn auf die Zukünftigen die Rede kommt, auf unsere Kinder und Enkel, wird er mit Gewissheit fordern, dass sich vieles bis heute hoch Gehaltenes wird ändern müssen, um auch für diese noch gut und gerecht zu sein.
Das Denken vom Guten, als welches die Ethik mit einem kurzen Wort benannt werden kann, bekommt das, worauf es abzielt, nie so recht zu fassen. Immer entwischt, wenn man einen Teil von der Sache meint ergriffen zu haben, ein anderer Teil. Manches, was gestern nützlich schien, erweist sich heute als schädlich. Und manches planen wir heute in der frommen Absicht zu helfen und bringen Unheil über unsere Nachkommen morgen. Wenn im Altertum der besitzenden Klasse jede Arbeit von der Sitte untersagt war, so kam darauf eine Zeit, in welcher Arbeit den Menschen adelte. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, schrieb der Apostel Paulus und so pflegte man noch im vergangenen Jahrhundert zu sagen. Heute denkt man darüber nach, an alle, ohne genau definierte Gegenleistung, ein auskömmliches Grundeinkommen zu verteilen, und hat gute Gründe dafür, da man fürchten muss, dass allzu viel Arbeit die Erde zerstören könnte. So ändern sich die Zeiten und unsere Überzeugungen sich mit ihnen.
Auch wenn wir bestimmen sollen, für wen und wem gegenüber unsere Vereinbarungen nun zu gelten haben, ob allein für die Menschen oder auch gegenüber den Primaten, den Säugetieren, den Tieren der Luft oder des Meeres oder gar den Würmern und Termiten, so wird manch einer spätestens bei den zwar lebendigen und auch nicht fühllosen Pflanzen sich weigern, ein jedes Lebewesen für ein Subjekt der Ethik anzuerkennen. Da alles Leben sich allein durch Fressen und Gefressenwerden von Lebendigem erhält, muss in einem jeden, ob verborgen oder offen zutage tretend, sowohl die Angst vor dem möglicherweise gefahrdrohenden Fremden als auch der Trieb zu töten und zu verschlingen angelegt sein, denn ein jedes will sich seines Lebens erwehren und sich am Überleben zu halten suchen. Das aber kann, ohne ein anderes hintan zu setzen oder gar zu verletzen, nicht gelingen. Eine objektive Moral, die Geltung beanspruchen dürfte außerhalb der menschlichen Gemeinschaft, ist darum ebenso wenig zu statuieren wie eine objektive Wahrheit oder Gerechtigkeit in allen irdischen Dingen. Misstrauen ist anzuraten gegenüber allen, die behaupten zu wissen was für alle Lebenden und was zu allen Zeiten gut und böse sei. Andererseits widerstrebt es uns als denkende Wesen, uns mit dem zufrieden zu geben, was einige leichtfertig als situative Ethik benennen. Das will vermutlich eine Ethik meinen, die sich den jeweiligen Verhältnissen anpasst, denen sich der Handelnde gegenübersieht. So wenig man die Freiheit des Menschen beschneiden will, so sehr fühlt man doch, dass ihr Grenzen gesetzt werden müssen dort, wo sie die Freiheit oder das Leben anderer Lebewesen gefährdet. Und so leben wir in immer erneuerter Hoffnung, es müssten die Postulate einer allgemeineren, umfassenderen Ethik, wenn schon nicht für immer und überall, so doch über längere Zeiten und weit gedehnte Grenzen hinweg zu finden sein, mit dem utopischen Ziel, dass endlich Frieden herrsche auf Erden. – Und doch wissen wir, dass dieser, so wie ihn einst die Mythen erträumten, nicht erreichbar sein wird. Man gerät mit derlei Ausfahrten der Hoffnung sehr bald in stürmische oder in seichte Gewässer und in die Gefahr auf Klippen oder auf Sand zu laufen.
Seit Jahrzehnten schon ist viel Gerede um eine gerechtere Weltordnung in allen Gazetten, öffentlichen Diskursen und Kongressen. Man wird sich mühen müssen, den Schaum des Geschwätzes abzuwehren, um der Sache auf den Grund zu kommen. Wenn hier nun nachgedacht und dem Gedachten nachgeschrieben werden soll, über das, was Menschen unterschiedlicher Rassen, Religionen, Nationen oder Kulturen gemeinsam als gut oder böse erscheint, so ist voraus zu bemerken, dass zwar alle aus solchen Festlegungen sich erhebenden Forderungen oder Zurückweisungen sich immer nur an die wenigen wenden, die Ohren haben um zu hören und Augen um zu lesen. Andererseits aber haben seit unvordenklichen Zeiten sehr wohl Familien, Gruppen, Gemeinschaften, Völker sich untereinander besprochen und Verantwortung übernommen für andere, indem sie einander unterwiesen, Unterstützung gewährt oder verweigert haben oder indem sie einander entgegengetreten sind. Denn manches – und dies gilt für die jüngst vergangenen Jahrhunderte mehr als für alle zuvor –, ist im Namen vieler geschehen und hat die Verantwortung des einzelnen Menschen weit überstiegen. Und manches von solchem nicht mehr zu Verantwortenden kann, ohne dass wir es ahnen, unabsehbare Folgen haben für ferne Generationen und endlich sogar für alles Leben auf unserer Erde.
Im Gegensatz zu vergangenen Jahrhunderten wurden von Staaten und Industriekonzernen Waffen entwickelt, die eine so große Vernichtungskraft besitzen, dass ihre zerstörende Wirkung nicht mehr allein gezielt auf einzelne Gegner gerichtet werden kann, sondern dass ein weites belebtes Umfeld von ihr betroffen wird. Man hat den zynischen Begriff des Kollateralschadens geprägt, der bei einer notwendigen Operation nolens volens in Kauf genommen werden müsse. Die Erfindung des Dynamits im Jahre 1867 hat diese Entwicklung entscheidend befördert. Dass der Erfinder dieses lebensfeindlichen Sprengstoffs mit dem dadurch verdienten Geld eine Stiftung dotiert hat, die bedeutende Leistungen im Dienste der Menschheit auszeichnen soll, zeugt nicht so sehr von der Menschenliebe als vielmehr vom schlechten Gewissen des Spenders. Die Annahme eines solchen Preises sollte die Auserwählten vor die Frage stellen, ob sie sich durch die hohe Geldsumme nicht werden verlocken lassen, die giftige Quelle, aus der der Geldstrom ihnen zufließt, zu verharmlosen oder gar vergessen zu machen. Es vergeht kaum eine Stunde, in der nicht in irgendeinem Teil des Planeten ein Mensch durch die in der Nachfolge dieser Erfindung entbundenen Kräfte getötet oder verwundet wird. Man hat Ähnliches von der Erfindung und massenweisen Verbreitung des Automobils, der Fluggeräte und anderer Fortbewegungsmittel behauptet. Auch wenn die Wirkung eine ähnliche ist, so liegt der Unterschied doch in der ursprünglichen Zielsetzung, die eine vermeintlich gute war, da sie die Menschen einander näher bringen sollte und nicht auf Zerstörung bedacht war. Dennoch wurde auch durch jene der vieltausendfache Tod von Menschen verursacht. Wenn zwar die nach jedem Krieg immer aufs Neue postulierte Kollektivschuld ganzer Völker an wahllosen Vernichtungen nicht anerkannt werden kann, da immer ein Einzelner die erste Anregung oder den letzten Anstoß zu diesen Verbrechen geben muss, so ist es doch daneben eine gemeinsame Verpflichtung zu fordern, dem Leben zu dienen und dem Töten in den Arm zu fallen.
Nicht geringere, sondern am Ende wohl noch weit größere Schuld an der Vernichtung menschlichen und tierischen Lebens trägt die technologische und industrialisierte sogenannte Kultivierung der Erde, welche die unabsehbaren Folgen durch Verschmutzung der Meere, Verpestung der Luft und Verseuchung des Bodens mit sich gebracht hat. Seit das Morden und Vergiften automatisiert wurde, haben sich die Haftungen für die Folgen vergemeinschaftet und niemand will sich mehr zu persönlicher Schuld bekennen. In einigen Staaten wird seit Jahren an einem automatischen Waffensystem gearbeitet, das selbsttätig, ohne Lenkung durch einen Menschen, sogenannte Gegner ins Visier nehmen und „neutralisieren“ kann. Staaten haben keine Moral. Staaten haben, wie der geläufige Spruch eines preußischen Diplomaten lautet, Interessen. Darum ist uns nicht damit gedient, die Lenker dieser Staaten aufzurufen, Maßstäbe und Richtlinien für das ethische Verhalten ihrer Völker zu erlassen. Man hat gesehen, wohin dies führte, als der wohlmeinende Kaiser Augustus seine Gesetze zur Hebung der Ehemoral erlassen hat. Er hat am Ende doch nichts weiter zu bewirken vermocht als den Hohn und Widerspruch seines Volkes. Man weiß zu welchen Übelständen im vergangenen Jahrhundert das Alkoholverbot in den Vereinigten Staaten geführt hat. Und endlich haben wir in unseren Tagen die widerwärtigste Anschauung zu erdulden von den immer rigoroseren Moralgesetzen mancher islamischer Staaten. Des allen ungeachtet müssen durch öffentlichen Diskurs von Zeit zu Zeit neue Richtlinien für das menschliche Verhalten entworfen werden, an denen das Gewissen der Individuen in unterschiedlichen Ländern Orientierung suchen und Bestätigung finden kann. Es müssen die Folgen auch der gemeinschaftlichen Entwürfe und Taten aufgezeigt werden, Ziele vorausblickend angedeutet und Urteile rückblickend ausgesprochen werden. Ein Weniges davon soll auch mit den folgenden Zeilen geschehen.
Die sogenannte Globalisierung der bewohnten Welt hat es mit sich gebracht, dass die alten Grenzen zwischen Staaten, Völkern, Religionsgemeinschaften und Klassen mehr und mehr abgebaut wurden. Danach aber haben sich Forderungen erhoben nach Regeln in den Begegnungen der immer noch sehr unterschiedlichen Gruppen, die doch die eigentlichen Ganglien bilden im gesellschaftlichen Gewebe. Immerhin ist es möglich, einige der Forderungen zu benennen, die an alle gemeinsam gestellt werden müssen. Und so ist es angebracht, im Voraus eines solchen Unternehmens einzugestehen, dass es nur bei einem Versuch bleiben kann. Der aber soll, auch wenn er nicht mehr bewirken wird als andere vor ihm, dennoch gemacht werden; denn nichts sollte uns mehr am Herzen liegen als zu erfahren, ob wir und unsere Nachbarn das Rechte tun, in unserem eigenen und in fremdem, gar allgemeinem Sinne, ob wir die Welt, an der wir seit tausend Generationen und länger bauen, mit unserem Handeln fördern oder verderben werden. An dieser Mühe nämlich liegt es, ob wir – und mit diesem wir ist ein jeder unter den Denkenden gemeint – belohnt und geachtet werden und ob wir vor uns selber bestehen können zu jeder Stunde, bis zu unserer letzten.
Wir werden, um es vorwegzunehmen, keine Antwort finden, die für alle Zeiten und in allen Ländern der Erde gültig und anerkannt sein wird. Wir werden mit unseren Urteilen nicht einmal jedem Einzelnen gerecht werden können. Nicht einmal uns selbst, unserem Land und unserer Zeit werden wir vollauf genügen. Denn es sind sich zwar alle darüber einig, dass es so etwas wie eine allgemein menschliche Moral geben müsse, deren Ausprägungen aber sind, je nach Ländern und Epochen, je nach wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, so unterschiedlich, dass man an einer Verständigung über alle Grenzen hinweg zweifeln möchte. Vielleicht aber können wir helfen, das Gute zu befördern und das Böse, das in einzelnen Gehirnen und das Schädigende, das auf vielen Straßen unterwegs ist, hindern, uns zu überwältigen und die ganze Erde mit uns. Als das Böse, so scheint es uns auf den ersten und noch nicht sehr genauen Blick, hat man zu allen Zeiten, und so auch heute, das Zerstörende oder besser gesagt: das Vernichtende bezeichnet. Ob dagegen das Gute das Bauende, das Erhaltende und das Ordnende sei, das ist eine mit größerer Mühe zu beantwortende Frage. Denn wenn die Welt ein einziges Werden, Wachsen und Vergehen ist, so sollte man bereit sein, um dieser ans Licht drängenden Zukunft willen, auch das Zerstörende neben dem Aufbauenden gelten zu lassen.
Es ist ausgemacht, dass wir, die wir Teil dieses Prozesses sind und für uns selbst das Sein erstreben und das Nichtsein scheuen, nicht Richter eines Geschehens sein können, das uns umfasst und übersteigt. So sehr wir uns wünschen mögen, Gesetze unseres Handelns zu erkennen, die für alle Zeiten bisher gegolten haben und weiterhin gelten sollten, so werden wir doch gut daran tun, uns zu bescheiden mit den Jahrzehnten oder den Jahrhunderten, die wir überblicken. Befördert durch die ständig sich mehrenden Erkenntnisse der Forschung, vor allem auf den Gebieten der Naturwissenschaften, wandelt sich unsere Welt seither in schier atemberaubender Geschwindigkeit. Was früher über Jahrhunderte gelten mochte, das hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte geändert. Man denke nur daran, dass es das Frauenwahlrecht in Europa erst seit gut hundert Jahren gibt – in einzelnen Ländern wesentlich kürzer. Man denke an die revolutionierte Sexualmoral oder an die erst seit etwa über zweihundert Jahren postulierten Menschenrechte. Es soll darum hier gesprochen werden allein für unsere eigene Lebenszeit, für diese Epoche der großen Umstürze, Wenden und Wandlungen, die Epoche der unvorhergesehenen krebsartigen Vermehrungen und Vermassungen, die Epoche der Vermischungen und Infragestellungen aller einst getrennten Gedanken und Glaubensüberzeugungen, der Bedrohungen durch die Umweltverseuchungen, der zuvor nie gekannten Vernichtungswaffen chemischer, physikalischer oder elektronischer Art. Nicht geringer muss uns heute die bedenkenlose Ausbeutung der Natur durch das millionenfache Roden von Bäumen erscheinen. Wir hören, dass von tausend Kanzeln, Pulten und Sendeplätzen Warnungen ausgehen, wir lesen, dass in tausend Zeitungen, Sachbüchern und im Internet Schlimmes vorhergesagt wird, das uns und unseren Planeten bedrohe. Wir riechen, schmecken und sehen, dass die Luft verpestet, die Meere verseucht, die furchtbarsten Waffen erprobt werden. Und dennoch hören wir nicht damit auf, die Ressourcen der Erde zu verprassen, Millionen und Abermillionen von Menschen dem Hungertod preiszugeben oder in die Flucht zu treiben und selbst in den reichsten Staaten ein unabtragbares Gebirge von Schulden anzuhäufen. Wir haben eines der schreckensvollsten Jahrhunderte der menschlichen Geschichte durchlebt. Und entsetzt und ernüchtert ans Ufer eines neuen gekommen, beginnen wir zu erkennen, dass wir nicht nur unser Handeln, sondern auch unsere Überzeugungen ändern müssen, wenn es unseren Nachkommen gegönnt sein soll, in Würde zu überleben. Belehrungen alter Fahrensleute werden uns dabei nicht nützen. Es ist bei all den neuen Herausforderungen sehr die Frage, ob uns die alten Erzählungen helfen werden, die anstehenden Prüfungen zu bestehen. Viele unter uns haben sich ihre Meinungen seit langem gebildet und werden nicht abgehen von ihrem Weg, zumal dann nicht, wenn sie es sind, die in Politik, Finanz, Industrie oder Religion das Ruder führen. Nirgends erkennt man dies besser als an den frustrierenden Ergebnissen der Umweltkonferenzen. Die Wahrer des Besitzes fahren, solange sie leben, noch immer gut. Was nach ihnen sein wird kümmert sie wenig. Aber es ist unter den Jüngeren unbezweifelt, dass nicht so weiter gefahren werden kann wie bisher; dass die Waffenarsenale nicht weiter vergrößert, dass die Umweltverschmutzung nicht weiter befördert und die Klimaerwärmung an ein Ende gebracht werden muss, wenn die Welt vor einer Katastrophe bewahrt werden soll. Darum ist zu hoffen, dass die Jüngeren bald selbstbewusst genug sein werden, um ein besseres Ziel anzusteuern. Sie nämlich sind es, die bald schon werden büßen müssen für das, was ihre Eltern der Welt heute antun. War es früher wohl geachteter Brauch, den Rat der Alten zu erbitten, so ist es in diesen sich überstürzenden Zeiten angebracht, dass an jeder Biegung des Weges neu Ausschau gehalten und vermessen wird. Die alten Wegweiser müssen neu beschriftet oder ganz abgebrochen werden. Zeit ist es, die Gesetze des Handelns zu überdenken. Alles was die, die bis hierhergeführt haben, noch tun können, ist aufzeigen, was bisher gesagt und getan wurde und einzugestehen, wohin es geführt hat. Die Nachkommenden aber haben zu prüfen was weiter geschehen soll.
Es ist dem Menschen seit einigen Jahrzehnten nun schon gelungen, sich so weit über die Erde zu erheben, dass er sie mit einem einzigen Blick zu umfassen vermag. Es ist ihm gelungen, sie bis in ihre verborgenen Winkel zu besiedeln und diese wie Krebsgeschwüre wachsenden Siedlungen mit einem Netz von Nachrichten und Handelsbeziehungen zu verbinden. Vervielfacht, vertausendfacht haben sich die Menschen in ihren Städten. Die Fernsten sind Nachbarn geworden. Antipoden besuchen einander und reisen weiter oder zurück, zum Vergnügen oder in Geschäften. Handelsrecht, Seerecht und Völkerrecht, Verkehrsregeln und Höflichkeitsformen haben sich bei solchem Austausch von Besuchen, Nachrichten und Waren längst im Einvernehmen neu etabliert. Handlungen erscheinen uns heute als selbstverständlich, die man sich vor wenigen Generationen noch nicht einmal vorzustellen vermochte.
Was wir aus eigenem Interesse suchen oder meiden sollen, das meinen wir wohl zu wissen, das hat man uns gelehrt, vielleicht auch haben wir’s geprüft und erfahren, nicht aber hat man uns überliefert oder wissen wir gar aus eigenem Denken, was im Interesse aller auf dieser Erde Lebenden zu tun oder zu lassen sei. Die Welt ist darüber uneins geworden. Das gemeinsame Gut unersetzlicher Bodenschätze wird für nichtigen Luxus von wenigen verschleudert. Das Wasser der Meere, aus dem alles Leben kommt, wird als Abfallgrube missbraucht. Tiere, die manchen Gemeinschaften als heilig gelten, werden in anderen wie leblose Ware gehandelt. Verloren gegangen ist darüber das Bewusstsein, dass einer, der sich die Gabe des Denkens, Sprechens und Schreibens errungen hat, Verantwortung trägt, weit und immer weiter über sich hinaus.
Jene, die über die ethische Frage untereinander diskutiert und oft auch gestritten haben, schieden sich in den uns überblickbaren Zeiten in mehrere Denkschulen. Die einen wollten das Gute und das Böse auf unwandelbare Naturgesetze zurückführen, die von der menschlichen Vernunft erkennbar seien und von denen das menschliche Gewissen sichere Nachricht habe. Die anderen hielten dagegen, dass jedes der getrennt lebenden Völker sich einen eigenen Götterhimmel geschaffen habe und man einem Hindu keine vom Christentum und einem Juden keine vom Buddhismus, ja, nicht einmal einem Athener keine von Sparta vertretenen Werte aufzwingen dürfe. Die dritten meinten, dass es weder einen göttlichen Auftrag noch ein frei schwebendes Gewissen geben könne, dass vielmehr unser Denken und Handeln geprägt sei von Herkunft, Nachbarschaft, Freundschaft, Erziehung und Schule, und dass auf solche Weise unsere moralischen Überzeugungen durch unsere Gemeinschaftszugehörigkeit geprägt seien. Und dass ein jeder, der die Waffe zur Hand nehme, um sein Land, seine Familie, sein Hab und Gut zu verteidigen, im Grunde vor allem seine überkommenen, seine ihm auferlegten Werte zu bewahren suche. Die vierten wiederum forderten, man müsse eine Ethik, die alle leiten solle, in einem Zeitalter, das fähig und vielleicht auch bereit sei, der bewohnbaren Welt den Untergang zu bereiten, neu erdenken und diese aus der Verfügung der Religionen, der Sitten und Traditionen lösen, um sie dem Einzelnen zuzuweisen. Im Einzelnen leiden wir alle. Auch kann nur der Einzelne für die gute Tat gelobt und für die böse Tat getadelt werden. Schuld und Ehre sind nicht übertragbar, wenngleich es mehreren Einzelnen immer wieder gelingt, sich zu einem gemeinsamen Ziel zu verschwören. Den Schwur aber muss jeder für sich leisten und haftbar bleibt ein jeder für sich. Jeder Einzelne gibt sein Teil am Bau und Erhalt unserer Welt.
Die meisten unter uns haben sich über den Satz der deutschen Verfassung verständigt, dass die Würde des Menschen unantastbar sei. Auf welchem Grund baut diese Überzeugung? Die einen vermuten, die Würde des Menschen sei ihm in die Wiege gelegt, die anderen sagen, der Mensch sei nach dem Gleichnis seiner Götter geschaffen und eben darauf gründe sich, was er Würde nenne; und wieder andere meinen, so etwas wie die Überzeugung von eigener Würde habe es nicht zu allen Zeiten gegeben, die habe der Mensch erworben durch seinen Beitrag zur Gemeinschaft, will heißen: durch seine nützliche Arbeit an der Gestaltung der Welt. Andere wiederum behaupten, er habe seine Würde sich selbst verliehen und durch allmählich wachsende Selbstbehauptung erworben, sie gründe sich auf seine Vernunft und seine Fähigkeit, sich selbst und die Welt zu erkennen, zu prüfen und zu verändern. Was aber Würde eigentlich sei bleibt unbefragt. Ist sie eine Selbstermächtigung, die den Menschen über alles andere Leben erhebt und aller Verantwortung diesem gegenüber entledigt? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten in einer Epoche, in der Tausende, deren Würde unantastbar sein sollte, erschlagen, hingerichtet, vertrieben oder dem Hungertod überlassen werden. Wüsste man es, so wären alle Fragen nach Gut und Böse auf der Welt mit dem Hinweis abzutun, dass das Menschenwürdige gut und das Menschenunwürdige böse sei. Die Älteren unter uns haben erfahren, dass alle Würde wie Ballast über Bord geworfen wurde, als es darum ging, das bloße Leben zu retten. Um das eine wie das andere aber aus dem Ungewissen zu heben und näher zu betrachten, müssen wir einen Schritt zurücktreten von solchen unvermittelt zupackenden Fragen und damit beginnen zu untersuchen, was bisher getan und gedacht wurde, um uns danach auf den Weg zu einer von uns selbst neu zu begründenden Antwort zu machen.
Aus dem von den Stoikern erstmals behaupteten Naturrecht und dem von Thomas von Aquin neben den göttlichen formulierten menschlichen Rechten lassen sich, wenn man ihnen folgen will, die Grundrechte auf Leben, auf Fortpflanzung, auf Gemeinschaft und auf Erkenntnissuche ableiten. Solange unsere animalischen Wurzeln noch unser Dasein selbst in den avanciertesten Gesellschaften bestimmen, hat man aus all diesen folgernd ein weiteres Recht, das Recht auf Besitz und Eigentum in Anspruch genommen. Denn dieses sichere uns, wie wir dachten, das ungestörte Verfolgen all der anderen Rechte. Es sichere uns Herberge, Nahrung und Schutz vor Hitze und Kälte, Raum für die Aufzucht von Kindern. Und dieses Recht wird auch für die Nachkommenschaft dringend eingefordert. Die sogenannten liberalen Gesellschaften haben dem ihr besonderes Gewicht gegeben. Und doch wird der Tag kommen, an dem auch hierüber eine neue Verständigung vereinbart werden muss. Denn letztlich werden hier nur Bedürfnisse zu Rechten erklärt. Das Gedränge aber wird größer auf unserer Erde. In wenigen Jahrzehnten schon wird die Bevölkerung von Afrika sich vervierfachen, die Weltbevölkerung sich verdoppeln. Und die Ressourcen schwinden. Wenn wir uns nicht neu zu teilen entschließen, werden mörderische Kämpfe zu erwarten sein. Auf Dauer wird das Eigentum nicht sakrosankt bleiben können. Es wird sich jeder mit dem bescheiden müssen, was ihm zum Leben unverzichtbar notwendig ist und wird das abgeben müssen, was nur mehr dazu dienen kann, Macht zu üben über andere Menschen.
So wie der durch keine Theorien zu leugnende Schmerz der Garant für die Erhaltung des eigenen Lebens ist, so ist die Liebe der Garant für das Überleben der Spezies. Zumal die Elternliebe in allen Bereichen animalischen Lebens auch dem nüchternsten Geist wie ein immer wiederkehrendes Wunder erscheint, das nicht weiter hinterfragt wird. Ohne sie wäre alles Leben auf Erden längst ausgestorben. Dennoch hat, bedingt durch die Fortschritte der modernen Medizin und Hygiene, die Fortpflanzung und Erhaltung menschlichen Lebens seit einigen Dezennien ein solches Übermaß angenommen, dass der Bestand der Erde allein durch ihre Übervölkerung bedroht erscheint.
Selbstbehauptung, Nahrungssuche und Reviersicherung scheinen ebenso wie Fortpflanzung und Aufzucht des Nachwuchses existenzielle Bedürfnisse aller Lebewesen zu sein. Grenzen sind aber dort zu ziehen, wo sich die Sorge um den eigenen Lebensunterhalt und den der Nachkommen zum Schaden anderer auswächst oder wo sich Eigentumserwerb auf andere Menschen erstrecken möchte oder sich in einem Maße vervielfältigt, dass der Lebensraum anderer Wesen bedroht wird. Denn auch Tiere und Pflanzen haben ihr autochtones Geburtsrecht und sind mit allen Fähigkeiten ausgestattet sich zu erhalten und zu vermehren. In der Geschichte haben verschiedene Gesellschaftssysteme immer wieder fördernd oder begrenzend in die Naturrechte des Menschen eingegriffen, sei es durch Unterdrückung, sei es durch Enteignung, sei es durch Entmündigung oder durch Schlimmeres. In manchen Epochen haben die Verwaltungen von Staaten die Rechte der Eltern verkürzt und die Erziehung der nächsten Generation an sich gezogen. Sie haben auf solche Weise die familiären Bindungen zu lösen versucht, um die Menschen ihren Zielen dienstbar zu machen, als Arbeitskräfte, als Dienstleister oder als Kämpfer. Auch wurden Eigentumsrechte auf Grundbesitz oder Produktionsmittel beschnitten oder gänzlich aufgehoben, um sie der Gemeinschaft zu übertragen. Da jedoch diese Gemeinschaften stets die Durchführung ihrer Maßnahmen wiederum an Einzelne delegieren mussten, sei es durch Wahl, durch Willkür oder durch Auftrag, so entstanden oligarchische Machtstrukturen, die die Freiheit der Einzelnen in den Gemeinschaften selbst wiederum bedrohten.
Diese Infragestellung der ursprünglichsten Naturrechte geschah auch in unserem Zeitalter, das wie keines jemals zuvor in ständiger politischer Verwandlung lebt. Nach dem Niedergang des Kommunismus werden viele Staaten vom wirtschaftlichen und, diesem nachfolgend, vom politischen System des Kapitalismus beherrscht. Kapitalismus, der die wesenlose Abstraktion des Besitz- und Verfügungsgedankens in der Geldwirtschaft über materielle Güter in den Mittelpunkt stellt, und der – begrifflich – als Brandmarkung erdacht worden war, scheint den Machthabern unserer Gesellschaft nun aller Ehren wert geworden zu sein. Doch unversehens hat sich einst fest gegründetes Eigentum in flüchtiges Kapital verwandelt, hat sich als reiner Buchungswert von den handgreiflichen Münzen und Banknoten abgelöst und ist in den Augen vieler in den Rang einer Idee aufgestiegen, ganz so, als sei es ein Wert außerhalb irdischer Belange und durch nichts in Zweifel zu ziehen. Als sei es einem jeden erreichbar, wenn er nur andere Ziele beiseite setze, und als könne dieser Wert des Geldes ihn belohnen und rechtfertigen durch die Gaben wirklichen Lebensgenusses. Wir aber haben nach den jüngsten Malversationen exponierter Kapitalisten eine erste Ahnung verspürt, dass einem solchen längst außer jede moralische Bindung geratenen Wert ein Makel der Verderblichkeit unausrottbar anhaften muss. Es mehren sich Stimmen, die nach neuen Werten rufen, nach solchen, die sich nicht in Zahlen angeben lassen. Die Restitution einer überregionalen, Welt umgreifenden, alles Handeln anleitenden Überzeugung rufen sie nun herbei. Was dem Wohl und was dem Weh der Menschen diene, wollen sie wieder erkennen und nicht nur was den Interessen derer nutzbringend ist, die für die kurze Dauer eines Lebens dem Fetisch des Geldes anhängen. Was hilfreich ist, wollen sie wissen, hilfreich den Menschen, einem jeden Einzelnen und allen in Gemeinschaft und deren Hoffnungen auf ein Überleben ihrer selbst und des Planeten, den sie gemeinsam mit allen anderen Lebewesen dankbar bewohnen. Und in der Tat, wenn wir bei aller neuen Verantwortung die immer wieder mühsam erkämpfte Freiheit des menschlichen Geistes bewahren wollen, ist es Zeit geworden für eine solche Besinnung.
Auch wenn das ratlose Taumeln der westlichen Gesellschaften den Anlass gegeben hat zu neuem Nachdenken über die Möglichkeiten eines Zusammenlebens der Menschen, so muss doch von allem Anfang an gesagt sein, dass hier eine Untersuchung mit dem Ziel einer Prüfung überlieferter und einer Erwägung neuer Werte, nicht aber im Hinblick auf politische Systeme geschehen soll. Diese haben sich, wie ihre Vorgänger, verdächtig gemacht und sind für Zwecke missbraucht worden, die mehr, wie Max Weber es nannte, dem Machterwerb, der Machtausübung und dem Machterhalt dienten als dem Wohl der Menschen. Die Ordnungsmächte haben Rechte der belebten Natur allzu lange aus dem Blickfeld verloren. Dem Interesse aber allen Lebens und endlich auch des alles Leben nährenden Erdballs muss eine neue Bemühung um ethische Ordnungen dienen und nicht den Aspirationen einer politischen Ideologie oder den vorgeprägten Zielen einer religiösen Überzeugung. Dies kann allein von Menschen geschehen, von einzelnen Menschen, die ohne Ansehen von Parteien nach eigenem Wissen und Gewissen prüfen und entscheiden.
Noch steht es schlecht um unsere Achtung anderen Lebens. Denn nur wo das Wohlergehen der Spezies Mensch gesichert scheint, kann auch Rücksicht genommen werden auf das, was da sonst noch kreucht und fleucht auf der geduldigen Erde Rücken. Und letztlich gilt dem Lebenden selbst das Leben in seinen vieltausend Gestalten mehr als alle unbelebte Natur und alle himmlische Sternenpracht. Dies jedenfalls solange als er nicht auch in diesen die Spuren vergangenen oder die Nahrung zukünftigen Lebens entdeckt. Da alles Leben sich wandelt und nicht immer so sein wird, wie es einst war, ist wohl auch keine Antwort zu erhoffen, die für alle Zeiten und unter allen wechselnden Bedingungen die rechte wäre. In Zeiten, als in jedem Fluss ein Gott wohnte und in jedem Baum eine Nymphe, in denen die Sterne einzugreifen schienen in die Geschicke der Menschen, hat man unsicher seine Schritte auf den Boden der Tatsachen gesetzt. Heute aber, da wir glauben, alles messen und wiegen zu können, wäre es an der Zeit, nicht nur in makroskopischen, sondern auch in mikroskopischen Bereichen zu erkennen, dass sich vieles unserem Zugriff entzieht. Und mancher wird nach und nach zu verstehen lernen, dass der alte Weise nicht ganz im Unrecht war, als er in der Sprache seiner Epoche sagte: alles sei voll von Dämonen. Wir haben diese Dämonen zu erkennen gelernt als die aller Materie im subatomaren Bereich innewohnenden Kräfte und Energien, die die Macht haben, auf unmessbare Weise zu gestalten und zu zerstören.
Man hat dem Menschen Bedürfnisse zugeschrieben, deren Erfüllung seine Autonomie begründen und ihm ermöglichen könnten ein selbstbestimmtes Dasein zu führen. Es sind dies: Leben, Nahrung, Geborgenheit, Fortpflanzung, Freiheit, Besitz, Anerkennung, Liebe, Teilhabe und Erkenntnis. Diese Bedürfnisse erscheinen in jedem Individuum unterschiedlich ausgebildet. Und manch einer hat geglaubt, auf das eine oder andere weitgehend oder sogar ganz verzichten zu können. Er hat sich Beschränkungen auferlegt, sich in Klöster und Einsiedeleien oder nur eben in seine vier Wände zurückgezogen. Er hat sich äußere Freiheiten genommen, um sich innerlich zu befreien. Er hat die Güter dieser Welt zurückgewiesen, als da sind Besitz, Anerkennung, Teilhabe, Nahrung und Geborgenheit, um sich der Liebe oder der Erkenntnis zu widmen. Auch wurde und wird andererseits noch immer dem einen oder anderen der Entzug eines seiner Bedürfnisse aufgezwungen, sei es durch Gefangennahme, Verbannung, Beschlagnahmung von Besitz, Teilhabebeschränkung oder durch Liebesentzug und Verweigerung von Anerkennung. Aller Lohn und alle Strafe werden dem Menschen von Seinesgleichen durch Gewährung oder Verweigerung dieser Güter zugemessen. Und so erscheinen als der höchste Lohn die Liebe und die Anerkennung und als die schwerste Strafe der Tod oder die Ausstoßung aus der menschlichen Gemeinschaft.
Neun dieser Grundbedürfnisse erfüllen die Bedingungen des Lebens in der menschlichen Gemeinschaft. Das zehnte aber weist darüber hinaus. Dem Menschen, der seine eigene Vergänglichkeit vor Augen hat, ist ein nicht zu stillendes Verlangen eingeschrieben nach der Erkenntnis eines unwandelbar Gesicherten, eines über jeden Zweifel Erhabenen. Und darum findet er an dem Gefundenen schon bald kein Genügen mehr. Wenn Baruch de Spinoza ein Gebäude der Erkenntnis aus logischen Schlüssen auf Axiomen errichtet, die von der Allmacht einer alles Sein umfassenden und in allem wirkenden überpersönlichen Gottheit ausgehen, so hält Bertrand Russel dagegen, eine solche Sehnsucht nach dem Absoluten sei zu verstehen aus der Furcht des Menschen vor dem Vergehen im Tod; sie sei zu verstehen aus seiner Unfähigkeit, abzusehen von sich selbst als dem Subjekt allen Erkennens, und aus der Unfähigkeit, sich die Welt, das Objekt solchen Erkennens, losgelöst vom Betrachter auch nur vorzustellen. Um eben diese Sehnsucht zu stillen, haben alle Religionen etwas Unwandelbares hinter aller Wandlung der Dinge versprochen, sei es das ewige Leben, das letzte Gericht, die Wiedergeburt, die ewige Wiederkehr oder den Kreislauf der Erscheinungen. Selbst das Nirwana des Buddhismus wäre nicht vorstellbar ohne die ewig unveränderbare Gültigkeit eines jenseits alles Irdischen waltenden und alles Sein durchdringenden Reiches des Nichts.
Da nun aber der Verlust eines übergreifenden Wertesystems die Epoche, in der wir leben, ins Taumeln gebracht hat, sucht man allenthalben nach Haltegriffen. Verschwörungsgruppierungen sprießen überall aus dem Boden, Internationale Gerichtshöfe werden beauftragt, Menschenrechte werden verkündet, Ethikkommissionen werden gebildet, Ratgeber bieten ihre Dienste, in Büchern, in Zeitungen, im Internet. Dies alles aber ist nicht von Dauer, wenn es nicht gelingen wird, der menschlichen Gesellschaft einen neuen Halt zu geben, der sie für einen gemessenen Zeitraum aufrecht hält. Ein jedes Zeitalter steht vor der erneuten Aufgabe, zu bestimmen, ob es den alten Spuren folgen oder sich einen neuen Weg bahnen soll. Es wird jedoch keiner, dies muss allem weiteren Suchen vorausgeschickt werden, eine Antwort finden auf die Frage, wohin soll ich mich wenden, eine Antwort, die für alle Zeiten und alle Länder Gültigkeit haben könnte. Ein letztgültiges Urteil wäre auch nicht zu wünschen. Wenn wir ein Ziel suchen, nach dem sich alles richtet, so müssen wir bedenken, dass wir Suchenden auf schwankendem Boden stehen und nur in seltenen Stunden durch trübe Nebel freien Blick erlangen. Diese Nebel sind nicht immer materieller Art. So wie uns heute das Licht von Milliarden von Glühbirnen und Scheinwerfern den Himmel trübt und uns den freien Blick in das Weltall verwehrt, so vernebeln uns die vielen Tausenden von Dogmen und Thesen, von Verkündigungen und Theorien den Blick in das Reich des reinen Geistes. Eine Ahnung immerhin scheint uns zu beseelen, dass wir nicht vergeblich suchen, auch wenn wir niemals finden werden. Vielleicht liegt auch hier der Lohn in der Mühe und ist der Weg das Ziel.
Das Mühen um die Beantwortung der großen Fragen nach dem Woher und Wohin erhebt die Gemeinschaft der Menschen, so sagt Hermann Broch, über die Ordnung eines Termitenstaates. Kein Mensch ist verpflichtet zu handeln wie andere vor ihm gehandelt haben, kein Mensch ist genetisch zum Arbeiter, zum Krieger oder zur Königin geboren. Ein jeder kann sich aufrichten, kann bestimmen oder gehorchen, sammeln oder vergeuden. Ein jeder muss allein vor sich selbst bestehen, nicht vor dem Urteil der Zeitgenossen, nicht vor dem Urteil der Geschichte. Und wenn es wider alle Vernunft etwas geben sollte wie ein Jüngstes Gericht, so wird ein jeder dort als Richter sitzen über sich selbst und wird sich bewahren oder verwerfen müssen, wie sein eigenes Gewissen es befiehlt.
Die Aufgabe der Ethik ist es, aus dem Blick des Menschen das Gute vom Bösen zu scheiden. Denn Gut und Böse sind Menschensachen. Der Mensch allein gestaltet sich seine Welt und kann was er geschaffen hat auch zerstören. Dies ist keinem Tier gegeben. Selbst die größten unter ihnen, Mammuts und Dinosaurier, konnten in Millionen von Jahren ihre Welt nicht verändern. Und doch legen Tiere Verhaltensweisen an den Tag, die man beim Menschen mit moralischem Bedenken beobachten würde. Man braucht nur mit anzusehen, welch grausames Spiel Katzen mit gefangenen Mäusen treiben. Auch weiß man von Haifischen, die erbeutete Robben viele Male hoch aus dem Wasser schleudern, ehe sie sie verschlingen, oder dass Löwen ein geschlagenes Wild auszuweiden beginnen, ohne es sofort zu töten. Und selbst unter den Pflanzen gibt es etwa den hübsch anzusehenden fleischfressenden Sonnentau, der ein gefangenes Insekt lange leiden lässt, ehe er sich über es einrollt und es verschlingt. Die Beispiele ließen sich fortsetzen, aber auch durch erstaunliche Rettungstaten von Delphinen oder Hunden auf der uns positiv scheinenden Seite ergänzen. Wir haben uns sowohl Tiere wie auch Pflanzen gefügig gemacht. Wir belohnen oder strafen sie nach unseren Gesetzen, wenn sie sich unserem Willen fügen oder ihm widerstreben. Dennoch ahnen wir, dass es auch unter ihnen so etwas wie Einverständnisse gibt, um in Gemeinschaft zu leben. Und wir wissen zumindest, dass wir noch viel zu wenig von den Sprachen und Gedanken der Tiere verstehen. Immerhin haben wir schon erkannt, dass Hunde treu, dass Elefanten nachtragend sind, dass Bären zu trauern vermögen, dass Raben Werkzeuge benutzen und dass Ziegen zählen können. Ein Harvard-Professor hat die These vertreten, dass sich bei Primaten moralische Normen finden lassen, die denen der Menschen nicht unähnlich sind. Vom Gemeinschaftsleben der Bienen weiß man schon vieles. Man hat aber in jüngster Zeit sogar soziale Verhaltensweisen bei Bakterien zu entdecken gemeint. Nach solchen Beobachtungen stellt sich die Frage, ob wir den Tieren auch in Gefühlsdingen nicht näher verwandt sind als wir wahrhaben wollen. Seit unvordenklichen Zeiten, nicht erst seit den Fabeldichtern, haben wir den Tieren unsere Sprache ins Maul oder in den Schnabel gelegt, haben den Wolf, den Hai, den Raben und sogar den Floh in Wesen unseresgleichen verwandelt, um sie dann nach unseren Sitten und Gebräuchen zu belobigen oder zu verurteilen. Wir haben Krokodile zu Göttern und Schlangen zu Dämonen erhoben. Manche freundliche Eigenschaften wurden Pferden, Delphinen oder Hunden nachgerühmt. Aber hat auch der grimmigste Jäger ihnen je so etwas wie Hass oder Zerstörungswut nachgesagt? In manchem noch wird uns die Wissenschaft über das Leben der Kreaturen belehren. In einem nicht: warum Gut und Böse durch den Menschen in die Welt kamen. Da neuere Forschungen immer mehr Vergleichbares zwischen Tieren und Menschen entdeckt haben, musste es dahin kommen, dass eine eigene Tierschutzethik gefordert wurde. Diese bedeutsamen Überlegungen weisen zurück auf die Verantwortung des Menschen für alles Leben und endlich auch für das der Pflanzen.
In dem gesteckten Rahmen, der kaum eine Ahnung von allem Wohl und Wehe auf Erden umfassen kann, soll, da wir nichts Besseres wissen, hier allein vom Menschen die Rede sein. Er allein kann sich durch seine Sprache belehren. Er allein weiß lange im Voraus, dass er sterben muss. Er allein ist fähig, in Gedanken und Taten nicht nur sich und seinesgleichen, sondern alles Lebendige zu zerstören. Er hat sich aufgeworfen, die Erde in Besitztümer und Erbgüter aufzuteilen. Er greift nach Macht und Herrschaft über sich selbst hinaus. Zuweilen scheint es als wolle er eher die Erde in den Untergang reißen als von seinen Begierden zu lassen. Vor ihm, dem Menschen, gilt es, uns und unsere Erde zu schützen. Der Mensch ist die Gefahr. Da er nicht gebunden werden soll, muss er gezähmt und belehrt werden. Darum muss gefragt werden: Wie soll der Mensch leben? Was soll er suchen, was soll er meiden? In Zeiten, da die technischen Mittel ins Unüberschaubare wachsen, ist es hoch an der Zeit sie zu stellen. Denn eines Tages wird es, wenn wir dem Übel nicht in den Arm fallen, zu spät sein für uns und unsere Erde.
Auch wenn es heute weltfremd und absurd erscheint, nach einem Jahrhundert der Völkermorde, der Klassenkämpfe und des Rassenwahns, des Kolonialismus, des Holocausts, des Terrorismus und der Diktaturen, der Fluchten und der Vertreibungen; einer Epoche, die mehr Menschen gewaltsam zu Tode gebracht hat als alle vorhergehenden, in der jeden Tag Tausende von Kindern an Hunger und Entkräftung sterben, in einer also alle menschlichen Werte höhnenden Epoche, die Frage aufzuwerfen, was man zu tun habe, um angesichts all dessen ein rechtschaffenes Leben zu führen, so soll es doch unternommen werden. Das Wort rechtschaffen klingt sehr bescheiden, und was es meint, sollte nach altem Brauch eigentlich tugendhaft heißen. Das Wort Tugend jedoch, das in der Antike als areté oder virtus noch einen Vertrauen erweckenden Klang hatte, ist uns odios geworden, da es einer Haltung entspringt, die meint, im privaten Leben das Rechte tun zu können, ohne Ansehen dessen, was immer auch rundum in der weiten Welt geschieht. Wer rechtschaffen sein will hat Rechenschaft zu geben für sich selbst und seinesgleichen, Rechenschaft auch für unser Land, und unsere Erde. Heute, da wir erkennen müssen, dass wir mit unserem nur auf den Menschen als sogenanntem Herrn der Schöpfung beschränkten Blick der Erde selbst die schrecklichsten Verletzungen zufügen, müssen wir alles andere Leben, den Boden selbst, der es nährt, und die Luft, die es schützend umhüllt, in unsere Verantwortung einbeziehen. Wenn darum die alte Frage unter neuen Auspizien wieder erhoben wird, so nicht in der Hoffnung, dem allgemeinen Gemetzel aus einem Schutzbereich des guten Betragens heraus durch wohlgemeinte Ratschläge wehren zu können. Der Versuch wird unternommen, um Ordnung zu schaffen im eigenen Hirn, er wird aber auch unternommen, um auszuloten, ob die Welt durch ein voraustastendes Denken und ein dem Denken nachfolgendes Handeln auf einen Weg geführt werden kann, der breit genug ist für alle, die guten Willens sind.
Da ich weitab bin von der Absicht, eine Geschichte der Ethik zu schreiben, wird man es mir nachsehen, wenn ich nur eben einen kursorischen Überblick über das weite Feld des Vorausbedachten gebe und mich im Übrigen damit begnüge, mir selbst und allen, die diesen Ausführungen folgen wollen, zu größerer Klarheit des Blickes auf die Folgen unseres Handelns zu helfen. Die Aufgabe, vor der wir stehen, weist in eine Zukunft, die unseren Nachkommen auch weiterhin aufgehen soll. Die Erwartung der Zukunft hat die Macht, alle Prämisse des Vergangenen umzudeuten. Die Hoffnungen fühlender Menschen richten sich auf jeweils sehr divergierende Ziele. Eine verbindliche Ethik jedoch müsste den Versuch unternehmen, ein gemeinsames Ziel zu benennen, das allen Hoffnungen dient. Dies wird sich wohl nur in dem alles vereinenden Wunsch nach Überdauern des irdischen Lebens finden lassen. Ob der Mensch darin eingeschlossen bleibt, ist nicht so gewiss wie er hoffen mag. Alle anderen Werte sind irgendwann oder irgendwo immer wieder in Zweifel gezogen worden. Was in manchen vergangenen Zeiten am einen Ort als kaum der Rede wert, am anderen als zwingendes Gebot erschienen ist, das ist heute in einer aus vielen Kulturen zusammengewachsenen oder -gezwungenen Welt zu einem wirren Bündel unterschiedlicher Vorstellungen, Hoffnungen und Forderungen geworden. Werte haben nicht, wie Nikolai Hartmann meint, „ein ideales Ansichsein“. Ein Wert ist immer auf ein anderes gerichtet. Und er kann nicht bestehen ohne den, der sich zu ihm bekennt. Auch die aufgeklärten Verfassungen, die Appelle des Naturrechts oder die Deklaration der Allgemeinen Menschenrechte haben es nur vermocht, für eine Handvoll Staaten Achtung und Gültigkeit zu erlangen. Und doch sind sie alle begründet in den Versuchen, einem jeden Menschen beizustehen und ihm Wege aufzuzeigen, wie er sich in den Wirrnissen der menschlichen Gesellschaften zurecht finden und dabei seine Würde und Selbstachtung bewahren kann, ohne anderen zu schaden.
Dass ich mich trotz des universellen Anspruchs im Folgenden mit Beispielen und Argumenten auf den europäischen Bereich und hierin sogar mit wenigen Ausnahmen auf den meines sprachlichen Umfelds beschränke, um mich nicht im Ungefähren zu verlieren, wird man nach dem voraus Bemerkten mit Erleichterung lesen. Die diesem Vorwort nachfolgenden Kapitel sollen nicht als eine kritische Auseinandersetzung mit den Moralphilosophen vergangener Jahrhunderte aufgefasst werden. Es versteht sich von selbst, dass ich mich hier auf das Wissen der europäischen Traditionen stütze, soweit ich es aufzunehmen und weiterzudenken in der Lage war, auch wenn mich außerhalb dessen die Lehren des Konfuzius, des Lao tse und des Buddha tief beeindruckt haben. Sie sind allein auf das praktische Handeln der Menschen gerichtet und sprechen nicht in Theorien, sondern in Beispielen. Dies hat ihnen allgemeine Verständlichkeit und lang währende Anerkennung gesichert. Das Bemühen des abendländischen Geistes hingegen richtet sich auf Gesetzmäßigkeiten des reinen Denkens, der Religion oder der Metaphysik. In den angeführten Zitaten habe ich mich mit wenigen Ausnahmen an die klassischen Autoren gehalten, in der Annahme, dass diese dem gutwilligen Leser leichter nachzuprüfen sind als etwa die der neueren deutschen, französischen oder angelsächsischen Philosophie, vor allem aber auch, weil sie noch eine Sprache sprechen, die mehr um Mitteilung als um Selbstdarstellung bemüht ist. Meine Absicht ist jedoch, aus neuer Sorge zu fragen nach dem, woran uns heute und auch noch in absehbarer Zukunft gelegen sein muss. Eine hypothetische Antwort im Voraus zu entwerfen und dann zu versuchen, sie zu begründen, wie dies ein oft begangener und dienlicher Weg wissenschaftlicher Forschungen ist, liegt nicht in meiner Absicht, denn ich hoffe Einsicht mehr und mehr in weitem Felde suchend zu erlangen. Es zeigen sich die überraschendsten Erkenntnisse oft unterwegs, an den Wegrändern des Denkens. Ein großer Rest von Zweifeln wird bleiben. Das sehe ich voraus. Manches, was man nicht brauchen konnte, jätete man als Unkraut aus Feldern und Gärten. Steine sprengte man aus dem Weg, Wasser lenkte man auf Mühlen, auf Turbinen oder in Stauseen. Verantwortung trug man nur für sich selbst. Seit man jedoch erkannt hat, dass sich selbst bedroht, wer seine Umwelt zerstört, hat sich das Verständnis menschlicher Ethik bedeutsam erweitert.
Wenn wir nach dem Ethos der Handlungen fragen, zu dem wir uns selbst verpflichten, müssen wir darüber hinaus auch nach dem höheren Ziel der täglichen Verrichtungen unseres Daseins fragen. Wenn der Sinn des menschlichen Daseins in nichts weiter bestehen sollte als das organische Leben auf dem Planeten Erde zu erhalten, so wären die Forderungen an unser Handeln allein zu beschränken auf den Gewinn von Nahrung, die Abwehr von Bedrohungen durch Fressfeinde und Krankheiten und die Zeugung neuen Lebens. Damit allein aber würde sich der Mensch nicht über andere Lebewesen erheben und konnte sich auch, seit er zu denken gelernt hat, nicht zufriedengeben. Eine wahre Ethik muss hinaus gelangen über eine Begründung ihrer Nützlichkeit für den Menschen. Sie muss den Sinn und das Ziel allen Handelns über die bloße Erhaltung und Fortpflanzung des organischen Lebens hoch in die Zukunft heben. Unzählige Menschen haben ihr Leben gegeben, um auf solche Ziele zu verweisen. Manche sind dabei auch in die Irre gelaufen. Durch ihre Worte und Taten aber wurden wir uns bewusst, dass wir nicht allein um unseres Überlebens willen für uns und gemeinsam mit anderen handeln. Das wahre Ethos ist um Antworten bemüht, nicht nur in den täglichen Verrichtungen unseres Lebens, sondern mehr noch und vor allem in den Stunden, in denen wir uns unserer Vergänglichkeit und unseres Todes bewusstwerden und in unseren Geschäften innehalten und zurückschauen oder in die Ferne hinaus, um zu überlegen: Was haben wir getan? Was sollen wir tun? Was sollen wir lassen? Was ist unser Ziel? Und warum und wem zu Liebe all diese Mühe? Aus dieser Bemühung um Erkenntnis und um Sorge um einander gewinnen wir, wie kein anderer es deutlicher gesagt hat als Cicero, unsere dignitas, unsere Würde. Die aber ist der innerste Kern eines wahrhaft humanen Daseins. Diese Würde des Individuums, die doch allen gemeinsam ist, diese Würde ist es, die uns alle gleich macht. Sie ist uns allzu lange aus den Augen geraten.
Was das Ziel des nachstehenden Versuchs angeht, so will ich nicht altbewährtes Wissen noch einmal bestätigen. Ich glaube nicht an Systeme, bin mir aber dessen bewusst, dass manches Althergebrachte sich noch lange als unerschütterlich erweisen wird, anderes jedoch als hinfällig oder veränderbar. Weder das Alte noch das Neue sind ethische Kategorien. Allzu ungeduldig hat der kritische Lichtenberg behauptet: „Der oft unüberlegten Hochachtung gegen alte Gesetze, alte Gebräuche und alte Religion hat man alles Übel in der Welt zu danken.“ Manch einer könnte mit Lichtenberg viele Beispiele beibringen, die seiner Behauptung Nahrung bieten. Aber dem klugen Mann kann man dennoch nur Zustimmung geben, wenn man die Verallgemeinerungen systematischen Denkens gelten lässt. Abgesehen davon, dass es auch noch andere Quellen des Unheils gegeben hat als das Althergebrachte, wie etwa die Hast und Unduldsamkeit vieler Weltverbesserer, so haben doch manche uralte, scheinbar absurde Bräuche Frieden und Einverständnis gestiftet unter den Menschen, die sich in der Wirrnis neu erschlossener Wege verlaufen hatten. Hoffe darum keiner, er könne in den nachfolgenden Zeilen Antworten finden, die er nach Hause tragen kann. Alles, was zu erwarten ist, ist ein Bündel von Untersuchungen zu einer Fragestellung, die nur auf den ersten Blick alltäglich ist und banal. Man traue nicht denen, die behaupten Bescheid zu wissen. Nicht der Glauben, sondern der Zweifel hat uns mehr und mehr Erkenntnis gebracht und uns den Boden gesichert, auf dem wir von Jahrhundert zu Jahrhundert mühsam fortschreitend Halt finden. Den Zögernden und Zweifelnden ziemt es dennoch, sich nicht freizusprechen von einer Schuld, die wir alle tragen an den offenbaren Übeln der Welt.
Um Ordnung in diese Papiere zu bringen, werde ich einige Worte zur Definition des Begriffes der Ethik vorausschicken, werde dann untersuchen, worauf sie sich mit ihren Forderungen gründet, werde einen kurzen und darum lückenhaften Überblick über die bisherigen Bemühungen um verbindliche Normen geben und werde anschließend eine erste Betrachtung der Begriffe des Bösen und des Guten anzustellen suchen. Dem Handeln des Menschen soll hierbei nachgefragt werden in Hinsicht auf die Quellen der Tradition, der Religion, des aufgeklärten Denkens und des Gewissens, die es bestimmen. Dem folgt ein kurzer Exkurs auf die geschwisterliche Disziplin der Ästhetik. Und da dem Netz eines systematischen Forschens vieles und zumal das Lebendigste oft entschlüpft, sollen einige Betrachtungen über die sogenannten Tugenden der Keuschheit, der Gerechtigkeit, der Tapferkeit, der Pflichterfüllung, der Wahrhaftigkeit und der Barmherzigkeit noch einen gedrängten Platz finden. Schließlich soll eine kurze Bemerkung über die Begriffe von Scham und Schande, sowie über den in unserem Kulturraum heute nur mehr auf anorganische Materialien angewandten Begriff des Edlen das Stückwerk meiner Bemühungen ergänzen und nach einer Schlussbetrachtung die Arbeit ihr Ende haben.