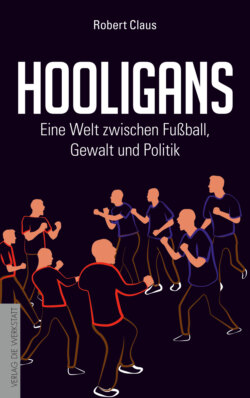Читать книгу Hooligans - Robert Claus - Страница 6
ОглавлениеVorwort
Von Gerd Dembowski
Manager für Vielfalt und Antidiskriminierung der FIFA
Der Ursprung des Fußballs europäischer Prägung ist die Gewalt. Er entsprang ihr nicht plötzlich, sondern schrittweise. Mittelalterlicher Massenfußball entstand als Reaktion auf zunehmende Selbstbeherrschung, auf sich entwickelnde Rollen und Charakterpanzer im sogenannten Zivilisationsprozess seit dem zehnten Jahrhundert. Der postmoderne Fußball wiederum, wie wir ihn heute kennen, ist domestizierte und institutionalisierte Gewalt, kontrollierte Emotion, ritualisierte Aggression – die „Überführung der Gewalt in eine Kunstform“, wie es Horst Bredekamp für den Florentiner Fußball bis 1739 treffend formuliert. Christoph Bausenwein beschreibt die Genese des Fußballspiels, den darauf begründeten Fußballsport mit seinem Appendix, den Zuschauerkulturen seit den historischen Vorformen des Fußballs, dem mittelalterlichen „Folk Football“ der britischen Inseln sowie dem auf öffentlichen Plätzen volksfestartig zelebrierten Florentiner Calcio, als ritualisiertes „Mittel der Konfliktbewältigung sesshaft gewordener Gemeinschaften“.
Im Vergleich zum mittelalterlichen Massenfußball ist die Gewalt im heutigen Fußball und in seinen Fankulturen jedoch ein Pappenstiel. Denn er war regellos, ohne Teilnehmerbegrenzung. Mit der Nacht als Halbzeit, versuchten die männlichen Bewohner des einen Stadtteils den unkaputtbaren Ball zum mitunter kilometerweit entfernten Tor des anderen Stadtteils zu bugsieren. Verbote und die parallele Entwicklung von verregelten Spielen zunächst in den besseren Gesellschaften bis hin zum heutigen Fußballsport haben die Teilnehmerzahl schrittweise verringert, die Möglichkeiten zum Ausdruck von Gewalt dezimiert. Der Zivilisationsprozess übertrug sich auf die Ballspiele, die eigentlich zu seiner Verarbeitung aufgekommen waren. Rannten, traten und schlugen die Massen früher selbst mit, wurden sie im Zuge der Entwicklung des Fußballs an den Spielfeldrand verdrängt. Doppelt entkoppelt, bildeten Menschen Zuschauerkulturen, die die versportete Gewalt auf dem Spielfeld und das Prinzip von „Wir“ gegen „die Anderen“ auf den Rängen symbolisch nachvollziehen, bis hin zu den nur noch seltenen Massengewaltphänomenen einerseits und den konstant kleinen gewaltförmigen Hooligangruppen und Teilen der Ultragruppen andererseits. Aus dem Spiel gedrängt, fand die Gewalt ihren Weg auf die Zuschauerränge oder die Zuschauertreffpunkte oder auf die Anreise zu den Spielen.
Im Laufe der Spezialisierung von Sicherheitsmaßnahmen wurde und wird Gewalt auch dort verstärkt eingedämmt. Zumindest so lange, bis Zuschauerkulturen kreativ darauf reagieren und immer wieder neu spezialisierte Nischen für gewaltförmiges Handeln entstehen. In diesen Nischen formiert sich Gewalt z. B. mittels durchdachterer Organisationsformen von kleinen oder Teilen von Zuschauergruppen, gewaltförmiger Rufe und Banneraufschriften, Social-Media-Einträgen und Videoclips, des Vertriebs von hooliganaffiner Kleidung, Fitnesstraining und zum Teil Mixed Martial Arts als Grundlage von kommerziell organisierten Hooligankämpfen.
Auch die schrittweise zugenommene Brutalisierung des Calcio Storico kann als eine spezialisierte Nische, ja sogar als offizialisierte Form der Gewaltausübung bezeichnet werden. Vier männliche Stadtteilteams mit je 27 Spielern zelebrieren diese Körperverletzung mit Ball alljährlich im Juni auf den Stadtplätzen von Florenz. Und das ungleich brutaler, als es ihre Wurzeln im 15. Jahrhundert zulassen. In einer regellosen Mischung aus Gladiatorenkampf, Massenfußball und auch Hooliganismus finden diverse historische Gewaltrepräsentationen im Calcio Storico perpetuiert wieder zueinander. Würde man die Interviews seiner Protagonisten in der 2010 erschienenen Dokumentation „Florence Fight Club“ aus dem Zusammenhang reißen, könnten sie auch ins Hooliganmilieu passen. Genauso wie die Spieler des Calcio Storico konstituieren gewalttätige Fans, Ultras und insbesondere Hooligans das, was sie gern auch mal als „alte Werte“ bezeichnen.
Diese kennzeichnen sich durch hegemonial männliche Ausformungen von trennscharfen Identitäten, ihrer Performanz, ihrer unmissverständlichen Manifestation, ihrer konstant wiederkehrenden Repräsentanz. Bestandteile davon sind die Selbstbestimmung in einem imaginierten Freiraum und stets flexible Aushandlungsprozesse zwischen Individuen und Kollektiven. Auffallend ist das Bedürfnis nach Gruppenidentitäten mit einem deutlichen „Wir“ hier und „die Anderen“ dort, nach sozialmächtigen wie personenfixierten Hackordnungen, nach Pejorisierung und Diskriminierung als Abgrenzungstechniken. Es geht um ein Patchwork aus Autoritarismus, „Destruktivität und Zynismus“ und „Projektivität“ (Theodor W. Adorno), territorialem – häufig weißem – Überlegenheitsdenken und Sozialdarwinismus, soldatischem Kämpferideal, Sozialchauvinismus, Antiintellektualismus, Überdrehung kapitalistisch geprägter Ellenbogenmentalität und einer entsprechenden, auf Selbstbeweisung angelegten Körperfokussierung. Die sich so konstituierenden „alten Werte“ beinhalten und zelebrieren symbolisch wie physisch immer die Akzeptanz von Gewalt. Doch genug mit diesem Begriffsgeschwader.
Robert Claus macht das anders. Er arbeitet eher erzählerisch, passagenweise tief aus dem Feld heraus. So zeigt sein Buch detailliert, wie solch hegemonial männlich überdüngtes Lebensgetue immer wieder und in neuen Formen die Straße hinuntergerollt kommt, den Weg freimachend für regressive Lebensweisen und Politiken mit archaischen, vormodernen, antidemokratischen Zügen mitsamt ihren Widersprüchen, Lernfähigkeiten und Winkelnischen. Um dies herauszuarbeiten, geht Claus nah ran und rein. Aus den so gesammelten Einblicken und Aussagen entstehen Abbildungen. Erst darauf basierend können Claus und auch die Lesenden dieses Buchs kühl analysieren und distanziert verstehen. Wenn mehr gewollt ist, als die Welt verschieden zu interpretieren, dann ist ein ständiges Neuverstehen doch so sehr die Grundlage für eine stets emanzipatorische Positionierung und Veränderung. Dieses Buch ist ein Angebot zu einem solchen Verständnis, nicht aber zur Akzeptanz von Gewalt.
Zürich, 10. Juli 2017
Gerd Dembowski