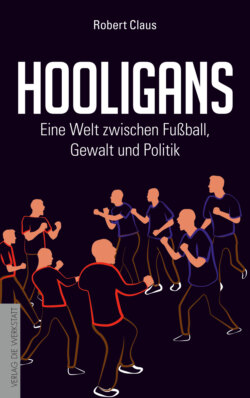Читать книгу Hooligans - Robert Claus - Страница 7
ОглавлениеVorwort
Von Julia Düvelsdorf
Leiterin der Fan- und Mitgliederbetreuung des SV Werder Bremen Bundessprecherin der Fanbeauftragten
Eine Begebenheit im Stadion werde ich niemals vergessen. Mir wurde einmal gesagt: „Julia, es ist mir doch egal, wer beim Fußball neben mir steht. Ob es ein Nazi ist oder nicht. Es geht doch um Werder. Die sollen mich doch wenigstens beim Fußball mit ihrer Politik in Ruhe lassen.“ Dieses entsetzte Gefühl nach diesen Sätzen begleitet meine Arbeit. Mein lautes „Nein, es ist eben nicht egal, wenn ein Nazi neben mir steht“, hat sich fest eingeprägt.
Nein, ich will keine menschenverachtende Denkweise, keine Diskriminierung in meiner Umgebung. Nein, auch nicht im Fußball. Diese Grundhaltung einfach als „linke Politik“, „anstrengend“, „zu kompliziert“ oder mit „Wir sind doch beim Fußball“ abzutun, öffnet das Tor für menschenfeindliche Gedanken in den Stadien. Als wäre der Fußball, als wäre ein Stadion ein rechtsfreier Raum. Ein Raum, in dem man Pause von der Gesellschaft draußen machen kann. In dem andere Regeln herrschen. In dem man endlich so sein kann, wie man will. Nein. Fußball ist Gesellschaft und Gesellschaft ist Fußball. Jeder Mensch, auch der Mensch, der sich im Kontext Fußball bewegt, ist ein Teil der Gesellschaft. Es gibt keinen Weg aus der Verantwortung, die jeder von uns für gutes Miteinander trägt. Das ist die Aufgabe, die man hat, wenn man in einer Demokratie lebt. Eine Aufgabe, aber auch eine ganz eigene Möglichkeit der Mitbestimmung. Jeder hat seinen Anteil an einem toleranten und offenen Zusammenleben in einer demokratischen und freien Gesellschaft. Es ist wichtig, diese Botschaft und Werte in den Fußball zu tragen. Sie als Selbstverständlichkeit in den Vereinen und in den Kurven zu verankern.
Da fragt man sich: Ist das noch nicht passiert? Würde nicht jeder Bundesligaverein unterschreiben, dass er sich für Demokratie und gegen jegliche Form von Diskriminierung engagiert? Als kleinste Form der demokratischen Struktur steht jeder e.V. – und damit die Ursprünge der Bundesligavereine – für diese Werte. Wie kommt es dann, dass sich viele antidemokratische Strömungen und Alltagsdiskriminierungen in den Stadien verbreitet haben? Wie konnte es passieren, dass dies unter den Augen der Vereine geschehen ist? Wurde nicht hingeschaut oder nicht weit genug gesehen? Vielleicht das Problem unterschätzt? Wurde Beteiligten nicht zugehört? Wurden die Vereine vielleicht aber auch damit alleine gelassen? Und sind aber diese Werte – auch wenn deren Benennung in manchen Kreisen als anstrengend empfunden wird – nicht auch ein Grundbedürfnis vieler Fans, die Woche für Woche in die Stadien strömen? Das Gefühl von Zugehörigkeit, Akzeptanz, Gemeinschaft und der gegenseitigen Rücksichtnahme, das Anerkennen eigener Stärken und das Streben nach eigenen Zielen, wie dem sozialen Engagement vieler Fans? Es ist offensichtlich, dass es in weiten Teilen der deutschen Fankultur eben auch ein politisches Bewusstsein gibt, was sich vor allem im lokalen gesellschaftlichen Engagement widerspiegelt.
Fragen über Fragen. Sich diesen als Verein zu stellen, erfordert eine kritische Selbstreflexion. Vor allem ein Bewusstsein dafür, dass man Verantwortung für die Wertebildung in seinem Stadion und rund um seinen Verein trägt. Diese Verantwortung sollte man selbstbewusst annehmen und nicht als Last, sondern als Chance verstehen. Die Chance, ein fester Baustein einer offenen, toleranten und lebendigen Fankultur zu sein. Und sie mit jedem Menschen, der mit an Bord ist, ein Stück zu festigen. Um hier nachhaltige Erfolge zu erzielen, sind vereinsinterne Strukturen, die sich mit sozialen Projekten beschäftigen und soziales Engagement dauerhaft konzipieren, ideal. Keine plakativen Aktionen, sondern nachhaltige Arbeit mit und für sozial Benachteiligte, die Vermittlung eines positiven Menschenbildes und integrative Angebote. Dies sind die besten Wegbereiter für Toleranz, Verständnis, Offenheit und Menschlichkeit. So bildet sich eine belastbare Basis für die Wertebildung und künftige Zusammenarbeit mit den Menschen rund um den Verein. Künftig? Aber was ist mit der aktuellen Kurve? Es ist unabdingbar, die Fanstrukturen zu kennen. Sich mit den Fans in ihrer unterschiedlichen Ausprägung zu beschäftigen, ihnen zuzuhören. Die Strukturen in einer Kurve sind kompliziert und verworren. Die Fanszenen haben sich über Jahre entwickelt. Regionale Eigenheiten spielen dabei ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle. Wenn man sich als Verein im Profifußball-Business befindet, kann man überhaupt einen kompletten Überblick über die Entwicklungen der Kurve haben? Seit einigen Jahren beschäftigen die Vereine Fanbeauftragte, um genau diesen Einblick zu bekommen.
Fanbeauftragte sind Seismographen für Strömungen innerhalb der Fanszenen, haben im besten Fall ein Gespür für Entwicklungen innerhalb „ihrer“ Kurven und können einschätzen, welchen Stellenwert Menschlichkeit, Offenheit und Toleranz bei den Fans einnehmen. Und welchen Stellenwert haben Werte in den Vereinen, die sich in einem immer härteren weltweiten wirtschaftlichen Wettbewerb befinden? Ist die Zeit da, um sich tiefgreifend mit diesem Thema zu beschäftigen, oder bleibt es bei Lippenbekenntnissen? Es reicht hier nicht, an der Oberfläche zu kratzen. Nein. Diese Werte müssen gelebt werden, sonst verpuffen sie. Vor allem ist es wichtig, sie gemeinsam zu leben: Fans, Verein, Stadion und Stadt. Die Arbeit für diese Werte und vor allem den Erhalt dieser ist effektiver, wenn sie auf mehrere Schultern verteilt ist. Dies sollte allen Beteiligten bewusst sein. Hier die Verantwortung von sich zu schieben, ist grob fahrlässig und birgt die Gefahr, dass sich populistische Denkweisen durchsetzen können. Eine starke und aufeinander abgestimmte Allianz gegen Menschen- und Demokratiefeindlichkeit zu bilden, gibt den Beteiligten die Chance, mutig zu sein, sich sicher zu fühlen und nicht alleine im Gegenwind zu stehen. Denn den wird es geben. Das ist sicher. Gemeinsam kann man sich Windschutz geben. Neben den regional verankerten Bündnissen sollte es auch standortübergreifende Zusammenarbeit geben. Wenn sich Bundesligavereine und ihre Fans für antidiskriminierende Aktionen zusammenschließen, hat dies eine enorme Strahlkraft. Mit ihrem Verein im Rücken, haben die Fans eine bessere Möglichkeit, klar Position gegen Menschenfeindlichkeit zu beziehen. Und sie wissen, dass sie damit nicht alleine sind. Sie können sich gegenseitig in der Kurve unterstützen und der jüngeren Fangeneration diese Werte mit auf den Weg geben.
Es braucht eigentlich nicht viel, um dieses oben genannte „Nein“ zu sagen. Eben nur eine klare Position. Als Verein, als Kurve und am besten auch als gesamter Standort. Manchmal scheint dieser kleine Schritt enorm schwierig zu sein. Es braucht immer Menschen, die andere an die Hand nehmen und diesen Schritt gehen. Menschen, die sich in den Wind stellen, helfen, die aufklären, Veränderungsprozesse begleiten. Menschen, die über den Tellerrand schauen und sensibel für gesellschaftliche Entwicklungen sind. Sie begleiten den Fußball wissenschaftlich und stehen den Beteiligten zur Seite, auch wenn Hürden unüberwindbar erscheinen. Sie können die Akteure rund um den Fußball auf dem Laufenden halten und versetzen sie in die Lage, im besten Fall präventiv auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren zu können. Menschen, die die Courage haben, auch unangenehme Themen auf die Agenda zu setzen. Themen, die nicht in eine „heile“, glitzernde Fußballwelt passen, aber dazugehören. Es braucht Menschen mit Mut, sich mit ihnen zu beschäftigen und diese öffentlich zu machen. Menschen, die genau dieses „Nein“ hartnäckig und offen sagen.
Bremen, 10. Juli 2017
Julia Düvelsdorf