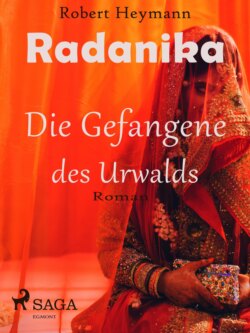Читать книгу Radanika. Die Gefangene des Urwalds - Robert Heymann - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6.
ОглавлениеDie Gefangene liegt auf dem Ruhebett des Radschas und schläft. Wohlgerüche schweben in der Luft. Stille herrscht, nur fern klirrt dann und wann eine Waffe. Wasser plätschern und vertiefen die Harmonie der Ruhe.
Radanika schreckt auf und starrt auf die opalene Lampe, die von der Decke hängt.
Tiefe, nachtschwere Traurigkeit umfängt sie. Sie beginnt zu weinen, sie fürchtet sich. Sie denkt an ihre fernen Freunde. An die Trompetenfanfaren der Elefanten. An die huschenden Tiger. An die spektakelnden Affen, die unermüdlich sind im Ausdenken von Spässen.
Sie denkt an die gebrechliche Memmsahib, die Leopardenmutter, zwischen deren Weichen sie als Kind geruht, den grünen Dom des Urwaldes bestaunt oder dem Schelten der Affen gelauscht hatte. Sie denkt an Maha, Memmsahibs stärkstes Kind, Maha, die mutige Kämpferin. Ihre unermüdliche Beschützerin. Tot ...
Einsam wird Memmsahib im Urwald ihr Klagelied um die Verschwundene singen. Sicherlich hat sie längst den roten Schweiss Mahas gerochen.
Eine heisse, schmerzende Sehnsucht erfasst die weinende Radanika. Die Sehnsucht nach den Dschungeln, nach der Leopardenmutter, nach den Tieren der Wälder, nach der Einsamkeit. Was will man von ihr? Warum hat man sie geraubt? Sie weiss es nicht. Aber dass ihr Gefahr droht, fühlt sie. Denn Radanika ist nicht nur ein Kind der Dschungeln. Sie versteht die Sprache der Eingeborenen, sie kennt die Sprache der Engländer. Dreimal täglich betet sie zu dem grossen Buddha, und seine Lehre lebt in ihrem Herzen wie heiliges Feuer in einem Achatgefäss. Dies ist eines der Gebote des Allwissenden, des Weisen, der die höchste Stufe der Vollendung erreicht hat:
„Schmücke dich nicht mit Kränzen, Wohlgerüchen und Salben!“
Man hat aber Radanika geschmückt. Mit Kränzen, Wohlgerüchen und Salben. Sünde ist es, und der Heilige wird sein Antlitz verbergen und trauern.
Sie schnellt hoch und schleudert die Kränze zu Boden.
„O, du Erleuchteter“, ruft sie in Erinnerung an ihren Lehrer, den Einsiedler in den Dschungeln, „der du mir Helfer warst, Lehrer und Vater! Du, den ich täglich in seiner Hütte mitten in der Wildnis zwischen Tieren besucht habe — wo bist du? Warum hilfst du mir nicht?
Paya! Heiliger!
Als ich zum erstenmal denkend mein Lager in den Dschungeln verliess und landeinwärts suchte, da erblickte ich von ferne deine Bambushütte.
Kein Gehege schützt dich gegen Tiger und Elefanten. Nichts wehrt die Schlange von deinem Lager.
Du, einst ein gelehrter Birmane, ein Brahmane, der auf dem heiligen Elefanten ritt, der die gelbe Toga der Priesterkaste trug, der in der Pagode betete, du hast dich zurückgezogen in die Einsamkeit und zu den wilden Tieren. Du hast das Fieber der Sümpfe nicht gescheut, du hast dich nicht geschützt gegen Moskitos und Regen. Wenn selbst die Affen auswandern aus den tiefen Niederungen der Dschungeln, um höher in die Berge zu fliehen vor dem Fieber des Sommers — du bleibst, um in heiliger Versunkenheit über die Geheimnisse des Lebens, der Wiedergeburt und des Nirwana zu sinnen.
Damals trat ich als Kind vor dich hin, den Menschen anstannend, in deinen Anblick versunken.
Du aber, den keine Erscheinung in Erstaunen versetzen kann, du stauntest: Kind einer europäischen Mutter, mit deinen seltsamen Augen! Welch unheimliches Wunder führt dich in das Herz des Urwaldes? Du bist kein Geschöpf des Morang. Dich hat keine Frau vom Stamme der Matschi, der letzten Ureinwohner in den Dschungeln, in ihrem Schosse getragen.
Wer also bist du?
Ich verstand dich nicht, aber du verstandest meine Gedanken. Und ich sagte dir durch meine Gedanken, die du lesen konntest, wie du alles weisst, was niemand weiss:
Ich bin das Kind der Leopardenmemmsahib, und Maha, der Leopard, ist meine Schwester. Ich bin, seit ich denken kann, in den Dschungeln. Die Memmsahib, die Leopardin, hat mich gesäugt. Vielleicht hat mich die Lotos geboren, vielleicht lag ich im Schosse einer Orchidee. Dunkel, ganz dunkel habe ich eine Erinnerung: Eine blonde Frau, ein weisser Mann, eine Stadt von Wagen und Pferden — aber das ist wie ein Traum.
Du, der Einsiedler, hast mich gesegnet, und seitdem besuchte ich dich täglich. Kein Tier greift dich an, keine Schlange beschleicht dich. Die Elefanten gehen im Bogen um deine Hütte und brechen mit Rüsseln und Tritten Wege für dich.
Du aber hast mich die Sprache der Menschen gelehrt. Du hast mich die Gebote des Buddha gelehrt. So bin ich aufgewachsen im Schutze der Tiere des Waldes und in deinem heiligen Schimmer!
Eines Tages aber kam ich zu deiner Bambushütte, doch die Hütte war leer.
Die Spur deiner Schritte war verweht.
Bist du aufgestiegen zur letzten Erkenntnis, zum Nirwana? Ist deine Seele eingegangen in einen nenen Körper? Kali Belloh, der Teufel, hat keine Macht über dich. Warum aber über mich?
Ich weinte bitterlich. Viele Sonnenauf- und -niedergänge bin ich umhergewandert, dich zu finden; aber ich fand dich nicht. Und als ich dich am Rande der Dschungeln suchte, dort, wo man zu den fauchenden Drachen der Weissen gelangt, wo die Fremden wohnen, da überfielen sie mich und schleppten mich hierher. Warum hast du mir nicht beigestanden? Man hat mir Jasminkränze ins Haar geflochten, und du hast mich gelehrt, dass nur Buddhas Bild mit Jasmin geschmückt wird.
Wo bist du? Konntest du nicht verhindern, dass sie mich einfingen wie das törichte Elefantenbaby, das sich zu weit von der warnenden Mutter entfernt hat?
„Schlafe nicht auf üppigem Lager!“ steht auf dem Torbogen der Tempel des Erleuchteten.
Und ich ruhe hier zwischen Kissen und Fellen und Decken. Ich ersticke und leide und fürchte mich!“ —
Bei diesem Gedanken schnellte Radanika hoch, um aus diesem Gefängnis der Wohlgerüche zu entfliehen. Aber da fliegt ein Teppich zur Seite. Der Fürst steht vor ihr, in einen langen Seidenmantel gehüllt. Sein Lächeln verwirrt sie. Seine Augen unter dem Turban deuten Unheil, Schande. Seine Arme, die sich ausstrecken, erregen ihren Zorn. Scheint er doch vier Arme zu haben in seiner Gier, scheint er doch einen Elefantenkopf auf seinen breiten Schultern zu tragen, so wie der Gott Ganesch geschildert wird, den die armen Götzenanbeter auf Ceylon verehren.
Sie duckt sich, weicht zurück.
Er folgt ihr.
Warum sieht er mich so an mit seinen schmutzigen, schwarzen Augen? denkt Radanika. Er sinnt Böses. Sie entgleitet bis zur äussersten Säule. Aber der Radscha holt sie ein und umschlingt sie. Federnd hebt er sie empor. In diesem Augenblick erwacht das Blut in Radanika.
Die Milch der Leopardenmemmsahib.
Mit einer Kraft, die nie in dem gazellenschlanken Körper zu vermuten war, schnellt sie sich aus den Armen des Mannes. Wie eine Flamme auflodernd steht sie da. Pfeifendes Fauchen entflieht den halbgeöffneten Lippen. Die flammenden Lippen heben sich über das blinkende Gebiss. Sie zischt.
Ihre glitzernden Augen haben den Dolch entdeckt, den der Radscha am Gürtel trägt. Sie kennt die Bedeutung der Waffe. Die wenigen Matschimenschen, die durch die Dschungeln sich einen Weg bahnen, die seltenen Bewohner des Tarai, tragen solche Messer.
Stark und kräftig sind sie, der Stahl ist nach innen gebogen, Kuckrie nennen sie die Klinge.
Rascher als die schiessende Schlange ist ihr Arm nach dem Messer des Radschas vorgestossen, ihre Hand umspannt das tödliche Eisen.
Da stürzen Männer der Leibwache herein.
Radanikas Dschungelruf tönt durch den Palast. Mit der Gewandtheit der Kobra entschlüpft Radanika durch den Menschenknäuel. Marmorgänge sieht sie im Scheine der edelsteingeschmückten Lampen. Eine Treppe, so breit, dass der Staatselefant sie betreten kann. Wie der Vogel im Flug durchmisst sie den Palast.
Erreicht die mondscheinumflossenen Gärten, und ehe die Soldaten ihr folgen können, eilt sie schon durch die dichten Büsche in schnellstem Lauf, den Ausweg suchend.
Sie lockt und ruft und girrt in wachsender Verzweiflung. Aber sie findet den Ausweg nicht.
Inzwischen blinken Lichter an allen Enden und Ecken des Parkes. Fackeln spiegeln sich in dem stillen Teich. Vögel flattern erschreckt aus dem Schlaf. Von allen Seiten eilen Soldaten mit Waffen herbei. Radanika ist von neuem umstellt, von schreienden Männern umringt. In heller Wut wirft sie den Dolch. Doch man reisst sie nieder, bindet sie, man steckt die Beissende in einen Sack und schleift sie vor den alten Fürsten.
Blutrot ist das Geäder in seinen Augen. Er stampft vor Wut.
Röchelnd sagt er, als ob er Betel kaue:
„Den Tigern!“
Radanika fühlt sich emporgehoben und fortgetragen. Unergründliche Treppen rollt sie hinab in ihrem Sack. Schwer fällt sie auf Steinfliesen auf.
Was tut es, wenn sie Arme und Beine bricht? Morgen soll sie den Tigern in der Arena vorgeworfen werden!