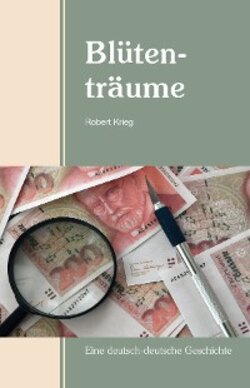Читать книгу Blütenträume - Robert Krieg - Страница 5
ОглавлениеErster Teil
1
1990: Bankraub in Eisenhüttenstadt
Schulz zog nervös an der bis auf einen winzigen Rest aufgerauchten Zigarette und schnippte den Stummel aus dem halb geöffneten Autofenster. Er starrte nach oben auf das Flachdach des dreistöckigen Plattenbaus. Einen Moment lang kreuzte sich sein Blick mit dem des Gerüstbauers, der gerade eine schwere Bohle nach oben zog und sich dabei über den Dachvorsprung beugte.
»Verdammt«, durchfuhr es Schulz«, der könnte mich wiedererkennen. Mein Auto, das merkt der sich doch bestimmt!« Schulz drehte den Rückspiegel so, dass er die Toreinfahrt hinter ihm genau im Blick hatte.
»Wo bleiben die Scheißkerle«, fluchte er innerlich und verbot sich, eine weitere Zigarette aus dem Päckchen zu fingern.
Eine Gruppe Kinder zog Hand in Hand durch die stille Nebenstraße. Die Kindergärtnerin in ihrem Schlepptau blickte neugierig in den metallblauen Passat. Der Mann auf dem Fahrersitz war um die Fünfzig und sah aus wie der Typ, der ihr kürzlich eine Lebensversicherung angedreht hatte.
»Stehenbleiben!«, rief sie, »Jetzt überqueren wir die Straße. Alle warten! Erst nach links gucken, dann nach rechts und dann erst rüber laufen.«
Schulz beobachtete, wie sich die Kinder vor ihm auf dem Bürgersteig in Zweierreihen aufstellten und auf das Kommando zum Loslaufen warteten. Sein Puls schlug schneller. Jeden Augenblick konnten Heller und Glaser aus dem Torbogen gerannt kommen. Dann mussten sie losrasen. Es durfte keine Verzögerung geben. Er hatte ausgerechnet, dass sie höchstens sieben Minuten Vorsprung hätten. Das würde aber reichen, um über die Ausfallstraße aus der Stadt rauszukommen und die Landstraße an der Oder entlang nach Cottbus zu erreichen.
»Die Bullen gehen bestimmt davon aus, dass wir die Autobahn nach Berlin nehmen. Denkste!« Der Mann am Steuer lachte still in sich hinein.
»Schulzi ist wieder mal auf der Flucht.« Das schien das Motto seines Lebens zu sein.
Die Kindergärtnerin hatte ihre Schützlinge am Bürgersteig aufgebaut und übte jetzt mit ihnen nach links und nach rechts schauen.
»Diese blöde Kuh!« Schulz hätte am liebsten auf die Hupe gedrückt. Nach einem unendlich langen Moment setzte sich die kleine Schar in Bewegung. Schulz blickte ihnen versöhnt nach, als sie sich unter Gelächter und Geschubse auf der anderen Straßenseite davon machten.
Einer der Jungen trug eine selbstgestrickte Wollmütze. So eine hatte er auch getragen, als sie 1948 beim Kohlenklau in Königsberg von den Russen erwischt worden waren. Er sah wieder die endlosen offenen Waggons auf dem Königsberger Güterbahnhof vor sich. Eben noch hatte Erika, seine dreizehnjährige große Schwester, Kohlebrocken vom Waggon runter geworfen und gerade, als er sie in seinen löchrigen Jutesack einsammeln wollte, packte ihn ein russischer Soldat von hinten und befahl Erika mit unmissverständlichen Zeichen, vom Waggon herunterzuklettern. Vor dieses Bild schob sich der verstörende Anblick aus dem Innern des Schuppens. Seine Schwester lag entblößt rücklings mit gespreizten Beinen auf einem rohen Holztisch. Der kleine Schulz starrte auf den nackten Hintern des jungen Soldaten, der sich an seiner Schwester zu schaffen machte. Ein älterer Russe, ebenfalls in Uniform, flößte Erika etwas Wodka ein.
»Pʼyanstvo, devushki, pitʼ! Trink Mädchen, trink!«, grölte er und tätschelte ihren Arm.
Ob seine Schwester noch daran dachte? Oder hatte sie es gänzlich verdrängt? Er hatte Erika schwören müssen, es nicht der Mutter zu erzählen. Danach hatten sie niemals mehr darüber gesprochen. Weder auf dem Flüchtlingstreck nach Deutschland noch danach in Leipzig. Seine Flucht in den Westen hatte sie endgültig voneinander getrennt. Vor einem halben Jahr, wenige Monate nach dem Mauerfall, hatte er sie nach Jahrzehnten wiedergesehen. Er hatte sie kaum wiedererkannt. Aus der sportlichen, selbstbewussten jungen Frau, wie er sie von damals, 1955, in Erinnerung hatte, war eine behäbige Matrone geworden, die vom Leben nichts mehr zu erwarten schien.
Wenn sie heute Nachmittag von der Schicht zurückkehrte, würde sie sich wahrscheinlich an ihren Couchtisch setzen, keine 200 Meter Luftlinie entfernt, und den Instant-Kaffee schlürfen, den er ihr mitgebracht hatte. Aus ihrem Wohnzimmerfenster konnte man direkt die Dresdner-Bank-Filiale sehen, die in einem provisorischen Container untergebracht war und in diesem Augenblick überfallen wurde.
Seine Schwester muss sich gewundert haben, dass er, nachdem er sie erst im Sommer besucht hatte, plötzlich wieder aufgetaucht war, dieses Mal in Begleitung von zwei Männern. Der eine glatt rasiert, voll falscher Freundlichkeit. Ein gutaussehender Typ, für sein Alter schon etwas verlebt, der seiner Schwester plumpe Komplimente machte, die sie tatsächlich noch zum Erröten brachten. Der andere eher ein Schweiger, in sich gekehrt, bulliges Äußeres, Alter schwer schätzbar. Aus den etwas kurzen Ärmeln seiner rissigen Lederjacke lugten großflächige Tätowierungen vor. Zwei Knastbrüder – aber Erika sagten diese Zeichen nichts. Angeblich suchten seine beiden Freunde Geschäftsräume für einen Elektronikfachhandel ganz in der Nähe, in Frankfurt an der Oder. Erika war froh, ihren kleinen Bruder, so nannte sie ihn immer noch, das wollte sie sich nicht mehr abgewöhnen, nach so kurzer Zeit wiederzusehen. Sie improvisierte Kohlrouladen, freute sich, dass sie den drei Männern schmeckten und stellte ihnen ihr Schlafzimmer zur Verfügung.
»Nein, nein«, wehrte sie ab, »ich kann hier auf der Couch im Wohnzimmer schlafen.«
Am nächsten Tag war sie früh zur Arbeit gegangen. Die Molkerei war übernommen worden, ihr Arbeitsplatz schien erst einmal krisensicher. Das war schon etwas Besonderes in Eisenhüttenstadt im Jahr nach der Wende. Während sie weg war, beobachteten die drei Männer mit einem Fernglas vom Wohnzimmerfenster aus den Eingang der Bank. Schulz zählte die Kunden, versuchte Stoßzeiten abzuschätzen. Am frühen Nachmittag war er hinuntergegangen, hatte einen neuen 200-DM-Schein gewechselt und sich dabei die Filiale von innen eingeprägt. Wieder zurück, fertigte er eine Skizze an. Von Anfang an hatte er darauf bestanden, nur als Fahrer mitzumachen. Er hatte noch nie eine Bank ausgeraubt und verabscheute es, Menschen mit einer Waffe zu bedrohen.
Glaser hörte kaum noch zu. Seit dem frühen Morgen hatte er sich eine Tüte nach der anderen gebaut und nebenbei eine halbe Flasche Wodka geleert. Sein Kompagnon spielte währenddessen mit einer Knarre und legte auf imaginäre Ziele an. Die ganze Vorbereitung war an Schulz hängen geblieben. Sie hatten es nicht geschafft, falsche Nummernschilder zu besorgen. Schulz blieb nichts anderes übrig, als seine eigenen mit weißem Heftpflaster, das er sich in einer Drogerie besorgt hatte, zu manipulieren. Er war aus der Stadt rausgefahren auf einen verlassenen Segelflugplatz. Dort klebte er das H für Hannover zu einem I um, das im Osten für Berlin stand. Aus den zwei Achten machte er zwei Dreien. Dann fuhr er mehrmals durch eine tiefe Pfütze, um die Nummernschilder ordentlich mit Schlamm zu bespritzen. Jetzt fiel das Heftpflaster nicht mehr auf. Noch nicht einmal an ihre Maskierung hatten die Kerle gedacht. Nach einigem Suchen hatte er in einem Sportgeschäft zwei wollene Motorrad-Mützen gefunden. In Schulz stieg die Wut hoch. Nicht nur auf die beiden, sondern auch auf sich selbst. Wie hatte er sich nur auf diesen Wahnsinn einlassen können. Jetzt war es zu spät. Er konnte nicht mehr zurück. Das hätte seinem Ehrenkodex widersprochen: ein einmal gegebenes Wort durfte man nicht brechen. Außerdem brauchte er dringend das Geld, um endlich den ganz großen Coup landen zu können, der ihn bis ans Ende seiner Tage von allen Geldsorgen befreien würde. Sie hatten sich für die Mittagszeit entschieden. Kurz vor der Mittagspause war in der Filiale am wenigsten los gewesen.
Im Rückspiegel sah Schulz Glaser und Heller aus der Toreinfahrt herausgerannt kommen.,die über einen Innenhof die stille Straße mit dem belebten Platz vor der Bank verband. Er hatte den beiden mühsam klar gemacht, dass die Wahl dieses Ortes zu seinem strategischen Fluchtplan gehörte. Niemand durfte ihn und den Wagen vor der Bank warten sehen, vor allem seine Schwester nicht, wenn sie zufällig außerplanmäßig früher nach Hause kommen sollte. So ein Zufall hatte ihn schon einmal in den Knast gebracht.
»Fahr schon los«, schnaufte Heller und zerrte sich die Motorradmütze vom Kopf.
»Denen habʼ ichʼs gezeigt«, kicherte Glaser, der immer noch den Magnum Revolver Kaliber 357 in der Hand hielt, während Schulz den Passat durch die stille Nebenstraße jagte und der Gerüstbauer, vom Aufheulen des Motors überrascht, angestrengt dem Wagen hinterher blickte.
»Was hast du denen gezeigt?«, fragte Schulz in den Rückspiegel.
»Der Kassierer wollte uns nicht glauben. Ich hab erst in die Decke geschossen und dann …«
»Du warst noch von gestern besoffen«, brummte Heller, »und hast dich doch erst mal auf die Fresse gelegt, als du über den Tresen gesprungen bist. Und dann musst du aus Frust auf den Kassierer schießen, du Penner!«
Schulz wurde bleich.
»Ich habʼ ihn doch nur am Bein getroffen«, gluckste Glaser, »hat er aber verdient.«
In Schulz stieg eine heiße Welle des Ärgers hoch. Er spürte, dass ihm die Kontrolle über die Situation aus den Händen glitt. Während sie die letzten Außenbezirke von Eisenhüttenstadt hinter sich ließen und der Wagen allmählich beschleunigte, dachte Schulz fieberhaft darüber nach, wie er die beiden Kerle so schnell wie möglich wieder loswerden konnte. Aber alles Grübeln half nichts. Ausgemacht war, das erbeutete Geld in Hannover zu teilen, dann würden sie sich hoffentlich nie wieder in ihrem Leben begegnen.
Glaser hatte den Schraubverschluss einer frischen Wodkaflasche aufgedreht und setzte zum Trinken an.
»Trink nicht so viel!«, herrschte ihn Schulz an.
»Leck mich!«, schnauzte Glaser zurück. »Fahr weiter und haltʼ dich raus.«
Die dicke Pranke von Heller drückte die Flasche runter.
»Es reicht jetzt!«
Glaser gehorchte. Vor Hellers physischer Präsenz hatte er Respekt.
Auf einem stillen Parkplatz riss Schulz das Heftpflaster von den Nummernschildern ab. In Cottbus angekommen, kämpfte er sich während eines Platzregens, den die Scheibenwischer kaum noch bewältigten, durch die Innenstadt. Obwohl er die Heizung voll aufgedreht hatte, beschlugen die Scheiben immer mehr und der verwirrende Schilderwald setzte ihn zusätzlich unter Druck. Dauernd ging es nach Leipzig, aber das war die falsche Richtung.
_ _ _
Bei seinem ersten Besuch bei seiner Schwester hatte er sich die Stadt ansehen wollen. Neugierig ging er durch die Straßen und war überrascht von ihrem maroden Zustand. Von den Fassaden bröckelnder Putz, geschlossene Geschäfte, mit Pappe vernagelte Fensterhöhlen. Im Kopfsteinpflaster fehlten einzelne Steine und aus den Regenrinnen wuchsen Grasbüschel. Im Stadtzentrum sah es nicht viel besser aus. Die Plattenbauteile, die historische Fassaden nachahmen sollten, hatten Risse im Beton. In den Boutiquen der DDR-Mode-Marke EXQUISIT, einst ein Schaufenster des realsozialistischen Staates im längst verlorenen Wettbewerb mit den Brüdern und Schwestern im Westen, hatte Billigware Einzug gehalten. Die Zeichen der neuen Zeit machten sich überall bemerkbar. Handwerker standen auf Leitern und schraubten Marlboro-Reklameschilder an, und vor den Sparkassen aus der DDR-Zeit standen die Menschen Schlange, um ihre Ersparnisse in die begehrte West-Mark umzutauschen. In den Händen hielten sie Plastiktüten von Aldi und Kaufhof als Ersatz für die früheren Einkaufsbeutel aus Stoff. Ein junger Mann trug stolz ein T-Shirt in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Auf seiner Brust prangte der Bundesadler. Nur die Straßennamen ließen sich nicht so ohne weiteres austauschen. Die Ernst-Thälmann-Straße hieß weiter Ernst-Thälmann-Straße, und der Rosa-Luxemburg-Platz blieb vorläufig der Rosa-Luxemburg-Platz. Die vom Burda-Konzern extra für den Osten frisch auf den Markt geworfene SUPER-ILLU erklärte mit schreienden Balken-Überschriften den Passanten, was sie früher alles falsch gemacht hätten und warum jetzt alles SUPER werden würde.
Der Marktplatz war voller Stände mit fliegenden Händlern, die den Einzug in die neue Welt grenzenlosen Konsums versprachen, Fernseh-Elektronik, Playstations, Video-Recorder, Messer aus Solingen, Küchengeräte von Bosch, Porno-Zeitschriften und -Videos, West-Kondome – da war die Gleitfähigkeit angeblich besser –, indische Räucherstäbchen, Sari-Hemden aus Ceylon und jede Menge Plastikspielzeug für die Kleinen. Dazwischen etwas verloren die eine oder andere Vietnamesin mit Zuckerwatte und der Stand einer in einen Privatbetrieb umgewandelten ehemaligen landwirtschaftlichen Produktions-Genossenschaft. Die stämmigen Verkäuferinnen trugen rot-weiß gestreifte Schürzen und boten Früh-Kartoffeln, Kirschen, Eier und Putenfleisch an. Der Kampf um das Überleben ihrer Betriebs stand ihnen ins Gesicht geschrieben. An jedem Stand hing ein Schild mit dem Hinweis, dass Ost- und West-Mark akzeptiert würden, und in welchem Umtauschverhältnis.
»Willkommen im Westen«, brummte Schulz grimmig. Er blieb vor einem kleinen Mercedes-LKW mit Hamburger Kennzeichen stehen, von dessen Ladefläche aus ein ganz in Leder gekleidetes Pärchen Kofferradios verkaufte. Unter den Kaufwilligen entdeckte er zwei Soldaten der Sowjetarmee. Schulz trat hinter sie, um die vertraute Sprache wieder zu hören. Ihrer Unterhaltung entnahm er, dass sie nicht einmal zu zweit den geforderten Preis zusammenbringen konnten. Der Typ in Motorradjacke, mit goldenem Ohrring und einem T-Shirt mit dem Totenkopf-Emblem des Hamburger Stadtteils St. Pauli, blieb stur und ließ sich nicht um die fehlenden acht West-Mark herunterhandeln. Dieter Schulz sah seine Stunde der Wiedergutmachung gekommen. Er wollte den Soldaten ihren Wunsch erfüllen, so wie ihm damals in Leipzig der russische Offizier, der ihn in den Zirkus eingeladen hatte, wo er wieder den Schweiß der geliebten Kosaken-Pferde riechen konnte und ihm auf seinem Logenplatz die Sägespäne um die Ohren flogen. Er hielt dem Händler die verlangte Summe hin und überreichte den verdutzten Soldaten das Kofferradio. Sein Russisch war sehr viel flüssiger, als er befürchtet hatte. Er wusste nicht, was die beiden jungen Männer in Uniform mehr überraschte, sein gutes Russisch oder die Tatsache, dass ihnen ein wildfremder Deutscher ein Kofferradio schenkte. Sie stellten ihm viele Fragen, und ein paar Marktbesucher blieben neugierig stehen. Schulz wollte jedes Aufsehen vermeiden und lud die beiden in ein Café am Marktplatz ein.
Es blieb nicht bei Kaffee. Einige Runden Wodka später kannten sie seine Geschichte. Die frühe Kindheit in Königsberg/Kaliningrad, seine ersten Begegnungen mit russischen Soldaten und seine Liebe zur russischen Kultur und Sprache, die sich aus diesen prägenden Erlebnissen entwickelt hatte und die ihn nun mit aller Vehemenz einholte. Denn die Stunden mit dem russischen Offizier und seiner Familie im Zirkus zählten für Schulz zu den glücklichsten seiner Kindheit.
Erika hatte Zucker und war übergewichtig. Ihr fiel das Laufen schwer. Wenn sie eine längere Wegstrecke zu Fuß zurücklegen musste, taten ihr die Knie weh. Dieter fuhr mit ihr nach Frankfurt a.d.O. und lud sie in das Restaurant »Zur alten Oder« ein, ein Hotel mit hundertjähriger Tradition, das inzwischen wieder als Familienbetrieb geführt wurde. Erika hatte es vorgeschlagen. Sie hatte schon häufiger dort gegessen, das letzte Mal bei einem Betriebsausflug der Molkerei.
Sie hatte sich schick gemacht und von ihrer Friseuse die Haare legen lassen. Sie las die neu gestaltete Speisekarte und runzelte die Stirn. Die Preise waren im Verhältnis zu früher astronomisch hoch und dazu noch in West-Mark. Empört wollte sie das Lokal verlassen, Dieter hielt sie nur mit Mühe zurück: schließlich sei sie von ihm eingeladen. Das sei die neue Zeit. So hätten sie es doch alle gewollt, dafür waren sie auf die Straße gegangen und hatten das System gestürzt! Jetzt müsse man sehen, was daraus werden würde. Ein neues, freies, anderes Deutschland, in dem wirklich der Volkswille regiere, oder eine Filiale des Westens, ein weiterer Konsumtempel, eine Markterweiterung Richtung Osten, – sonst nichts.
Erika blieb stumm. Sie war nicht mit den anderen auf die Straße gegangen, sie hatte ihr SED-Parteibuch immer noch und Angst vor der Zukunft. Die Stadt hatte das Mietshaus, in dem sie wohnte, zum Schnäppchenpreis an einen Investor aus München verkauft. Ein Zahnarzt, wie ihr die Nachbarin berichtete. Das Gerücht ging um, dass er alles komplett modernisieren wolle. »Was soll das«, hatte Erika gesagt, »das Haus ist doch noch neu mit eingebauten Bädern und Küchen, wo gab es das denn sonst in Altbauten, da musste man den Abort auf halber Treppe in Kauf nehmen.« – »Hast du eine Ahnung«, hatte die Nachbarin geantwortet, »unsere Wohnungen entsprechen doch nicht mehr den West-Standards. Da werden alle Leitungen raus gerupft und neu verlegt.« – »Und wo bleiben wir so lange?« – Das wusste die Nachbarin natürlich nicht und auch nicht, ob sie danach noch die neue Miete bezahlen könnten.
»Vielleicht hörst du dir mal die Geschichte von einem meiner Kollegen aus der Molkerei an«, sagte Erika schließlich »total verrückt. Dem ist die Frau in den Westen abgehauen. Als ich ihm von dir erzählt habe, hat er gefragt, ob er dich vielleicht treffen könnte.«
Dieter traf den Mann am Abend in seiner überheizten Neubauwohnung in einer erst kürzlich fertig gestellten Plattenbausiedlung mit fließend Warmwasser, Einbauküche, Schrankwand, Essecke, Sofaecke, vertäfelter Garderobe, Teppichböden. Vor der Haustür der blanke Lehm, die geplante Grünfläche würde noch auf sich warten lassen. Auf dem Parkplatz und vor der langen Reihe Garagen mit Wellblechdächern und vom Regen angefressenen Holztoren musste man über Pfützen springen, aber eine mitleidige Seele hatte ein paar geborstene Steinplatten in die Lehmkuhlen gelegt. In der Wohnung eine pedantische Ordnung wie in einer Zahnarzt-Praxis. Herr Tautenhahn hielt ihm ein paar Pantoffeln hin: »Könnten Sie bitte Ihre Schuhe ausziehen? Sie haben ja bestimmt den Dreck draußen gesehen«, fügte er entschuldigend hinzu.
Ein perfekter Haushalt in einer perfekten Wohnung, deren sechzig Quadratmeter bis auf den letzten Zentimeter mit wuchtigen, teuren Möbeln vollgestellt waren. Beim Anblick der fünf Meter langen Schrankwand, die bis unter die Decke reichte, hatte Dieter das Gefühl, erdrückt zu werden. Die beiden Kinder, auf die außer ein paar sorgfältig zusammengelegten Kniestrümpfen auf dem Couch-Tisch nichts hinwies, lagen bereits im Bett.
Herr Tautenhahn reichte ihm eine Flasche Wernesgrüner Pilsener.
»Glas?«, fragte er.
Dieter verneinte und prostete ihm mit der Flasche zu.
»Mit der Ramona, meiner Frau, das ist wie ein Krimi«, begann Tautenhahn seine Erzählung.
»Letztes Jahr am fünften November, also vier Tage vor der Maueröffnung, hatte ich Geburtstag. Wir haben hier in der Wohnung gesessen und gefeiert. Meine Schwägerin war auch noch dabei. Am Abend hat Ramona ihren Freund in Weimar angerufen und sich länger mit ihm unterhalten. Danach hat sie ein paar Sachen in eine Tasche geworfen, den Schlüssel von unserem Trabbi genommen und ist gegangen. Seitdem habe ich sie nicht wiedergesehen.«
Ramona hatte seit Jahren ein Verhältnis mit einem geschiedenen Diplomchemiker aus Weimar. Tautenhahn hatte es akzeptiert, wohl in der Hoffnung, seine Ehe zu retten.
»Sie haben unseren Wagen genommen, weil seiner praktisch ganz neu aufgebaut war. Ein Trabbi fährt Jahrzehnte, müssen Sie wissen, er wird alle paar Jahre von Grund auf runderneuert, mit neuem Motor und neuer Haut. Ich will ihnen zugute halten, dass sie unsere Volkswirtschaft nicht schädigen wollten und meinen genommen haben, obwohl ich ihn täglich brauche. Das muss bei Ramona ein Kurzschluss gewesen sein: Als die CSSR die Grenzen öffnete, glaubte sie, jetzt oder nie, vielleicht sind in ein paar Tagen die Grenzen dichter als je zuvor.«
»Und was hat ihre Familie dazu gesagt?«
»Ihre Familie. Ramona ist die zweitälteste von vier Töchtern. Ihre Mutter ist sehr, sehr streng. Sie hat praktisch keinen ihrer Schwiegersöhne richtig akzeptiert, und als wir heirateten, war sie total dagegen. Ramona ist mit siebzehn von zuhause ausgebrochen und hat mich geheiratet. Mit achtzehn wurde sie Mutter. Ich bin nie ihre große Liebe gewesen.«
Dieter Schulz rutschte in seinem Sessel unruhig hin und her. Er war überrascht über die Offenheit, mit der sein Gegenüber, den er kaum eine Stunde kannte, die Intimitäten einer gescheiterten Ehe vor ihm ausbreitete, und zugleich spürte er die Einsamkeit dieses Mannes, der wohl niemanden hatte, mit dem er sich aussprechen konnte.
»Jetzt bin ich sein Taxi-Fahrer oder der Fremde im Zug«, dachte Dieter.
Tautenhahn stand auf, ging in die Küche zum Kühlschrank und kam mit zwei frischen Flaschen Bier zurück.
»Ich sage Ihnen etwas, das ich noch nie jemandem gesagt habe. Ramona hat mich immer ihren liebsten großen Bruder genannt. Mit ihren Schwestern verstehe ich mich gut, neulich hab ich noch eine mit den Kindern besucht. Sie versteht überhaupt nicht, warum Ramona weggegangen ist.«
»Und Sie?«, fragte Dieter.
»Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte sie Angst, sie war politisch sehr aktiv im Oktober. Hat Artikel geschrieben, Flugblätter verfasst. Vielleicht dachte sie, es kommt alles noch viel schlimmer.«
Tautenhahn reichte Dieter einen farbigen Werbeprospekt von einem ihm unbekannten Ort namens Meßstetten auf der schwäbischen Alb.
»Das hat sie mir geschickt. Jetzt weiß ich wenigstens, wo sie steckt. Sie hat mir geschrieben, dass ich ihr ihre Arbeitszeugnisse und ihre Geburtsurkunde schicken soll. Sie wird wohl wieder versuchen, als Krankenschwester zu arbeiten. Dabei hatte sie hier schon ihre Zulassung zum Studium der Literaturwissenschaften in der Tasche. Als Krankenschwester hat sie zum Schluss nur noch in der Verwaltung gearbeitet, wegen ihrem Ekzem an den Händen.«
Tautenhahn seufzte und nahm einen Schluck aus der Bierflasche.
»Sie sind mit dem Trabbi über die CSSR geflüchtet und in ein Auffanglager in Duisburg gekommen. Dort lebt eine Bekannte von ihm. Die ist vor drei Jahren abgehauen und hat zwei Kinder hier gelassen. Ramona schreibt, dass ihr die Kinder fehlen und dass sie die größere Tochter gern bei sich hätte. Aber die Kinder bleiben hier. Das ist ganz klar. Das hat sie selbst so entschieden, am fünften November gab es kein Zurück mehr, da war ihr völlig klar, dass sie sich auch von ihnen trennt! Wer konnte schon ahnen, was am neunten November passiert.«
Tautenhahn stand erneut auf und wühlte in einem Karton voller Fotos. Als erstes zeigte er Dieter ein Bild der achtzehnjährigen Ramona mit ihrer Neugeborenen: »Sie sieht selbst noch wie ein Kind aus, könnte eher die ältere Schwester sein. Dieses Bild hier«, er wies auf das nächste, »habe ich im vergangenen Herbst gemacht. Ich fotografiere viel und entwickle die Bilder selbst.«
Dieter sah ein angespanntes, sorgenvolles Gesicht, eine gewisse Verhärtung sprang ihm ins Auge. Dann Bilder von Waldspaziergängen, vom Urlaub in Ungarn. Eine attraktive, junge Frau, die auf jedem Bild eine andere zu sein schien.
»Ihre Frau hat ja sehr viele Gesichter«, entfuhr es Dieter.
»Viele Gesichter, ja viele Gesichter.« In Tautenhahn arbeitete es. Wie um sich abzulenken, legte er ein paar Bilder von seiner Arbeit auf den Couch-Tisch, die Brigade im Molkereibetrieb.
»Wissen Sie, ich komme aus einer gutbürgerlichen Familie. Mein Vater war Zahnarzt und recht wohlhabend. Ein Stipendium hätte ich nicht bekommen, obwohl er in der SED war. Ich habe Ramona in Dresden kennengelernt, da war sie noch in der Schwesternausbildung und ich am Studieren. Ich war für Ramona der Rettungsanker, um aus ihrer Familie rauszukommen. Sie wollte immer weiter, war nie mit sich zufrieden. Sie hat abends ihr Abitur nachgemacht. Dann wollte sie studieren. Sie hat angefangen, sich für Politik zu interessieren, das ist nicht mein Fall, bis heute nicht. Sie wollte journalistisch arbeiten. Sie wollte immer höher hinaus!«
Bei dieser letzten Bemerkung lächelte er verlegen. In seinem Gesicht mischten sich Stolz auf Ramona und die völlige Verständnislosigkeit für ihre Ambitionen. Er holte noch drei Fotos hervor:
»Die hab ich letztes Jahr am FKK-Strand gemacht.« Eine Serie von Ramona nackt auf dem Bauch liegend mit Blick in die Kamera, ihrer Attraktivität sehr bewusst.
»Und was wird nun werden?«, fragte Dieter leise.
Tautenhahn zog die Schultern hoch. Seine Haltung wurde noch gebeugter.
»Na ja, vielleicht kommt sie demnächst mal auf Besuch, ist ja kein Problem, aber zurückkommen wird sie wohl nicht mehr.« Und nach einer nachdenklichen Pause: »Meinen Trabbi hab ich übrigens wieder. Den hab ich kürzlich aus Duisburg abgeholt. War ja ganz interessant dort. Aber dableiben, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Man ist ja doch verbunden mit hier.«
Es war spät geworden. Herr Tautenhahn hatte noch lange weiter erzählt. In ein paar Stunden musste er los. Schulz verabschiedete sich schnell. Beim Hinausgehen hörte er aus dem Kinderzimmer einen leisen Ruf: Papa!
Die Kinder schliefen unruhig. In ihren Träumen erschien ihnen die Mutter, über die die beiden Männer im Wohnzimmer so lange geredet hatten. Auf dem Nachhauseweg ließ Dieter die eben gehörte Geschichte nicht los. Ramona war vor Jahren aus ihrer kleinbürgerlichen behüteten Ehe ausgebrochen ohne indes die Geborgenheit in der eigenen Familie aufgeben zu wollen. Sie leistete Basisarbeit in einer der Block-Parteien, die ihr dafür den Studienplatz besorgte. Damals begann es in der DDR-Gesellschaft zu brodeln. Im Sommer 1988 nahm die Ausreisewelle zu, und an der Basis ihrer Block-Partei NDPD, in der kleine Selbstständige, Gewerbetreibende und die sogenannte technische Intelligenz organisiert waren, wuchs der Unmut. Ramona schrieb Artikel für die Parteizeitung, organisierte Versammlungen, versuchte den Unmut der Parteifreunde innerhalb der Parteiorganisation weiter nach oben zu tragen. Sie ging zu Demos. Sie wurde von der Stasi bespitzelt. Sie erschrak über ihren eigenen Mut. Sie spürte die Rücksichtslosigkeit des Apparats, der mit aller Gewalt an der Macht bleiben wollte. Gleichzeitig lag die Veränderung zum Greifen nah. Sie erlebte, wie Leute plötzlich ein Mikrofon in die Hand nahmen, aus dem Schatten traten, Gegenmacht formulierten. Dann das traumatische Erlebnis in Leipzig, als sie in eine Prügelei vor dem Bahnhof geriet. Die Polizei trommelte mit langen Holzknüppeln auf die Plexiglasschilde, die sie erst kürzlich aus Westdeutschland erhalten hatten, und lief mit Gebrüll auf die Leute zu.
»Bilder, die ich bis dahin nur aus dem Westfernsehen kannte«, hatte sie ihrem Mann erzählt. Hatte sie damals der Mut verlassen?
»Ja, Leipzig«, dachte Dieter »da hat die Gegenwehr Tradition!«
In Leipzig hatte der Widerstand begonnen, der das Ende der DDR einläutete. Niemand glaubte, dass die Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche einmal eine derartige Wirkung entfalten würden. Niemand hätte geglaubt, dass aus ein paar Unerschrockenen, die die Botschaft der Bergpredigt ernst nahmen, befeuert von einer Protestbewegung in Westdeutschland, die sich gegen Atomraketen und Atommeiler wehrten, eine respektable Gegenmacht entstehen könnte. Eingedenk des Arbeiteraufstands 1953, keine vier Jahre nach Gründung der DDR, hatte sich die Staatsmacht auf alles gefasst gemacht, aber dass Andachten und Bittspaziergänge ihr System aus den Angeln heben könnten, damit hatte niemand gerechnet.
Schulz erinnerte sich noch gut an die Ankunft ihres Flüchtlingstrecks in der ausgebombten Stadt, an seine geliebte Mutter. Wie es in Leipzig wohl jetzt aussieht, wahrscheinlich genauso verrottet wie in Eisenhüttenstadt, grübelte er. Er hatte den Ort seiner Entwicklungsjahre nach der Wende noch nicht wieder besucht. In seinem Kopf verdichtete sich ein Bild, das ihm die Tränen in die Augen trieb.