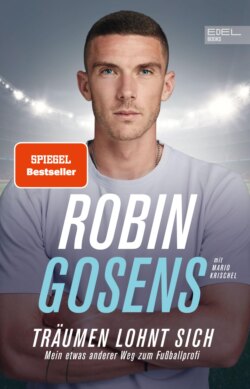Читать книгу Träumen lohnt sich - Robin Gosens - Страница 6
Оглавление5. Juli 1994
Soll ich wirklich davon erzählen, dass ich noch genau weiß, wie ich als Zweijähriger im Familienurlaub in der Kinderdisko zum „The Ketchup Song“ getanzt habe? Lieber nicht. Gleichzeitig ist es mir wichtig, euch mitzuteilen, wo ich herkomme und was das mit mir gemacht hat. Und glaubt mir, es lohnt sich. Ich sag nur rostiger Nagel oder Berthas Bude. Also: Vorhang auf.
Der kleine Robin wurde am 5. Juli 1994 in Emmerich geboren und wuchs 300 Meter von der niederländischen Grenze entfernt in Elten auf. Sein Papa, Holger, ist Holländer und technischer Angestellter bei einem Bauunternehmen, die Mutter, Martina, Deutsche und Arzthelferin. Robin, der Sohn, halb und halb. Chantal, die Tochter, komplettiert das Quartett seit dem 14. Oktober 1996.
Elten ist eines von fünf kleinen Dörfern der Stadt Emmerich, das letzte vor der Grenze zum Nachbarland. Für eine 5000-Seelen-Gemeinde ist in Elten sogar verhältnismäßig viel los. Es gibt drei Restaurants, eine Eisdiele, zwei Bäckereien und drei Supermärkte. Trotzdem kennt hier jeder jeden, und vielleicht ist auch jeder mit jedem irgendwie verwandt. Wie das auf dem Land halt so läuft.
In Elten gibt es neben ganz viel Natur mehrere kleine Siedlungen. In einer davon steht mein Elternhaus. Man kann es sich wie eine langgezogene Straße vorstellen, von der kleinere Stichstraßen mit je fünf Häusern links und rechts abgehen, und die in einem Wendehammer enden. Unser Haus war quasi der Wendehammer. Wir hatten viel Platz, einen Garten und viel Ruhe. Das typische Dorfleben, total entspannt und idyllisch.
Ich habe lange überlegt, was meine erste Erinnerung als Kind ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Weihnachten 1999 war, als ich so sehr darauf hoffte, ein Kettcar zu bekommen, dass mir vor Nervosität den ganzen Tag lang schlecht war und ich wahnsinnige Bauchschmerzen hatte. Chantal und ich mussten an Heiligabend immer hoch auf unsere Zimmer, wenn das Christkind kam und die Geschenke unter den Weihnachtsbaum packte. Ich würde übrigens sofort meine Fußballschuhe an den Nagel hängen, wenn ich dafür wieder ans Christkind glauben könnte. Was ist das eigentlich für eine geile Tradition?
Meine ganze Kindheit fand quasi draußen statt. Ich habe nie eine Konsole besessen. Zum Glück gab es auch keine Smartphones oder Tablets. Wir hatten ein großes Trampolin im Garten, das meinen Alltag dominierte. Mike, Lennart, Jan-Philipp, ein anderer Robin und ich trafen uns jeden Tag und spielten ein bestimmtes Spiel: Einer stand auf dem Trampolin und musste versuchen, die anderen vier daran zu hindern, den Ball hinter einen zu bringen. Ein Torwart und vier Feldspieler, wenn man so will.
Ich fing erst als Sechsjähriger bei Fortuna Elten mit dem Fußballspielen an. Vorher hatte ich eher wenig Bezug zu dem Sport, mit dem ich heute mein Geld verdiene, obwohl mir Papa immer mal wieder einen Ball vor die Füße warf, fast um zu sagen: „Mach doch mal was.“
Dummerweise war er auch mein erster Trainer. Dummerweise, weil ich so unglaublich ehrgeizig war und wir dadurch ein kompliziertes Verhältnis hatten. Wenn er mich auswechselte, fing ich an zu heulen. Er war doch mein Vater, wie konnte er mich da runternehmen? Wir sind oft aneinandergeraten. Deshalb wollte mein Vater den Job bald wieder beenden, um seinen Sohn nicht zu verlieren.
Dieser Ehrgeiz zeigte sich nicht nur auf dem Fußballplatz. Egal, um was für ein Spiel es ging. Ob es „Mensch ärgere Dich nicht“ oder „Uno“ war: Ich konnte nicht verlieren. Sobald ich spürte, dass ich auf der Verliererstraße war, bekam ich Wutanfälle und heulte los. Und auch heute noch: Wenn ich zum Beispiel ein Brettspiel gegen Rabea verliere, fängt es an, in mir zu brodeln. Ich überrede sie dann meistens zu einer Revanche-Partie, obwohl ich weiß, dass ihr das nicht viel Spaß macht.
Ich war ein sehr anstrengendes Kind, das nie die Klappe halten konnte. Das war meinen Eltern teilweise richtig peinlich. Als kleiner Bursche fragte ich wildfremde Menschen auf der Straße, wie es ihnen gehen würde. Was die wohl gedacht haben müssen? Ich konnte nie stillsitzen, irgendwie musste ich ständig beschäftigt werden. Das führte mitunter auch zu ziemlich dummen Ideen. Als ich zehn war, trafen wir uns an einem verregneten Tag bei Fortuna Elten. Dort lagen Holzbalken, auf denen wir Kinder gerne balancierten. Aus einem dieser Balken ragte ein fetter, rostiger Nagel heraus. Klar, was jetzt kommen muss: Ein paar Minuten später steckte dieser Nagel in meinem Knie. Die Narbe habe ich immer noch. Noch viel schlimmer: Im Krankenhaus wurde mein Bein verbunden. „Darf man damit noch aufs Trampolin?“, fragte ich und bekam nur ein Kopfschütteln zur Antwort. „Aber Fußballspielen geht noch, wenn ich nur mit rechts schieße?“ Nein, auch kein Fußball.
Was für eine Katastrophe.
Ein paar Wochen später fuhren wir nach Italien in den Urlaub, mein Bein war wieder einigermaßen einsatzfähig. Vor Ort fand ich relativ schnell Freunde. Das ist übrigens auch so ein Phänomen, oder? Zeigt mir mal einen Jungen zwischen sieben und elf, der im Urlaub nicht mindestens einen Freund fürs Leben findet. Zumindest hält die Freundschaft so lange, bis man wieder zu Hause ankommt. In diesem Alter gibt es noch keine Hemmschwelle.
Meinen Eltern erzählte ich nichts von meiner Bekanntschaft, denn ich wollte ja Fußball spielen, was sie mir strengstens verboten hatten. Natürlich fiel ich genau auf die Wunde, die wieder aufriss. Mama und Papa mussten mit mir in ein italienisches Krankenhaus, beide sprachen kaum ein Wort Englisch, geschweige denn Italienisch. Unter maximal unhygienischen Bedingungen wurde die Wunde wieder zugenäht, das passte aber vorne und hinten nicht. Deshalb ist die Narbe auch heute noch so fett.
Das Trampolin in unserem Garten reichte den Jungs und mir irgendwann nicht mehr aus. Mit elf Jahren fuhr ich oft zu Opa Klaus. Der wohnt in Hüthum, fünf Kilometer von Elten entfernt. Opa ist geborener Handwerker, deshalb fragte ich ihn eines Tages: „Sag mal, Opa, es muss doch möglich sein, dass wir in unserem Wendehammer Fußball spielen können, dann müssen wir nicht immer zum Sportplatz fahren!?“ Und Opa hatte eine Idee. Aus einem alten Bettgestell bastelten wir Tore, ein Meter mal ein Meter groß. Von da an spielten wir jeden Tag Fußball, ganz egal, bei welchem Wetter. Am schönsten war es, wenn Schnee lag, dann konnte man gut grätschen. Glücklicherweise lagen auf der Straße keine rostigen Nägel.
Ich hatte schon damals einen harten Schuss und war ziemlich schnell. Das reichte in den ersten Junioren-Jahren aus, um aufzufallen. Eine Position gab es in der F- oder E-Jugend natürlich noch nicht, da war man entweder defensiv oder offensiv. Ich durfte vorne ran und schoss viele Tore. Mein Vater erinnert sich, dass ich mir den Ball meistens einfach weit vorlegte und die Abwehrspieler überlief. Bitte haltet mich jetzt nicht für einen Angeber, das ist Papas Aussage!
In der D-Jugend wechselte ich zum FC Bocholt. Die waren zu der Zeit in unserer Gegend das Nonplusultra, gerade in Sachen Jugendarbeit. Da wurde auch zum ersten Mal deutlich, dass ich vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr draufhatte als die Jungs, mit denen ich im Dorf kickte. Zentrales Mittelfeld war meine erste richtige Position, und ich füllte sie ganz gut aus. Vier Jahre später ging es weiter zum VfL Rhede, jüngerer Jahrgang B-Jugend, ich war ungefähr 15. Für Rhede, einen etwas größeren Klub mit eigener Leichtathletikabteilung und einem Hauptplatz mit Tribüne, entschied ich mich auch deshalb, weil die regelmäßig um den Aufstieg in die Niederrheinliga mitspielten, also eine Klasse unterhalb der Junioren-Bundesliga. Außerdem, und das war vielleicht noch wichtiger, spielte dort fast mein gesamter Freundeskreis.
An diesem Punkt machen wir einen Haken unter dem kleinen, unschuldigen Robin und dem rostigen Nagel, die Bettgestelltore und Schneegrätschen. Jetzt wird es ernst.
Ich hatte zwei Freundeskreise, einen in Rhede und einen in Emmerich. Als ich 15 war, im ersten B-Jugend-Jahr in Rhede, trainierten wir immer freitags. Mama und Papa versuchte ich zu erklären, dass eine Übernachtung bei meinem Kumpel Julian in Bocholt durchaus sinnvoll war, denn von da aus ginge es am Samstag schneller zum Spiel. Von Elten nach Rhede sind es mehr als 30 Minuten, meine Argumentation war also durchaus stichhaltig. Mama und Papa glaubten mir natürlich trotzdem nicht. Ihnen war vollkommen klar, was „ich übernachte heute bei Julian“ bedeutete. Wer den Wink mit dem Zaunpfahl immer noch nicht verstanden hat: Es ging um Alkohol. Julians Eltern waren eigentlich immer relativ streng, nur beim Thema Alkohol irgendwie lockerer. Das verstand ich damals zwar nicht, aber es war mir auch egal. Jeder Freundeskreis hat diesen einen Kumpel, dessen Eltern am Wochenende alle vier Augen zudrücken. Ich glaube ja, dass diese Eltern sich einfach freuen, dass das eigene Kind gute Freunde gefunden hat. Und deshalb sagen sie gerne ja, wenn der Junior die ganze Bande mal wieder zu sich einlädt. Ist aber nur meine Theorie. Es waren sowieso nur ein paar Schlucke Bier oder Apfelkorn, alles ganz harmlos.
Mit 15 hatten wir, das wiederum betrifft den Kreis in Emmerich, noch andere Interessen, auf die ich nicht unbedingt sehr stolz bin. Aber wir waren nun mal 15, probierten viel aus und machten einige Fehler. Keine Sorge, es wird jetzt nicht sexuell oder so, dafür müsst ihr euch ein anderes Buch kaufen. Wir halten den Ball lieber flach.
Die Emmerich-Gang hatte sich einen Roller besorgt, sodass der Weg von Elten nach Emmerich, ungefähr zehn Kilometer, deutlich schneller zurückgelegt werden konnte. Hier kommt Berthas Bude ins Spiel. Im Garten eines Kumpels stand ein überdachter Pavillon, den wir nach unserem Geschmack gestalteten: Fünf mal fünf Meter, eine vollkommen verdreckte und runtergekommene Couch, ein Nintendo 64 und eine Shisha. Wir fühlten uns sehr cool. Streichen wir das: Wir waren sehr cool.
Wir trafen uns jeden Tag dort, quatschten dummes Zeug, und machten irgendeinen Unsinn. Am Wochenende wurde meistens gescheppert. Auf dem Heimweg nach dem Saufen bauten wir meistens noch Scheiß. Wir hatten sogar einen Namen für diese Abende. Achtung, jetzt wird es kreativ: „Night“. Absolut pubertär, sinnlos und destruktiv, aber damals fühlten wir uns unverwundbar. Eine ziemlich asoziale Phase, über die ich lieber schweigen würde. Aber sie gehört halt auch zu mir.
Das war auch auf der Realschule nicht anders. Eigentlich war ich ein guter Schüler, aber eben auch ein pubertierender Teenager. Bei jedem Elternsprechtag bekam Mama den gleichen Satz zu hören: „Ja, ihr Sohn ist ein sehr guter Schüler … Wären die Nachbartische nur nicht immer so interessant.“ Ich war pausenlos damit beschäftigt, irgendwelche Witze zu reißen und andere vollzuquatschen. Das Potenzial zu mehr war durchaus vorhanden, aber auf dem Zeugnis haben sich meine eigentlichen Fähigkeiten durch die ganze Rumalberei nicht widergespiegelt. Keine Chance.
Viel schlimmer war jedoch, dass ich auch ein ziemliches Arschloch war. Vermutlich hat jeder schon mal Erfahrungen mit Mobbing gesammelt, ob auf der einen oder der anderen Seite. Wenn man derjenige ist, der aktiv mobbt, begreift man zunächst gar nicht, wie mies man sich verhält. Es gab einen Mitschüler, der nicht verstehen wollte, dass er nicht zu unserer Gruppe gehörte. Er suchte nach Anerkennung und fand es total cool, wenn ich mit ihm sprach. Ich meinte es allerdings nur sarkastisch. Wir feierten uns dafür, dass er immer wieder ankam und über unsere Witze lachte, obwohl wir ihn einfach nur fertigmachten.
Was für Helden, scheußlich.
Falls sich jemand angesprochen fühlt, der das liest: Es tut mir leid. Ich war ein Vollidiot, der es nicht besser wusste. Ich könnte mich dafür ohrfeigen, dich so behandelt zu haben. Und versteht das ruhig als Appell: Jeder Teenager durchlebt mal eine schlechte Phase, aber lasst das nicht an anderen aus. Glaubt mir, es verfolgt euch. Vor allem aber verfolgt es die Gemobbten ein Leben lang. Gerade in der Teenie-Phase sind wir sehr labil, und Ereignisse, die dort geschehen, prägen uns oft für unser ganzes Leben. Es gibt kaum etwas Scheußlicheres als Mobbing. Jeder Mensch ist anders, und das ist auch gut so. Vielfalt macht das Leben doch erst besonders. Und nur, weil jemand nicht der Norm entspricht, weil er anders aussieht oder sich anders verhält, darf er dafür nicht niedergemacht werden. Und wer entscheidet überhaupt, was die Norm ist? Das ist falsch und vor allem feige, weil sich dieser Jemand meist schon ausgegrenzt und alleine fühlt und keine Chance hat, sich zu verteidigen. Vielleicht merkt man in dem Moment nicht, was man dem anderen damit antut, aber glaubt mir eines: Mit jedem blöden Spruch von euch zerbricht was bei demjenigen, der gemobbt wird! Das versteht man leider oft erst zu spät.
Es gab in dieser Zeit einige Momente, für die ich mir heute, freundlich ausgedrückt, einfach nur an den Kopf packen möchte. Was hat mich damals nur manchmal geritten? Zum Beispiel bei der Schneeballgeschichte. Eines schönen Wintertages stiegen wir – Lennart, Jannik und ich – aus dem Bus aus und wollten gerade den circa fünf Minuten langen Gehweg zur Realschule antreten. Es gab da einen Typen, der oft unseren Weg kreuzte, weil er von da aus zur Hauptschule lief. Er war groß, kantig und hatte kurze Haare. An diesem Tag kam mir eine geniale Idee: „Ey Jungs, den werfe ich ab!“ Ich konnte ja nicht damit rechnen, ihn zu treffen, doch mein viel zu harter Schneeball landete mitten in seinem Gesicht. Patsch. Der Kerl warf seinen Tornister zur Seite und rannte direkt auf uns zu. Wir sprinteten davon, ins Hauptgebäude und rechts um die Ecke in einen kleinen Raum. Jannik warf sich gegen die Tür und verteidigte sie mit seinem Leben. Wäre der Kerl da reingekommen, hätte er uns windelweich geschlagen. Ich habe fast geheult, weil ich so eine Angst hatte. Jannik, ich bin dir noch heute dankbar, dass du diese Tür verteidigt hast. Den nächsten Monat liefen wir einen riesengroßen Umweg, um diesem Kerl bloß nicht in die Arme zu laufen. Selbst der Teenager-Robin begriff durch die Aktion, dass man ab und zu tatsächlich mal nachdenken sollte, bevor man irgendeine Scheiße fabriziert. Und dass man Respekt vor gewissen Leuten haben muss.
Meine coole Fassade bröckelte, sobald ich mich mit Anne traf. Das erste Mal verabredeten wir uns ganz standesgemäß im Kino. Kurz reden, Film gucken, wieder reden und mit etwas Glück ein Abschiedsschmatzer. Viel mehr muss es am Anfang auch gar nicht sein.
Vor unserem Kino in Emmerich gibt es einen kleinen Park. Anne und ich wollten dort erst ein bisschen rumspazieren und dann ins Kino gehen. Wir stellten uns das romantisch vor und versuchten, die Hand des anderen zu ergreifen. Ohne Erfolg. Ein absolutes Desaster, voll peinlich. Und das war es dann auch wieder mit Anne.
Wenigstens die Fußballlaufbahn nahm mit 16 langsam Fahrt auf, obwohl wir eigentlich vor jedem Spiel ein Glas zu viel tranken. Auf dem Geburtstag der Schwester eines Freundes passierte es, dass ich das erste Mal von Alkohol abschmierte. Da gab es das harte Zeug, Bacardi und so. Ich konnte mich am nächsten Tag an so gut wie nichts erinnern und musste meinen Eltern gestehen, dass ich offenbar zu viel getrunken hatte. Ich wurde einfach ausgelacht. Sie hatten vermutlich nur auf den Moment gewartet, bis es endlich passierte. Nicht dass sie mich dafür bejubelten, sie hatten mir wohl einfach auf ihre Weise eine Lektion erteilen wollen.
In dieser Zeit wurde ich das erste Mal zur Kreisauswahl eingeladen. Dazu zählen jedes Jahr die besten 15 bis 20 Spieler des – richtig geraten – Kreises. In Duisburg-Wedau fand ein Turnier zwischen den besten Mannschaften des Niederrheins statt. Wer den Scouts dort auffällt, hat die Chance, in die Niederrheinauswahl berufen zu werden. Ich schaffte es als Einziger aus meinem Kreis und durfte zum Kaiserberg mitfahren. Auch da stellte ich mich offenbar sehr gut an, also gab es noch einen Lehrgang. Hätte ich den auch gepackt, wäre ich quasi kurz davor gewesen, in eine U-Nationalmannschaft des DFB berufen zu werden und einen Fuß in die Tür zum Profifußball zu bekommen. Natürlich hatte ich wie jedes Kind den Traum, irgendwann Fußballer zu werden und für Deutschland zu spielen. Aber wenn du mit 16 noch nie ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen hast, rechnest du dir nicht mehr die größten Chancen aus. So läuft das heute nun mal.
Kurz vor diesem Lehrgang wurde ich leider krank. Die Verantwortlichen sagten mir: „Kein Problem, dann bist du beim nächsten Mal dabei.“ Ich hörte nie wieder von ihnen. Nur weil ich krank gewesen war. Wie unfair das Fußballgeschäft doch ist, dachte ich mir. Der kurze Traum hatte sich ganz schnell wieder zerschlagen. Bis Borussia Dortmund kam. Aber die Geschichte erzähle ich in einem anderen Kapitel.
Nach der zehnten Klasse wechselte ich 2010 von der Realschule in Emmerich aufs Berufskolleg nach Wesel, um mein Abitur zu machen. Ohne eine Idee, was ich damit anfangen sollte. Wer weiß das schon in diesem Alter? Ich ging zum Glück nicht ganz alleine nach Wesel, das immerhin 30 Autominuten von Emmerich entfernt ist. Es gab da dieses eine Mädchen, das ich vorher schon ganz anziehend fand. Rabea. Sie war auf dem Gymnasium, wir sahen uns meistens an der Bushaltestelle. Sie musste nach Praest, ich nach Elten. Also die gleiche Richtung. Sie entschied sich zum Glück auch für das Berufskolleg in Wesel, und wir kamen in die gleiche Klasse. Es gab nur ein kleines Problem: Sie war bereits vergeben. Trotzdem hoffte ich natürlich, dass sie sich ein wenig für mich interessieren würde. Wir verstanden uns vom ersten Moment an richtig gut und wurden bald sehr gute Freunde. Das war vielleicht nicht genau das, was ich wollte, aber glaubt mir: Aus der „friendzone“ kommt man raus.
Vor dem Abschlussjahr überschlugen sich die Ereignisse. Könnt ihr euch noch an das A-Jugend-Spiel in Kleve erinnern, wo der Scout von Vitesse anwesend war? Nach reiflicher Überlegung hatte ich gemeinsam mit meinen Eltern entschieden, das Angebot, in die U19 von Vitesse Arnheim zu wechseln, anzunehmen. Zeitgleich besuchte ich allerdings die 13. Klasse. Mein Alltag sah nun so aus, dass ich zweimal in der Woche früher aus der Schule entlassen werden musste, um es rechtzeitig zum Training zu schaffen. Wir hatten meistens sechs, an zwei Tagen in der Woche aber auch acht Stunden Unterricht. Die konnte ich nicht wahrnehmen. Von Wesel nach Arnheim waren es anderthalb Stunden Fahrt, und das Training startete pünktlich um 15.30 Uhr.
Den fehlenden Lehrstoff musste ich natürlich irgendwie nachholen. Meine Mutter war skeptisch: „Willst du dein Abitur aufs Spiel setzen, damit du irgendwo in der A-Jugend spielen kannst? Du weißt doch gar nicht, was daraus werden kann.“ Auf der anderen Seite mein Vater: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Der Traum vom Profifußball war vielleicht mit den Jahren immer kleiner geworden, im Hinterkopf aber schon noch existent.
Bei Vitesse waren die Trainer ganz zufrieden mit mir, und weil ich in dem Jahr auch noch direkt zur U21 hochgezogen wurde und manchmal sogar morgens trainieren musste, stand bald ein Besuch beim Schuldirektor an. Wir versuchten, eine Lösung für alle Parteien zu finden. Die Schule wollte mir den Weg zum Profifußball nicht verbauen, auf der anderen Seite konnte ich im Abiturjahr nicht pausenlos Unterricht sausen lassen. Und zwischen all diesem Schul-Fußball-Autobahn-Stress gab es ja auch noch Rabea, die sich gerade von ihrem Freund getrennt hatte.
Wir blieben erst mal nur Freunde, erzählten uns jeden Scheiß, telefonierten ständig und lernten zusammen. Manchmal knisterte es, aber das schoben wir aufs Kaminholz. Irgendwann war allerdings der Punkt erreicht, an dem wir beide wussten, dass da schon ein bisschen mehr war als Freundschaft. Am Silvesterabend 2012 waren wir auf einer privaten Feier eingeladen. Vorher traf ich mich mit ein paar Kumpels bei mir, Rabea war mit ihren Freundinnen zusammen. Meinen Eltern hatte ich versprechen müssen, mich zu benehmen, und kam auf der Party komplett nüchtern an. Das ist bis heute aber meine letzte Erinnerung an diesen Abend. Keine Ahnung, was genau passierte, ich vermute, irgendwer mischte mir K.-o.-Tropfen ins Glas. Der nächste Morgen war die Hölle. Seelenkater. Wenn es einem körperlich schlecht geht und der Kopf gleichzeitig sagt, dass man was ziemlich Dummes getan haben muss, ohne sich genau erinnern zu können. Ein Blick auf mein Handy bestätigte meine schlimmsten Befürchtungen. Zig Nachrichten von Freunden ploppten auf: „Was fällt dir ein?“ „Wie kannst du mich so behandeln?“
Offenbar hatte ich am Vorabend alles und jeden beleidigt und aufs Übelste randaliert, Toilettentüren auseinandergenommen, meine besten Freunde beschimpft, alle vor den Kopf gestoßen. Rabea war anscheinend die Einzige gewesen, die mich beruhigen konnte. Spätestens da dämmerte mir, dass ich mich verliebt hatte. Es dauerte noch zwei Monate, aber nach Karneval 2013 kamen wir endlich zusammen. Eine Teenager-Romanze mit Happy End, wie schön.
Schließlich fand ich auch einen Weg, Fußball und Schule unter einen Hut zu bekommen. Und kann von Glück reden, dass mich dabei niemand erwischt hat. Ich war im Sommer 2012 gerade 18 geworden und fuhr deshalb selbst zum Training nach Arnheim. Meine Eltern hatten mir zum Geburtstag einen riesigen Fiat Idea geschenkt. Auf dem Weg zurück von Arnheim breitete ich meine Schulsachen meistens auf dem Lenkrad aus, weil ich im Feierabendverkehr eigentlich immer mit Stau auf der A3 rechnen durfte. Manchmal sah ich mich um und die verzweifelten Gesichter derjenigen, die wahrscheinlich von der Arbeit kamen und einfach nur ihre Kinder sehen wollten, während ich im Grunde drei Kreuze machte, dass der Verkehr stehen blieb. Not macht eben erfinderisch.
Wenn also am Mittwochmorgen um 8 Uhr die Biologie-Klausur anstand, lernte ich dafür am Dienstagabend auf der Autobahn. Da fühlte ich mich ausnahmsweise auch ein wenig wie ein Internatsschüler, es gab halt nur Schule und Training für mich. Aber es klappte. Bio- und Sport-Leistungskurs waren wie für mich gemacht, dazu kam Deutsch als drittes und Pädagogik als viertes Abiturfach. Abitur-Note: 2,0. Nur die Abschlussfeier mussten wir sausen lassen, weil Peter Bosz, Trainer der ersten Mannschaft von Vitesse Arnheim, mich mit ins Sommer-Trainingslager nehmen wollte.
„Ich kann für dich keine Ausnahme machen.“
Ich hatte keine Wahl.