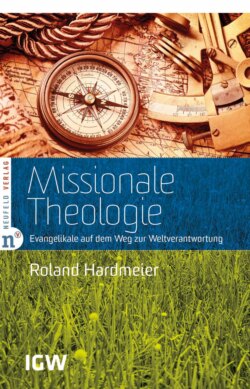Читать книгу Missionale Theologie - Roland Hardmeier - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mission im Wandel
ОглавлениеDie protestantische Mission blickt auf ein Jahrhundert dramatischen Wandels zurück. Die erste ökumenische Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 löste eine enorme missionarische Begeisterung aus. Man ließ sich in die Verantwortung nehmen, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen, und sprach von einem „Wendepunkt in der Geschichte“, der „zu den größten Jahren in der Geschichte des Christentums“ führen könnte, wenn sie recht genutzt würden.4 50 Jahre später hatte sich die protestantische Mission zu einem humanistischen Unternehmen gewandelt, in welchem persönliche Evangelisation nur noch eine Randerscheinung war. In einer von Armut und Ungerechtigkeit zerrissenen Welt wollte man nicht mehr bloß das Evangelium verkünden, sondern zu sozialem Wandel und politischer Befreiung beitragen.
Angesichts der liberalen Einflüsse schieden die evangelikalen Kräfte in den 1960er-Jahren aus der ökumenischen Bewegung aus und begannen, eigene Missionskonferenzen abzuhalten. Doch auch hier klopften die Nöte der Gegenwart hartnäckig an die Tür und erzwangen einen Wandel. Das zeigen schon die verwendeten Schlagwörter. In den 1970er-Jahren war die Rede von der „sozialen Verantwortung“. Intensiv wurde darüber diskutiert, welchen Platz diese im Sendungsauftrag der Kirche hat. In den 1980er-Jahren war dann die Rede von der „Transformation der Gesellschaft“, auf welche die Kirche hinwirken sollte. Mit diesem Begriff wurde zum Ausdruck gebracht, dass Christen sich für die Umwandlung (Transformation) der gesellschaftlichen Strukturen engagieren sollten. Aus dieser Diskussion entwickelte sich in den 1990er-Jahren der Gedanke eines „ganzheitlichen Missionsverständnisses“, das auch als „integral“ bezeichnet wird. Es besagt, dass die Kirche die Aufgabe hat, sich sowohl für die Verbreitung des Evangeliums als auch für die Veränderung der Welt einzusetzen. Seit der Jahrtausendwende setzt sich im deutschsprachigen Europa immer mehr der Begriff „missional“ durch. Er wird vor allem in Bezug auf den Gemeindebau verwendet, scheint sich allerdings als Überbegriff für einen ganzheitlichen Sendungsauftrag zu etablieren.
Der Begriff „missional“ stammt aus dem Englischen und bedeutete ursprünglich dasselbe wie „missionarisch“. Älteste Belege gehen bis in das 19. Jahrhundert zurück.5 Nach Reppenhagen wurde der Begriff „missional“ in den 1970er-Jahren zum ersten Mal für die Beschreibung des missionarischen Wesens der Kirche verwendet.6 Reimer führt die heutige Bedeutung des Begriffs auf das Konzept der „Missio Dei“ auf der ökumenischen Weltmissionskonferenz in Willingen (1952) zurück, wo die Kirche von ihrem Wesen her als missionarisch verstanden wurde.7 In den 1980er- und 90er-Jahren begann sich der Begriff als Ausdruck eines Paradigmenwechsels von der sendenden zur gesandten Kirche zu etablieren.8 Schließlich brachte die Veröffentlichung des Buches Missional Church. A Vision for the Sending of the Church in North America (1998) den Durchbruch für den Begriff.
Verschiedene Theologen werden mit dem Begriff „missional“ in Verbindung gebracht. Die meisten Befürworter einer missionalen Theologie nennen als Anreger den britischen Missionar und Missionswissenschaftler Lesslie Newbigin und den südafrikanischen Missiologen David Bosch. Ihr Beitrag zur Entstehung missionalen Denkens werde ich in Teil 4 ausführlich würdigen. Zu nennen wäre auch der nordamerikanische Mennonit John Howard Yoder, dessen Ekklesiologie missional war, bevor der Begriff gebräuchlich wurde, und der die Evangelikalen maßgeblich in Richtung einer missionalen Theologie beeinflusste.9 In Deutschland ist der Missionswissenschaftler und Gemeindegründer Johannes Reimer der profilierteste Vertreter.