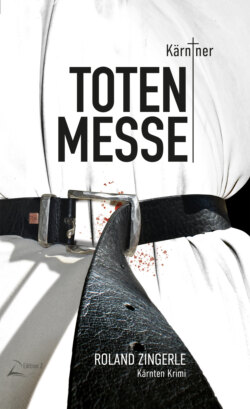Читать книгу Kärntner Totenmesse - Roland Zingerle - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 4
Donnerstag, 15 Uhr
„Frau Chefinspektorin?“
Sabine, die gerade das Café betreten wollte, fuhr herum. An einem der Straßentische des Lokals saß eine schlanke Frau Anfang dreißig, die sie mit großen, dunklen, unsicheren Augen ansah.
Margot Teppan hatte Sabine angerufen und darum gebeten, sie in einem Kaffeehaus zu treffen, nicht, wie ursprünglich vereinbart, bei sich zuhause. Eine Zigarettenschachtel samt Feuerzeug machten Sabine klar, warum sie den Tisch im Freien gewählt hatte, das würde die Unterhaltung allerdings erschweren, denn die stark befahrene Sankt-Veiter-Straße war nur eine Gehsteig- und eine Parkstreifenbreite entfernt.
Die beiden Frauen begrüßten sich und Sabine nahm Platz. Frau Teppan trug ein leichtes, lilafarbenes Alltagskostüm, das billig wirkte. Ihre schimmernden, dunkelbraunen Haare breiteten sich über ihre Schultern, und ihre schmalen Lippen waren in einem rosaroten Farbton dezent geschminkt. Sie war attraktiv und wirkte gepflegt, doch alles an ihr – ihr Gesichtsausdruck, ihre Frisur, ihre Kleidung – wirkte irgendwie fahrig, hektisch. So auch die Bewegungen ihrer Hände, als sie eine Zigarette aus der Packung schüttelte, zum Mund führte und anzündete. Der erste, tiefe Zug schien sie etwas zu entspannen.
„Danke, dass wir uns hier treffen können“, begann sie, „mein Mann ist nicht gut beieinander. Der viele Alkohol gestern ... er ist das nicht gewöhnt.“
„Warum hat er sich betrunken?“
Margot Teppan zuckte so stark zusammen, dass ihr beinahe die Zigarette aus den schlanken Fingern fiel. Sie nahm einen Zug, streifte die nicht vorhandene Asche ab, blies den Rauch aus – spielte auf Zeit. „Er hat ...“, begann sie schließlich, „in den vergangenen Jahren schrecklich viele Rückschläge erlitten, beruflich. Alkohol war aber noch nie ein Thema.“
Sabine wollte fragen, was denn gestern anders gewesen sei als bisher, entschied sich dann aber für eine etwas weniger direkte Vorgehensweise, um Margot Teppan nicht vollends zu verschrecken. „Was waren das für Rückschläge?“
Die Gefragte zog wieder an der Zigarette, streifte die Asche ab, blies den Rauch aus. „Wir haben ... er hat eine Druckerei geführt, in Köttmannsdorf. Von seinem Papa geerbt. Die ist pleite gegangen.“
Die Chefinspektorin musterte die Frau. Offenbar traute sie sich noch nicht aus sich heraus, Sabine musste irgendwie ihren Redefluss in Gang bringen. „Haben Sie Landesrat Rudi Moritsch gekannt?“
Margot Teppan nickte.
„Seit wann?“
Sie vollzog wieder ihr Ritual, ehe sie begann. „Seit vielen Jahren. Rudi und ich sind damals der Kärntner Jugend beigetreten, da war ich siebzehn Jahre alt.“ Ein Lächeln flog wie ein Schatten über ihr Gesicht und verzauberte es für die Dauer eines Herzschlags. „Rudi war achtzehn.“
„Die Kärntner Jugend? Was ist das?“, unterbrach Sabine.
„Das ist ... die Jugendorganisation von Rudis Partei. Wir waren eine Menge junge Leute, damals. War eine schöne Zeit.“
„War Ihr Mann auch Mitglied?“
Frau Teppan blickte ihr kurz in die Augen. „Ja, Fritz war der Obmann. Damals. Er ist ja um einiges älter als ich, zwölf Jahre.“
„Haben Sie sich gleich ineinander verliebt?“
„Nein, erst später, Jahre später. Damals war er für mich noch ein alter Mann.“ Ihr Grinsen wirkte unschuldig.
Sabine zwang sich zu einem Lächeln. „Sie haben sich noch die Hörner abstoßen müssen, stimmt’s?“
Margot Teppan lachte wie ein kleines Mädchen. „Ja, stimmt. Wir alle haben das in dem Alter, nicht wahr?“
Sabine nickte. „Junge Leute müssen so sein.“
„Ja, das müssen sie.“
„Rudi auch?“
„Ja“, lachte Frau Teppan, „mit Rudi war ich auch zusammen. Eigentlich öfters.“ Sie zog an der Zigarette, streifte die Asche ab, blies den Rauch aus. „Es war eine wilde Zeit.“
„Und wie haben Sie sich in Ihren Mann verliebt?“
„Jahre später, da war ich schon vierundzwanzig. Ich habe meinen Beruf gehabt und alleine gelebt. Da waren plötzlich andere Dinge wichtig, wie ein regelmäßiges Einkommen und überhaupt Stabilität. Fritz war mein Vorbild, weil er so solide war. Auf den hat man sich verlassen können.“ Sie lächelte. „Und er war in mich verliebt.“
„War er da noch immer Obmann der Kärntner Jugend?“
„Nein, da hat ihn Rudi schon abgelöst. Fritz hat mit der Kärntner Jugend nichts mehr zu tun gehabt, der war da schon Funktionär in der Landespartei.“
„Haben er und Rudi sich gut verstanden?“ Sabine beobachtete, wie Margot Teppans Augen dunkel wurden.
Sie schüttelte heftig den Kopf. „Nein, die beiden haben sich nie ausstehen können.“
„Wieso nicht?“
„Sie waren zu verschieden. Fritz war immer so gediegen, Rudi war mehr der Draufgängertyp. Außerdem hat Rudi alle geärgert. Er war ein schlimmer Finger.“ Diesmal war ihr Lächeln halbherzig.
„Haben Sie eine Ahnung warum?“
„Er war ein bisschen verzogen. Seine Mutter war ja die Landesrätin, eine echte Respektsperson in der Partei. Wenn die was gesagt hat, dann haben alle folgen müssen, ohne Widerrede.“
„Und Rudi hat das ausgenützt?“
„Er hat es versucht. Aber Fritz hat ihm das nie durchgehen lassen.“
„Wie kann ich mir das vorstellen?“
Margot Teppan drückte die Zigarette im Aschenbecher aus. „Er hat ihn behandelt wie ein Muttersöhnchen. Am Anfang, jedenfalls. Später dann sind sie regelmäßig zusammengekracht. Da sind die Fetzen geflogen!“
„Ist es da auch zu Handgreiflichkeiten gekommen?“
„Immer wieder, ja. Aber nichts Ernstes.“
„Und als Rudi älter geworden ist, hat sich das nicht gebessert?“
„Nein. Rudi hat so eine Art gehabt ... sobald er herausgefunden hat, wo jemand seinen wunden Punkt hat, hat er mit Genuss genau dort hineingedrückt. Wissen Sie, was ich meine?“
„Sie haben ihn aber trotzdem gemocht?“
„Ja, bei den Mädels, da war er anders. Außer, wenn er eine nicht hat ausstehen können.“
Eine ältere, verbraucht aussehende Kellnerin mit einem Outfit, für das sie um Jahrzehnte zu alt wirkte, kam und nahm die Bestellung auf. Beide Frauen orderten Kaffee.
„Wie ist es dann weitergegangen“, nahm Sabine den Faden wieder auf, „Sie und Fritz haben geheiratet?“
„Ja, in unserem dritten Jahr. Rudi ist damals Parteichef geworden und hat politisch Karriere gemacht. Dank seiner Mama, natürlich.“
„War die damals politisch noch aktiv?“
„Gerade noch. Sie hat Rudi als ihren Nachfolger aufgebaut und sich dann zurückgezogen. Nach der Landtagswahl vor zwei Jahren ist er Landesrat geworden. Wir waren alle ganz stolz.“
Sabine sah Margot Teppan von unten her an. „Auch Ihr Mann?“
„Nein.“ Sie fingerte eine weitere Zigarette aus der Packung. „Er hat damals andere Sorgen gehabt. Unsere Druckerei ist nicht gut gegangen, er hat Konkurs anmelden müssen.“
„Im selben Jahr?“
„Vor zwei Jahren, ja.“ Wieder ihr Ritual. „Es war absehbar. Die Druckerei ... die ist nie wirklich gut gelaufen. Und dann noch die Konkurrenz aus dem Osten ... Rudi hat da gar nichts dafürkönnen.“
Sabine stutzte. „Hat ... hat Ihr Mann das behauptet?“
Margot Teppan nickte und sah die Chefinspektorin mit einem unbestimmbaren Blick an. „Rudi hat als Parteichef Einsparungen vornehmen müssen. Fritz hat das nicht verstehen wollen.“
Sabine war verwirrt. „Was hat das eine mit dem anderen zu tun?“
„Unsere Druckerei hat die ganzen Drucksorten für die Partei gemacht“, erklärte Margot Teppan, „und dann nicht mehr.“
Sabine verstand. Fritz Teppan hatte von der Partei gelebt, und Landesrat Moritsch hatte ihm den Geldhahn zugedreht. Frau Teppan glaubte, der Grund seien notwendige Einsparungen der Partei gewesen, ihr Ehemann hielt es für eine gegen ihn gerichtete Maßnahme. Sabine nahm sich vor herauszufinden, wer von den beiden recht hatte.
„Fritz ist ein guter Mann“, fuhr Margot Teppan in einem klagenden Ton fort, „aber er ist sehr empfindlich. Er braust schnell auf und ist danach nur schwer zu versöhnen. Und Rudi ... der hat nie nachgegeben, keinen Millimeter. Da war klar, dass sie aneinandergeraten.“
„Was meinen Sie damit?“
„Vergangenes Jahr, bei einer Parteisitzung ... da hat Fritz Rudi wieder einmal beschuldigt, dass er ihn in den Bankrott geschickt hat, und Rudi hat ihn provoziert und provoziert ... so lange, bis Fritz ihn geschlagen hat. Mit der Faust. Ins Gesicht.“ Sie widmete sich wieder ihrer Zigarette.
„Und dann?“, hakte Sabine vorsichtig nach.
„Rudi hat ... er hat Fritz ... er hat veranlasst, dass Fritz aus der Partei ausgeschlossen wird.“
Die Chefinspektorin sah Margot Teppan forschend an. Sie war sich sicher, dass noch mehr dahintersteckte, doch offensichtlich wollte die Frau nicht darüber reden. Sie beschloss, diese Information über einen Umweg aus ihr herauszubekommen, und zog ein paar Papierblätter aus der Umhängetasche, die sie mithatte. „Nach den gestrigen Ereignissen auf der Messe“, begann sie, „haben wir alle Anwesenden befragt, wer Landesrat Moritsch zuletzt gesehen hat. Dabei hat sich herausgestellt, dass er zuletzt mit einigen Ausstellern zusammengestanden ist. Diese haben ausgesagt, der Landesrat habe bei einem Streit mit Ihrem Mann, der zufällig vorbeigekommen ist, durchblicken lassen, er habe ein Verhältnis mit Ihnen.“
Margot Teppan war mit einem Mal wie versteinert, der aufsteigende Rauch ihrer Zigarette schien das einzig Lebendige an ihr zu sein.
Sabine beschloss, sie mit den Tatsachen zu konfrontieren. „Ich lese Ihnen jetzt das Streitgespräch zwischen Landesrat Moritsch und Ihrem Mann vor, wie es einer der Augenzeugen zu Protokoll gegeben hat:
Landesrat Moritsch: ‚Und, Fritz, gefällt’s dir auf der Messe?’
Fritz Teppan: ‚Halt’s Maul!’
Landesrat Moritsch: ‚Beleidigend auch noch? Sag lieber danke, dass ich dich nicht anzeige, sonst überlege ich es mir noch einmal.’
Fritz Teppan kam näher und starrte Landesrat Moritsch aggressiv an.
Landesrat Moritsch: ‚Sind wir schon wieder soweit? Ist in Ordnung, schlag zu! Aber dann kann dir deine Frau auch nicht mehr helfen.’
Fritz Teppan: ‚Was meinst du damit?’
Landesrat Moritsch: ‚Es war ja ganz nett, was sie auf meinem zurückgeklappten Beifahrersitz so alles draufgehabt hat, aber so gut, dass ich auf zwei Anzeigen verzichte, ist sie dann auch wieder nicht.’
Fritz Teppan ging schweigend davon.“ Sabine ließ die Blätter sinken und sah Margot Teppan fragend an.
Diese erwachte mit einem kurzen Kopfschütteln aus ihrer Erstarrung und rückte auf dem Stuhl herum, während ihre Blicke in der Gegend umherzuckten.
„Das ist“, sie räusperte sich, „das war typisch für Rudi. Er hat immer in den wunden Punkt hineingedrückt.“
„Hat er die Wahrheit gesagt?“
Margot Teppan drehte für lange Sekunden die Spitze ihrer Zigarette im Aschenbecher herum, dann sagte sie kleinlaut: „Nein.“
Donnerstag, 17 Uhr
Die große, schwere Holztür am Eingang zum Gebäude der Kärntner Landesregierung schwang mit einem Summen automatisch auf, so dass Heinz einen Schritt zurücktreten musste, um ihr auszuweichen. Er ging hinein und wandte sich an den Portier, der neugierig hinter einer großen Glasscheibe herausschaute, wer um diese Zeit noch kam. Als Heinz den Namen von Landesrat Moritschs Büroleiterin nannte, hellte sich sein Gesicht auf und er meinte, Frau Mühlwirth habe ihm den Besuch angekündigt. Er beschrieb den Weg, dann trat Heinz durch eine Glastür in das weitläufige Stiegenhaus. Jeder Schritt hallte, als er über die breite Treppe in den ersten Stock hinaufging. Auf halbem Weg blieb er stehen, hielt sich am Geländer fest und atmete einige Male schwer durch. Während er darauf wartete, dass sich sein Herzschlag verlangsamte, starrte er auf die breiten, flachen und tiefen Stufen vor sich. Er hatte einmal gelesen, dass man im 19. Jahrhundert, aus dem auch dieser Bau stammte, die Treppen öffentlicher Gebäude deshalb so gestaltet hatte, damit berittene Boten zu Pferd in die oberen Stockwerke gelangen konnten.
Der Bürotrakt des verstorbenen Landesrats nahm einen vollen Gebäudeflügel in Anspruch. Von einem L-förmigen Gang aus führten rechts und links Türen in Zimmer, deren Nummer und Funktion auf Tafeln vermerkt waren, die man neben dem Türstock an die Wand geschraubt hatte. Bei Büroräumen standen auch Namen, Titel und Funktionen der hier arbeitenden Personen darauf.
Heinz orientierte sich an den fortlaufenden Zimmernummern. Er fand die Tafel, nach der er Ausschau gehalten hatte, hinter dem Knick des Gang-Ls, klopfte an die Tür und trat ein. In einem erstaunlich kleinen und mit Akten- und Papierstapeln vollgestopften Büro saß an einem seitlich zum Eingang positionierten Schreibtisch eine Frau in einem mausgrauen Kostüm mit langem Rock, das, ebenso wie die farblich dazu passenden niederen Pumps, Heinz stark an die Mode der frühen Neunzehnhundertachtzigerjahre erinnerte. Ihre grauen Haare hatte die Frau zu einem Dutt zusammengebunden und knapp ober der Spitze ihrer Nase klammerte sich eine Brille mit kleinen runden Gläsern fest. Über diese hinweg blickten Heinz zwei müde, aber neugierige Augen an.
„Jaaa?“
„Grüß Gott, mein Name ist Sablatnig.“
„Ah, Herr Sablatnig.“ Mit fast jugendlicher Leichtigkeit schwang die Frau auf ihrem Drehstuhl herum, sprang auf und kam ihm entgegen. „Angenehm, Mühlwirth, freut mich.“ Der Druck ihrer Hand war kräftig.
Heinz bemerkte, dass die Frau nicht so alt war, wie ihr Äußeres vermuten ließ, sie mochte Mitte oder Ende fünfzig sein, nicht mehr.
„Wie kommt es, dass Sie heute arbeiten? Ich meine, am Tag nach ...“ Heinz ließ den Satz in der Luft hängen.
Ein Seufzen, das aus den Tiefen ihrer Seele zu kommen schien, entrang sich ihrer Kehle. „Jemand muss das Rad am Laufen halten, bis die Nachfolge geklärt ist.“ Die Büroleiterin zwang sich zu einem Lächeln, das jedoch traurig ausfiel. „Das Leben geht weiter, wissen Sie?“
Und wie Heinz das wusste!
„Bitte kommen Sie hier herein.“ Waltraud Mühlwirth trat zu einer Seitentür und ging voran in ein Büro, welches das krasse Gegenteil von jenem zu sein schien, aus dem sie kamen. Der Raum war geräumig und hell, ein großer Schreibtisch mit einem wuchtigen Lederstuhl stand am Fenster, die andere Raumhälfte wurde von einem Besuchertisch samt Sesseln dominiert. „Nehmen Sie Platz“, sagte die Büroleiterin, während sie die Sitzgruppe umrundete und zu einem niederen Schrank ging, auf dem Kaltgetränke, eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher, Gläser und Kaffeegeschirr sowie Teebeutel und Zuckerpäckchen Platz fanden.
Heinz ließ sich nieder und sah sich um. Die Wände waren mit modernen, farbenfrohen Kunstwerken behängt, in den Ecken standen schmale Büroschränke. Waltraud Mühlwirth stellte ungefragt ein Wasserglas vor ihn hin sowie eine kleine Glasflasche mit stillem Wasser mit Apfel-Rosengeschmack, die sie sogleich öffnete. Es wirkte wie eine automatische Bewegung.
„Ist das hier ...?“
„Rudis Büro.“ Frau Mühlwirth nickte. „Das heißt, jetzt natürlich Ex-Büro.“ Sie griff hinter sich und zauberte eine Glasschüssel mit Gummibärchen auf den Tisch. „Die hat er so gerne gehabt.“ Ihre Stimme erstickte, aber nur kurz. Sie setzte sich Heinz gegenüber. „Sie müssen wissen, dass dies hier auch das Büro seiner Mutter gewesen ist, als sie Landesrätin war. Dazwischen waren freilich ein paar andere Landesräte hier, aber nach dem letzten Regierungswechsel habe ich mein Büro wieder gleich eingerichtet wie damals. Es kommt mir oft so vor, als wäre ich hier nie weggewesen.“
„Sie waren auch die Büroleiterin von Frau Doktor Moritsch?“
„Ganz genau.“ Heinz vernahm den Stolz in ihrer Stimme. „Ich bin ein Teil dieser Kontinuität, wenn Sie so wollen.“
Heinz verstand nicht. „Welche Kontinuität meinen Sie?“
„Na, dass die Mutter dem Sohn den Stab weiterreicht, dass wir wieder in denselben Räumlichkeiten unterkommen, dass Rudi Maßnahmen wiederaufgenommen hat, die seine Mutter seinerzeit in die Wege geleitet hatte und so weiter.“
„Ach so?“ Heinz dachte an die herrische Liese Moritsch und fragte sich, inwieweit die Fortführung ihrer Maßnahmen die Idee ihres Sohnes gewesen sein mochte. „Welche Maßnahmen zum Beispiel?“
Waltraud Mühlwirth ließ sich nicht lange bitten. „Zum Beispiel das Programm Landeseigentum gegen Arbeitsplätze. Damit ist es seinerzeit schon ihr gelungen, aberhunderten Menschen Arbeit zu geben, und Rudi war auf dem besten Weg, sie noch zu übertrumpfen.“
„Davon habe ich gelesen“, hakte Heinz ein, „gibt es da eigentlich kein Problem, dass die Verkäufe immer über dieselbe Firma abgewickelt werden? Ich denke, Landesaufträge müssen immer ausgeschrieben werden.“
Die Büroleiterin schenkte Heinz einen vielsagenden Blick über die Ränder ihrer Brillengläser hinweg. „Offiziell schon. Aber wenn man so viele Jahre so gut mit einem Partner wie der Immosorg zusammenarbeitet, dann wäre es doch dumm, ihn zu wechseln. Und nachdem wir die Kriterien vorgeben, nach denen wir unsere Projektpartner suchen ...“
Sie ließ den Satz offen, doch Heinz wusste, was sie meinte. Es war ein offenes Geheimnis, dass in der öffentlichen Verwaltung die vom Gesetz verlangten Ausschreibungen so formuliert wurden, dass nur der Bewerber sie erfüllen konnte, für den man sich vorab schon entschieden hatte. Eines aber interessierte ihn. „Das heißt, Immosorg hat schon damals den Kauf und Weiterverkauf der Landesgrundstücke abgewickelt, als noch die Mutter von Herrn Moritsch Landesrätin war?“
„Ja, die hat das eingefädelt.“ Waltraud Mühlwirth nickte. „Sie hat ein ausgezeichnetes Verhältnis zum damaligen Chef Herrn Sorger gehabt. Er war auch der Gründer von Immosorg. Die jetzige Geschäftsführerin ist seine Nichte.“
Auch wenn er nicht sagen konnte warum, spürte Heinz, dass dies von großer Bedeutung für seine Ermittlungen war. Er hoffte inständig, dass er sich das alles merken würde, zumindest in den Grundzügen. „Sagen Sie, war da nicht auch die Rede von einem Kirchengrund und einem Altersheim?“
„Ja“, die Büroleiterin wurde schlagartig betont sachlich, „ja, ich weiß schon, was Sie irritiert, das ist auch den Medien so gegangen. Sie fragen sich, warum der Herr Landesrat zwischen der Immosorg und der Kirche vermittelt hat. Da waren die wildesten Spekulationen dabei, dass Rudi Schmiergelder kassiert hätte und so weiter, aber keiner hat das große Ganze gesehen, die Vision.“ Ihre Arme unterstrichen ihre Worte mit einer ausladenden Bewegung.
Heinz fühlte sich ertappt, denn auch er hatte angenommen, Landesrat Moritsch hätte eine Vermittlungsprovision kassiert – doch im nächsten Moment wurde ihm klar, dass diese Aussage von Frau Mühlwirth nichts weiter war, als ein rhetorischer Trick. Indem sie selbst den naheliegenden Verdacht aussprach, nahm sie ihm die Glaubwürdigkeit. Heinz war gespannt, welche Begründung sie nun vorbringen würde.
„Wenn man nämlich die Vision betrachtet“, fuhr die Büroleiterin fort, „erkennt man, wie sehr dieses Geschäft mit der Kirche das Gesamtprojekt abrundet. Denn worum geht es bei diesem Projekt? Es geht um eine Gesamtlösung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger Kärntens. Grundstücke, die dem Land Kärnten gehören, und damit den Bürgerinnen und Bürgern, werden verkauft und das Geld in Arbeitsplätze investiert. Im ersten Schritt profitieren nur wenige davon, das ist klar, aber insgesamt gesehen steigt mit dieser Maßnahme, wenn man sie konsequent durchführt, die Kaufkraft und damit, über den Wirtschaftskreislauf, der Wohlstand für alle. Das ist die Vision, und deshalb brauchen wir den Schulterschluss möglichst vieler Institutionen im Land. Wenn jeder einen Beitrag leistet, profitieren alle davon und das war es, wovon der Herr Landesrat den Herrn Magister Weißhaupt von der katholischen Kirche überzeugt hat, das war seine Vermittlungsleistung.“
„Aber was hat die Kirche davon?“, fragte Heinz.
Waltraud Mühlwirths Miene war wie versteinert. „Da haben wir es schon wieder, Sie verstehen mich nicht. Genauso wie die Medienvertreter. Noch einmal: Es geht hier nicht um Profit, es geht hier um das Wohl für alle Kärntnerinnen und Kärntner. Der Herr Landesrat hat den Herrn Magister Weißhaupt davon überzeugt, dass dieses Geschäft einem guten Zweck dient. Junge Menschen bekommen Arbeit und können ihre Familien ernähren, alte Menschen werden versorgt – das deckt sich mit den Kircheninteressen. Der günstige Verkaufspreis ist folglich eine Art Investment in die eigene, in die gute Sache. Und nebenbei bemerkt“, sie senkte ihre Stimme verschwörerisch, „haben wir etwas Glück gehabt. Die katholische Kirche hat das fragliche Grundstück erst vor Kurzem geerbt. Es ist viele Jahre lang brach gelegen und hätte erst für eine Menge Geld erschlossen werden müssen. Diese Kosten hat sich die Kirche mit dem Verkauf erspart, das relativiert das finanzielle Opfer nicht unwesentlich.“
Heinz war nicht hier, um über politische Vorgänge zu streiten, deshalb nickte er und lächelte, als würde er verstehen.
In Wahrheit glaubte er der Büroleiterin kein Wort. Die Erschließungskosten als Argument für einen Preisnachlass in Höhe von fünfhunderttausend Euro vorzubringen, das war, als würde man seinen Diskussionspartner für dumm verkaufen. In dieselbe Kategorie fiel die Mär von der Menschlichkeit in der Politik. Wann immer Heinz hörte, dass etwas „zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger“ geschah, wusste er, dass die damit gerechtfertigte Aktion in Wahrheit zum Wohle des jeweiligen Politikers oder dessen Partei in die Wege geleitet wurde. Und wenn es um Geld ging, dann war Menschlichkeit das Letzte, was eine Rolle spielte, egal, bei welcher Institution.
Dieses Wissen verdankte Heinz seinem Vater, der Zeit seines Lebens politisch tätig gewesen war, seit Jahrzehnten hauptberuflich. Allerdings hatte ihm sein Vater diese Dinge nicht beigebracht, sondern selbst immer wieder so argumentiert – Heinz hatte das im Laufe der Zeit durchschaut.
Aus diesem Grund klangen die Worte der Büroleiterin in Heinz’ Ohren hohl. Sie hatte sich wohl eine Argumentationskette zurechtgelegt, um Handlungsweisen zu begründen, die logisch nicht begründbar waren. Denn der einzige offensichtliche Nutznießer dieser Aktion war die Firma Immosorg, die von dem günstigen Kaufpreis profitierte.
Heinz fragte sich einmal mehr, welchen Vorteil das Land Kärnten und die katholische Kirche aus der Aktion zogen.
„Eigentlich bin ich ja gekommen, um mit Ihnen über das persönliche Umfeld von Landesrat Moritsch zu sprechen“, wechselte Heinz nun das Thema.
„Ja, ich weiß“, Waltraud Mühlwirth seufzte, „für uns alle ist der Mord unfassbar – und für seine Mutter unvorstellbar schrecklich. Sie will den Täter schnellstmöglich der Justiz übergeben.“ Es klang, als wäre dies die Aufgabe von Liese Moritsch. „Leider werde ich Ihnen nicht viel dabei helfen können.“
„Mir ist schon geholfen, wenn ich weiß, in welchen Kreisen sich der Herr Landesrat bewegt hat, welche Freunde und welche Feinde er ...“
„Sie haben mich falsch verstanden“, fiel die Büroleiterin Heinz ins Wort, „genau deswegen werde ich Ihnen nicht helfen können. Schauen Sie, Rudi war im Umgang mit Menschen nicht zimperlich. Oberflächlich war er lässig und mit allen gut Freund, aber sobald es nicht so gelaufen ist, wie er es wollte, war er der einzige Hecht im Teich. Mit anderen Worten, er hat gewusst, wie man sich Feinde, aber nicht, wie man sich Freunde macht. Soweit ich weiß, hat es in seinem Leben überhaupt nur einen Menschen gegeben, auf den die Bezeichnung Freund zutrifft.“
Sie stockte, so dass Heinz schließlich nachfragte: „Wen?“
Zum ersten Mal im Gespräch wirkte Waltraud Mühlwirth verunsichert. „Sie müssen mir versprechen, dass das, was ich Ihnen jetzt sage, unter uns bleibt. Ich meine natürlich, abseits Ihrer Ermittlungen.“
„Versprochen.“
„Kennen Sie das Lokal Der Ständer?“