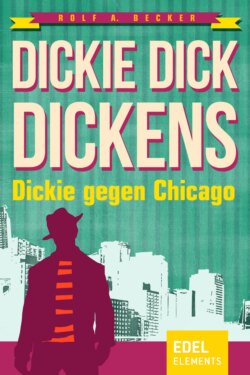Читать книгу Dickie Dick Dickens – Dickie gegen Chicago - Rolf A. Becker - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWALE UND KLEINE FISCHE
Der Morgen hellte durch die Gitter.
Licht fiel, in geraden, strengen Balken, ein Ballett sich ständig lösenden und wieder ballenden Staubes beleuchtend, durch das Fenster.
Den Flur entlang hallten Schritte. Schwer, hart. Knallend von Nägeln.
Der Gefängniswärter. Wie er das kannte!
Der Einsame in der Zelle stöhnte.
Doch dann vernahm sein Ohr Anderes, Sanfteres:
Schritte. Kurz, schnell, hackend ... Stakkato der Absätze. Schlüssel rasselten. Riegel krachten. Die Tür öffnete sich. Eine fette Stimme sagte: „So, da wären wir. Der Besucherraum wird gestrichen. Sie müssen ihn schon in der Zelle sehen, Madame.“
Der Mann sah auf. Sah sie an, die hereintrat.
Sie! Seine Frau. Die er seine Frau nennen wollte, und die es doch nicht sein durfte. Weil er Poltingbrook hieß. Weil der Mann, von dem er Namen und Papiere geliehen hatte, früher mal geheiratet hatte ...
Schon wieder diese Gedanken!
Nein, er musste sich zusammennehmen. Musste lächeln. Endlich war der Wärter draußen. Schloss ab. Baute sich vor der Tür auf.
Sie aber stand da und blinzelte in das Sonnenlicht.
„Tag, Schätzchen“, sagte er und lächelte tatsächlich. Sie küsste ihn hinters Ohr und setzte sich.
Dann fragte sie: „Wie geht es dir?“
Er sagte: „Schlecht.“
Sie nickte und sagte: „Mir auch.“
„Kopf hoch“, murmelte er, „Kopf hoch, Kindchen!“
Sie sah ihn aus wehen Augen an. „Das sagst du so. Du sitzt hier gemütlich im Gefängnis, du hast’s gut, dich ernährt der Staat, aber ich ...“
Dickie Dick Dickens lächelte. „Aber Effie, kleiner Wirrkopf“, flüsterte er und strich ihr über die blonden Haare, „vergisst du denn die Goldbarren vom Bankraub? Es sind ein paar hunderttausend Dollar auf der Farm von Opa Crackle. Ihr braucht nicht zu verhungern.“
Effie schüttelte den Kopf. Nein. Vom Hunger hatte sie nicht gesprochen. Es ging ihr um den Namen.
Um den Namen?
Ja, um ihren Namen. Ob Dick ihr sagen könne, wie sie hieße? Hieß sie Poltingbrook?
Nein. Mrs. Poltingbrook gab es irgendwo. Eine, die eine irische Fischertochter war und früher Margaret Stippling geheißen hatte.
„Aber wie heiße ich dann? Wer bin ich?“
„Na ja“, knurrte Dick, „natürlich bist du meine Frau ...“
„Dann heiße ich Dickens?“
Dick hielt ihr den Mund zu. Wenn das jemand hörte! Dickie Dick Dickens gab es nicht mehr! Er hieß jetzt Poltingbrook. Aber als Poltingbrook war er wegen Bigamie verhaftet. Also war seine Eheschließung mit Effie ungültig.
„Daher, mein Schatz, heißt du weiter Effie Marconi.“
„Nein“, widersetzte sich Effie bockig, „in Wahrheit warst du gar nicht verheiratet, als du mich zur Frau nahmst. Das war nämlich der wirkliche Mr. Poltingbrook. Also ist unsere Ehe doch nicht ungültig! Aber ich heiße weder Dickens noch Poltingbrook, noch Marconi ... ich bin das ärmste Geschöpf auf Erden ... ich besitze nicht einmal einen Namen! “
Sie weinte. Er schwieg. So war das also!
Schlüssel rasselten. Riegel krachten. Die Tür öffnete sich. Der Wärter kam herein.
„Die Besuchszeit ist um.“
Effie reichte Dick die Hand. Sah ihn aus kullerdummen Augen an. Dann gab sie ihm eine Mundharmonika mit den besten Grüßen von Opa Crackle.
Dick versprach, auf das Wohl des Alten zu spielen. Aufschluchzend verließ Effie die Zelle.
Und Dick blieb zurück. Allein mit seinen Gedanken. Einsam.
Nur seine kleine Mundharmonika war bei ihm.
Nicht nur Dick und Effie machten sich Sorgen um die neue Form ihres Daseins, sondern auch Dicks treue Mitarbeiter. Sie saßen in ‚Baby’s Bottle’, dem kleinen Vorstadtlokal, das einst dem Verbrecherfürsten Jim Cooper als Hochburg gedient hatte. Saßen da, starrten auf klebrige Marmortische und kreiselten mit ihren Whiskygläsern in kleinen Sodapfützen. Dickies väterlicher Freund Opa Crackle, der kleine, abergläubische Bonco und nicht zuletzt der vornehme Mister Josua Benedikt Streubenguß, Spezialist für Juwelenhehlerei.
Bei allem Wohlwollen für die Obrigkeit stellten sie fest, dass der augenblickliche Zustand unhaltbar sei: Jim Cooper, der einstige Gegner, tot - Dickie Dick Dickens im Gefängnis ...
„Ich bitte Sie“, sagte Josua Benedikt mit samtener Stimme, „wo soll das hinführen?“
„Die ganze Unterwelt droht zu verschlampen“, meinte Opa Crackle und klirrte mit den Eiswürfeln in seinem Glas. „Kein Mensch versteht, einen nur mittelschweren Einbruch zu organisieren! Sie werden es noch merken, meine Herren
- wir gehen schweren Zeiten entgegen!“
Streubenguß nickte. „Was wir brauchen“, sagte er, „ist ein Organisator. Ein Führer!“ Dabei sah er Crackle bedeutend an.
Doch der winkte ab. „Nein, nein, mein Lieber! Ich bin nicht mehr rüstig genug, eine Gangsterbande aufzubauen. Und Sie, lieber Streubenguß, mögen ein guter Hehler sein, doch verfügen Sie nicht über das geringste Talent zur Truppenführung. Und was Bonco anbelangt ...“
Opa Crackle sprach nicht weiter.
Der Gedanke an eigene Verantwortung schien Bonco derart abscheulich, dass er laut erklärte, lieber ehrlich werden zu wollen als selbst denken zu müssen. Und verträumt umkränzte er seine Rede mit einem klugen Spruch:
„Schließt eine Ehe du um neun,
wirst du niemals dies bereu’n.
Doch heiratest du erst um zehn,
möcht’ ich nicht aufs Ende sehn.“
Womit er zweifellos auf Dickies missglückte Heirat mit Effie anspielte.
Opa Crackle, um Aufheiterung der allgemeinen Stimmung bemüht, krähte fröhlich: „Vorläufig haben wir noch dreihunderttausend in Goldbarren!“
Josua Benedikt Streubenguß sah ihn vernichtend an. „Goldbarren, mein Teuerster, Goldbarren!!“
Opa Crackle ließ sich nicht einschüchtern. „Besser kann man sein Geld doch gar nicht anlegen.“
Josua Benedikt dachte, dass es nicht verkehrt sein könne, allzu naive Leute gelegentlich zu vergiften, zeigte jedoch seinen Unwillen nicht. Im Gegenteil. Höflich wie stets belehrte er den Alten: „Das gilt für normale Zeiten, mein Lieber. Im Augenblick weiß ich wirklich nicht, wie ich die Goldbarren absetzen soll. Es herrscht in der gesamten Unterwelt eine phänomenale Unsicherheit. Man muss jederzeit der Tatsache gewärtig sein, dass der angesehenste Regierungsbeamte, der gestern noch bestechlich war, plötzlich auf der Seite des Rechts steht.“
„Unerhört!“, schrie Opa Crackle.
Bonco schüttelte sein Haupt wie ein Uhrpendel und lispelte: „Und der Mann, der uns helfen könnte, sitzt im Gefängnis. Wegen Bigamie!!“
Josua sandte ihm einen anerkennenden Blick über die Marmorplatte, zum Zeichen, dass er in Boncos Hirn Spurenelemente von Verstand zu erkennen glaubte.
„Das ist ja das Schlimmste“, sagte er. „Säße er wegen Mordverdachts, Rauschgifthandels, Korruption oder Totschlags - ja, dann könnte ich ihn gegen eine geringe Kaution wieder freibekommen. Aber Bigamie? Sie wissen doch, wie peinlich genau unser Staat in Dingen der Moral ist! Dickie lassen sie nicht eher aus dem Gefängnis, bis seine Familienverhältnisse geklärt sind.“
Schweigen folgte diesen Worten.
„ Ja“, murmelte Crackle, „die Gesetze in unserem Lande sind hart.“
„Wir müssten also“, sagte Bonco und betrachtete nachdenklich seine wohlmanikürten Fingernägel, „feststellen, was aus der ersten Mrs. Poltingbrook geworden ist.“
Josua spielte mit seinem goldenen Zigarettenetui. „Viel ist es nicht, was wir wissen“, meinte er. „Eine geborene Stippling, Fischertochter, dreizehn Jahre älter als er.“
Bonco wand sich vor Entsetzen, als er die Zahl dreizehn hörte. Doch dann raffte er sich zu Taten auf. „Wir müssen sie kaufen!“ sagte er. „Vielleicht lässt sie sich ja scheiden.“
Opa Crackle gab seinen letzten Kuchenzahn zur Besichtigung frei, was als Lächeln gewertet werden sollte.
„Vielleicht ist sie ja auch schon längst tot“, mümmelte er.
„Tot?“ säuselte Bonco entzückt. „Natürlich! Welche Idee“
„Wir wollen sie suchen“, meinte Josua Benedikt sachlich.
Dann erhoben sich alle und verließen ‚Baby’s Bottle’. Draußen stieß Bonco Opa Crackle in die Seite.
„Tot!“ sagte er kichernd. „Opa - du bist süß!“
So trübselig, wie die Stimmung unter den Mitarbeitern und Freunden Dickie Dick Dickens’ an jenem Nachmittag auch war, solch starken Trübsinns hätte es nicht bedurft.
Erstaunlicherweise gab es noch eine zweite Interessengruppe, die sich für die Familienverhältnisse von Dickie Dick Dickens interessierte.
Zur gleichen Zeit, da die Freunde in ‚Baby’s Bottle’ saßen, erhielt Dickie den Besuch einer gewissen Mrs. Edwina Shrewshobber3, ihres Zeichens ehrenamtliche Vorsitzende der Vereinigten Chicagoer Frauenverbände. Die Dame war offensichtlich bereits von Geburt an in Übergröße hergestellt und mit den Bewegungen eines sechzehnarmigen Meeresungeheuers ausgestattet. Ihrem Sinn für das Zierliche gab sie in ihrer Kleidung durch anmutige Rüschen, Blumenmuster und einer Unzahl bezogener Knöpfe zum Ausdruck. Wenn sie sprach, war man unwillkürlich versucht, sich die Ohren zuzuhalten. Die Herzlichkeit, mit der sich Mrs. Edwina Shrewshobber auf Dicks Hände stürzte und dieselben schüttelte, als wären es Rumbakugeln, hatte viel von einem Naturereignis an sich.
„Oh, Mr. Poltingbrook“, dröhnte es in Dickies Ohr, „denken Sie nicht, dass wir uns in fremde Angelegenheiten einmischen wollen, doch wenn wir die Möglichkeit sehen, einem armen Verirrten unsere helfenden Hände zu leihen, so zögern wir keinen Augenblick und sind - eine Feuerwehr des guten Willens - zur Stelle!“
Dick wünschte, sie würde ihre helfenden Hände dazu benutzen, jemand anderem die Arme abzureißen als ihm.
Sie sagte allerlei vom „rechten Scherz zur rechten Stunde“, vom „kleinen Schelm im Nacken“ und was alles verstockte Seelen lösen könne. Am Ende ermunterte sie Dick, sein Herz einmal kräftig auszuschütten.
Dick, der sich wunderte, dass die statischen Verhältnisse des Gefängnisgebäudes dem Gedröhn der Dame Shrewshobber standhielten, nickte freundlich. „Ja“, sagte er sanft, „und nun scheren Sie sich bitte zum Teufel!“
Anscheinend wusste sie die Adresse nicht, denn sie blieb. Blieb und lachte.
Das war entschieden das Entsetzlichste, was an Phonstärke aus Damenbrustkörben hervorquellen konnte. „Oh, hadern Sie nicht mit Ihrem Geschick!“ sagte sie und wedelte mit ihrem Zeigefinger. „Wir sind ja da, wir helfen! Die Feuerwehr des guten Willens, haha! Ein jeder weicht einmal vom rechten Wege ab, Mr. Poltingbrook. Sie brauchen sich deshalb nicht zu schämen. Wenn man nur seinen Fehler einsieht und auf die Hilfe der Mitmenschen vertraut!“
Eine Stunde lang vermochte Dickie Dick Dickens, dem hilfsbereiten Ansturm von Mrs. Edwina Shrewshobbers Frohnatur standzuhalten. Dann aber gab er allen Widerstand auf.
„Gut“, sagte er ermattet, „ich verspreche, mich zu bessern, in mich zu gehen, werde versuchen, ein guter Mann zu werden ... ganz wie Sie wünschen!“
„Und Sie werden ein fröhlicher Mensch werden“, trompetete Edwina, „frei von Zweifeln und Gewissensbissen. Sie werden ein ruhiges, friedliches Leben führen im Schoße Ihrer lieben Familie!“
„Im Schoße meiner lieben ... bitte, was?“ stotterte Dickie.
„Ihrer Familie“, nickte Edwina. „Wir werden uns mit Ihrer armen Gattin in Verbindung setzen.“
„Mit welcher?“ fragte Dickie bescheiden.
„Mit der rechtmäßigen natürlich, die Sie im Überschwange Ihrer Jugend heirateten und so schnöde verließen.“
„Ich ... bitte Sie ...“, stammelte Dickie.
„Sie brauchen mich nicht zu bitten. Es ist ja meine menschliche Pflicht.“
Sie sprach noch eine Weile über Verzeihen und Vergessen, und dann, endlich, endlich, ging sie mit Winke-Winke zur Tür hinaus.
Was weder Jim Cooper mit der größten Verbrecherbande Amerikas noch die mächtige Chicagoer Polizei geschafft hatte, das war Mrs. Edwina Shrewshobber spielend gelungen: Dickie Dick Dickens, sonst den kritischen Lebenssituationen durchaus gewachsen, Dickie war ratlos. Völlig ratlos.
Selbst das Mundharmonikaspiel wollte ihm keine rechte Freude mehr bereiten.
Als Josua Benedikt Streubenguß einige Tage später seine Schritte ins Gefängnis lenkte, fand er einen zerknirschten, innerlich zermarterten Dickie Dick Dickens vor.
Verzweifelt erkundigte sich Dick bei Josua Benedikt, was er ihm da eingebrockt habe. Doch Streubenguß erklärte sich für zu Unrecht mit Vorwürfen überschüttet.
„Oh nein!“, widersprach Dick. „Die abgrundtief dämliche Idee, mir die Papiere dieses Poltingbrook zu beschaffen, stammt von Ihnen, mein Lieber!“
Streubenguß senkte den Kopf. „Ich habe“, sagte er demütig, „einen Gewährsmann in Irland beauftragt, entsprechende Nachforschungen über die einschlägige Frau Gemahlin anzustellen.“
Er machte eine Pause.
Dann fuhr er fort: „Die Vermutung, dass Mr. Poltingbrook das ihm angetraute weibliche Wesen bereits nach einem Vierteljahr verließ, erwies sich als richtig.“
Dann wird sie wohl auch danach gewesen sein, dachte Dick grimmig. „Hat er sie umgebracht?“, fragte er sachlich.
„O nein“, antwortete Josua Benedikt, „sie ist sogar quicklebendig und geht freudig ihrem Beruf nach.“
„Oh“, machte Dick.
„Ihrem Beruf, ja. Sie ist nämlich der einzige weibliche Walfangkapitän der Welt. Sie fährt ein Schiff namens ‚Oak Hoak Moah’.“
Dickie ließ sich auf die staatseigene Gefängnispritsche fallen. Plötzlich sprang er wieder auf.
„Hören Sie, Josua Benedikt“, sagte er eindringlich, „der Chicagoer Frauenverband hat den entsetzlichen Plan, meinen Familienfrieden zu retten. Das müssen Sie verhindern! Ich flehe Sie an: Sorgen Sie dafür, dass dieser weibliche Walfisch niemals amerikanischen Boden betritt!“
Zu spät!
Zur Stunde, da Dickie so herzbewegende Worte zu Josua Benedikt Streubenguß sprach, hatte die Feuerwehr des guten Willens, Mrs. Edwina Shrewshobbers Frauenverband, blitzschnell gehandelt.
Schon war die Nachricht über das große Wasser geeilt, nach Irland.
Von dort eilte sie von der Weite des Atlantik in nördliche Breitengrade zur Weite des Polarmeeres.
Dort hielten ölverschmierte, schwielige Frauenhände einen Funkspruch.4
Lasen ihn zweimal.4
Dreimal.
Ein Kerl, transtinkend und schimpansenbeinig, trat heran. „Was gibt’s Käpt’n?“ fragte er.
„Geht dich einen Dreck an“, antwortete die Frau und spuckte einen Priem aus. „Nachricht von meinem Kleinen. “
„Hä?“ machte der Mann.
Sie sah ihn schief an. „Der Kleine ist mein Mann, verstehst du?“
Dann blickte sie über die See.
„Acht Jahre vergehen wie Spreu im Wind. Doch die Erinnerung an ferne Zeiten steht wuchtig wie eine Eiche, die Wurzeln fest in unserem Herzen begraben.“
„Was Sie für schöne Sätze sagen!“ staunte der Matrose.
„Klar! Meine lyrische Ader!“
„Aha“, machte der Matrose und trollte sich.
Wie wir aus zahllosen Seemannsgeschichten gelernt haben, hat jeder Hochseekapitän eine lyrische Ader. So auch Käpt’n Maggi Poltingbrook von der ‚Oak Hoak Moah’.
Sie war ein guter Kapitän, fluchte kräftig wie Paprikasoße, behandelte ihre Mannschaft normal schlecht und brachte guten Fang ein.
Schön war sie nicht. Aber stur.
Seit Jahren war sie entschlossen, ihren Mann, der ihr durchgebrannt war, umzubringen. Leider wusste sie nie recht, wie.5 Manchmal dachte sie, ihn mit ihren eigenen Händen zu erwürgen, denn, so glaubte sie in ihrer lyrischen Art: „Der Hände Werk ist gut Werk, ist ehrlich Werk.“
Nun bekam sie plötzlich diesen Funkspruch von Edwina Shrewshobber. Und die Hände, die jahrelang etwas anderes vorgehabt hatten, zitterten.
Maxim F. Poltingbrook wollte sie sehen. Er saß im Gefängnis wegen Bigamie und verlangte nach ihr.
Weil er sein Unrecht einsah.
Maggi Poltingbrook lachte, dass die große dunkle Warze auf ihrer Oberlippe tanzte.
„Nach Chicago!“, brüllte sie den Steuermann an. „Nach Chicago!“
„Verzeihung, Käpt’n, aber Chicago hat keinen Hochseehafen. “
Margaret Poltingbrook stieß zornig mit dem Fuß auf die frischgescheuerten Schiffsplanken.
„Das große, weite Amerika wird doch irgendwo einen kleinen Hafen haben!“, donnerte sie.
„Natürlich.“
„Dort fahren wir hin!“
„Aber was wird unsere Reederei dazu sagen?“, fragte der Mann.
„Es ist genug gereedert! Lasst mich endlich Tuten hören! Tut heimwärts, Dampfer!“, jubelte Maggi und biss einem Hering den Kopf ab.
Sie aß gerne Rohes.
Noch zur gleichen Stunde drehte das 62 Grad nördlicher Breite und 55 Grad westlicher Länge kreuzende Walfangschiff ‚Oak Hoak Moah’ auf südsüdwestlichen Kurs. Kommandos erklangen. Da wurden die Spunten vor die Klieken gedreht, wurde achteraus backbord 5 Grad Prielung genommen, die Kelling gegen den Wind gehulpt und allerorts in den Masten gejauchzt. Alsbald steuerte die ‚Oak Hoak Moah’ mit voller Kraft entlang der Treibeisgrenze über den Atlantik, in pausenloser Fahrt der amerikanischen Ostküste entgegen. In wenigen Tagen war es geschafft. Die ‚Oak Hoak Moah’ machte im Hafen von New York fest.
Mannschaft und Kapitän gingen an Land.
Einen Tag später stürzte Bonco mit allen Anzeichen des Entsetzens in das Comptoir des Juweliers Josua Benedikt Streubenguß.
„Es hat nicht geklappt“, jammerte er und schlotterte mit den Knochen, „es hat nicht geklappt!“
Er habe ja auch, so sagte er, von Josua Benedikt zum Platznehmen aufgefordert, keinerlei Erfahrung im Totmachen.
Außerdem sei ihm nächtens eine Ratte mit rosa Schleifchen im Traum erschienen, was entschieden als böses Vorzeichen zu deuten sei.
Was er zu berichten hatte, war enttäuschend genug. Die Kapitänin, in Chicago eingetroffen, habe fabelhaft in Schusslinie gestanden. Er, Bonco, habe auch fabelhaft gezielt, jedoch an die Ratte mit dem rosa Schleifchen denken müssen. So konnte es geschehen, dass er nicht abzudrücken vermochte. Allerdings, so bekannte Bonco, habe er sich auch nicht im Morden geübt, was für solcherart Unternehmungen eben unerlässlich sei.
Josua Benedikt schüttelte leicht den Kopf und machte leise: „Ts, ts, ts.“ Dann verschränkte er die Arme über der Brust und murmelte: „Peinlich, so was!“
Die Situation schien aussichtslos.
Im Stadtgefängnis zu Chicago begegneten sich indessen zwei Damen, die sofort Sympathien füreinander empfanden: Mrs. Edwina Shrewshobber und Käpt’n Margaret Poltingbrook.
Edwina Shrewshobber wankte wie ein Leuchtturm auf Maggi zu und versuchte, wie schon Dick, auch ihr vermittels Händeschütteln die Arme auszureißen, was jedoch bei einer Frau wie Maggi nicht gelingen wollte.
Man besuchte den Gefängnisdirektor, besprach mit ihm die zu Dicks Freilassung notwendigen Formalitäten und schritt dann zum gemeinsamen Besuch in die Zelle des angeblichen Maxim F. Poltingbrook alias Dickie Dick Dickens.
Natürlich bemerkte Maggi Poltingbrook nicht, dass der Mann in der Zelle gar nicht der ihr angetraute war6. Und wenn sie es bemerkt hätte, so wäre das auch unerheblich gewesen. Mann ist eben Mann.
Dickie Dick Dickens ertrug alles. Umarmungen, Händeschütteln, Wangen, die nach Tran, und Kleider, die nach Mottenkugeln dufteten.
Doch als man ihm seine baldige Freilassung, verbunden mit Rückkehr in Maggi Poltingbrooks Arme verkündete, streikten seine Nerven. In einem Anfall geistiger Umnachtung versuchte er, erst Mrs. Shrewshobber, dann Maggi Poltingbrook und schließlich die gefängniseigene Pritsche zu zerschlagen.
Der eilig herbeigerufene Gefängnisdirektor zeigte sich über diesen Vorfall nicht ernstlich besorgt. So etwas wiederhole sich bestimmt nicht, wenn der Häftling erst einmal frei sei, so versicherte er. Und das sei ja schon in vierzehn Tagen der Fall.
„Frei!“ jubilierte Maggi Poltingbrook. „Frei wie die Möwe in den Lüften. Dann hol’ ich dich ab, mein Kleiner, und wir stechen in See! Hinaus in die Ferne. Du wirst bei mir als zweiter Rudergänger fahren. Musst natürlich als Schiffsjunge anfangen. Aber es wird dir Spaß machen, das Seemannsleben. Sich Wind und Wetter um die Nase wehen zu lassen - was könnt’ es Schön’res geben!“
Damit verließ sie die Zelle, gefolgt von der wackeren Edwina Shrewshobber.
Dickie saß zerknirscht auf seiner Pritsche. Sah hilfesuchend zu dem Direktor auf.
„Kann denn der Strafvollzug so grausam sein, Herr Direktor? Wollen Sie mich wirklich dieser Walfangmutter ausliefern?“
Selbstverständlich wollte das der Direktor. Denn sie war ja seine rechtmäßig angetraute Gattin.
„Gut“, sagte Dick entschlossen, „dann werde ich ein Geständnis ablegen.“
Und er gestand, dass er gar nicht Maxim F. Poltingbrook war, sondern Dickie Dick Dickens, der gesuchte Millionendieb von Chicago.
Aber der Direktor lachte nur. Lachte laut und anhaltend. Er glaubte ihm kein Wort und ermahnte ihn, sein Schicksal mit Würde zu tragen. Mit solchen Mätzchen könne er keine Beachtung erlangen, höchstens mit Leistungen. Dick nickte und sah den Direktor träumerisch an.
„Tut mir leid“, sagte er versonnen, „aber es muss sein.“ Und schlug ihn zusammen.
Vierundzwanzig Stunden später wurde Dickie Dick Dickens wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, Aufruhrs und Körperverletzung zu neuerlichen sechs Monaten Gefängnis verurteilt.
Dankbar lächelnd hörte er den Spruch des Richters.
Der Heiterkeitserfolg, den er beim Gefängnisdirektor dadurch erzielte, dass er die Wahrheit gesagt hatte, machte ihn um eine Erfahrung reicher, die ihm für das ganze Leben Rüstzeug sein sollte.
In den Notizen für seine Memoiren finden wir folgenden Satz niedergelegt:
„Das haben“, so heißt es dort, „die Politiker mit den Gangstern gemeinsam: Wenn’s mit der Wahrheit nicht so recht klappen will, versuch’s mit der rohen Gewalt. Seit Cäsars Zeiten gilt das schlagkräftige Argument auch als das beste.“
Bella Cora del Hortini jedoch, der vertrauten Freundin im fernen Italien, schreibt er wehmütig:
„Welche Stunde, da ich erkannte, wie fürchterlich ein Frauenherz auch noch in seiner Güte sein kann!“