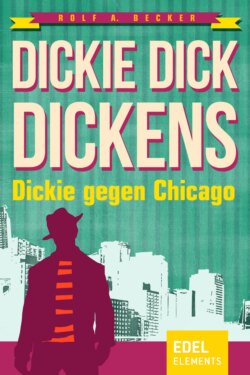Читать книгу Dickie Dick Dickens – Dickie gegen Chicago - Rolf A. Becker - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеES KLAPPERT DIE MÜHLE
Wie wenig begründet war doch der Zweifel des Mannes in der Zelle an sich und seiner Mitwelt! War und blieb er nicht der, der er immer gewesen: Dickie Dick Dickens ... ?
Dickie Dick Dickens - das Trumpfas der listenreichsten Männer der neuen und der alten Welt, der Mann, dem von den beiden führenden Verbrecherheranbildungsanstalten, nämlich der ‚HASARD CRIME AND OUTLAWRY UNIVERSITY’7 sowie der „INTERNATIONAL RACKERTEERING AND DEFRAUDING ACADEMY’8, die Ehrendoktorwürde zuerkannt wurde. In einer schlichten, aber ergreifenden Feierstunde nahm er die Doktorhüte im April 1929 und Mai 1934 in Empfang, trägt sie allerdings nur bei schlechtem Wetter.
Es spricht für seine Bescheidenheit und für die in der Tiefe seines Wesens verhaftete, weltferne Abgeschlossenheit, dass er fast nie von seinen Doktortiteln Gebrauch gemacht hat. Dr. Dr. Dickie Dick Dickens blieb auch im Alter der zurückhaltende und warmherzige Mensch, der er immer gewesen.
Selbst, als er wirklich allen Grund hatte, aus der Haut zu fahren, blieb er in ihr.
So zum Beispiel in jenem Winter des Jahres 1925.
Ein schicksalsschwerer Winter. Chicagos Unterwelt war führerlos.
Und Dickie Dick Dickens hatte, wie wir wissen, seine Haft noch freiwillig um sechs Monate verlängert. Und das nur, um Maggi Poltingbrook, seinem rechtmäßigen Weibe, zu entgehen.
Margaret Poltingbrook, geborene Stippling, aber ließ nicht locker. Sie kam wieder und bot Dickie an, das Gefängnis anzuzünden, um ihn herauszuholen.
Dick hatte Bedenken. „Nicht etwa wegen der anderen 1999 Sträflinge“, meinte er, als Maggi ihn einen Feigling schalt, „ich vertrage nur keine Hitze.“
Maggi ließ noch manchen schönen Spruch aus ihrer lyrischen Ader quellen, noch manch abenteuerlichen Plan, um Dick aus dem Kerker zu befreien. Vergeblich. Er weigerte sich einfach, Unrecht zu tun.
Und Maggi hätte ihn so gern an Bord gehabt!
Mit gewaltiger Rede schilderte sie Dick die Schönheiten der Walfischaufbereitung.
Ebenso vergeblich.
Als die Besuchszeit um war, verließ Kapitän zur See Maggi Poltingbrook das Gefängnis. Gramverkümmert stapfte sie hinaus.
Dickies Laune hingegen glich einer sprudelnden Sodawasserflasche. Mit sich selbst und der Welt zufrieden, blieb er in seiner Zelle, die ihm, wie er in einem Brief an einen jungen Einbrecher schrieb, zum lieben Heim geworden war.
Hier fühlte er sich wohl. War sicher vor den Gefährnissen des Alltags und dem Zugriff seiner Frau Gemahlin. Er vertrieb sich die Zeit, die er gar nicht vertreiben wollte, mit flottem Spiel auf der Mundharmonika.
Doch nicht überall war es so ruhig und friedlich wie in Chicagos Stadtgefängnis.
Im Rathaus herrschte in jenen Tagen Panikstimmung. Man tagte, hielt stundenlange Reden nach wochenlangem Nachdenken.
Kommissar Hillbilly, blonder Komet am amerikanischen Polizeihimmel, sah sich einer Katastrophe gegenüber. Seit Jim Coopers Bande ausgehoben sei, blühe das Verbrechen in allen Ecken und Winkeln, so behauptete er und verwahrte sich gegen den Einwurf des Bezirksstaatsanwaltes, die Polizei griffe eben nicht hart genug durch.
Der Bezirksstaatsanwalt wiederum verwahrte sich gegen solche Verwahrungen, wohingegen der Senator für allgemeine Angelegenheiten es an der Zeit fand, der Welt kund und zu wissen zu tun, dass nicht der einzelne, sondern vielmehr das System Schuld an jeglichem Mißstand trage.
Dies aber zu bekämpfen sei seine, Senator Crossberrys, vornehmliche Aufgabe.
Da aber niemand so recht etwas von Senator Crossberrys vornehmlicher Aufgabe wissen wollte, ging man zu dem sichersten und unfehlbarsten Mittel zur Beseitigung von Mißständen über: Man redete, schrie und gestikulierte durcheinander.
Währenddessen wurde Kommissar Hillbilly durch Sergeant Martin die Meldung erstattet, dass sich in der letzten Nacht wiederum ein Dutzend Schwerverbrechen ereignet hätten, davon allein sieben Morde.
Die alberne Bemerkung eines Gemeindevorstandes, er verstünde nicht, wieso Kommissar Hillbilly seine Sorgen der Senatoren- und Bürgerversammlung vortrüge, statt sich als Polizist an die Beseitigung der herrschenden Mißstände zu machen, wurde als laienhaft und ins Sonntagsblättchen gehörig abgetan.
Der Bürgermeister aber schwieg. So tagte man weiter im Rathaussaal. Tagte stundenlang.
Die Beschwerden Kommissar Hillbillys waren jedoch keineswegs grundlos. Über das ganze Stadtgebiet verteilt, ereigneten sich die Verbrechen. Planlos und ohne Zusammenhang zwischen den einzelnen Delikten.
Diese Zusammenhanglosigkeit aber war es, die Kommissar Hillbilly in Wahrheit so ratlos machte.
Dabei war die Erklärung höchst einfach.
Die Nachricht, dass Jim Coopers Bande vernichtet war, hatte sich wie ein Lauffeuer über den amerikanischen Kontinent verbreitet.
„Die Unterwelt Chicagos“, so flüsterte man sich zu, „ist herrenlos!“
Wie in den alten Goldgräberzeiten erzählte man von dem großen, glänzenden Glück, das in Chicago auf der Straße läge. Allüberall formierten sich kleine Gruppen von Glücksrittern und machten sich auf die Reise.
Und da kamen sie: Abenteurer und Hasardeure, Banditen und Desperados, Wegelagerer und Brandstifter, Kehlabschneider und Bauchaufschlitzer.
Sie kamen. Kamen alle!
Aus ganz Amerika!
Sie kamen zu Fuß über Stock und Stein, sie streiften hoch zu Ross über Steppen und Prärien, durchstrebten die Weite des Landes auf den rollenden Rädern der eisernen Bahn, ratterten hupend und quäkend das weiße Band der Landstraße entlang und durchstürmten auf eisernen Flügeln die Lüfte.
„Oh Gangster! Schnell und eilig da, wo Geld ist und Macht. Kommende, deren einziger Wille nichts ist als die flammende Fackel eigener Sucht.“
So sang der poetische Tim Harrier in jenen Tagen.
Doch die Illusion der Missetäter aller vereinigten Staaten sollte wie eine Fata Morgana im Sandsturm zerstieben.
Denn schon auf den Zufahrtsstraßen wurde ihnen auf recht drastische Weise klargemacht, dass die Unterwelt Chicagos übervölkert war.
Da gab es Billy, den Kopfjäger, der Straßenfallen aufstellte und die Zugereisten noch vor der Ortseinfahrt abknallte. Allerdings nur so lange, bis Rip und sein Freund Reff ihn aus zwanzig Meter Entfernung umlegten.
Reff, der Rip fragte, ob er auch getroffen habe, wurde von Rip als Dussel empfunden und ebenfalls erschossen.
Rip, der an sich über eine vorzügliche Halbbildung verfügte, verkannte hierbei eines der Naturgesetze der Gangster, dass nämlich jeder Dussel, der stirbt, nur Platz für zwei neue macht.
So sollte es nicht lange dauern, und Topper und Williams kreuzten auf.
„Hallo, Rip, alter Junge!“, sagte Topper, der einen Wolfsrachen hatte und meist den Unterkiefer herunterhängen ließ. „Wir hörten hier ‘ne Schießerei. Deswegen sind wir hergekommen. Was, Williams?“
Williams, dessen ausgefranste Ohrenränder vorzüglich zu seiner geschwollenen Oberlippe passten, nickte und sagte stur: „Stimmt, Topper, sind wir.“
Topper sah sich um.
„Fünf Leichen, hübsch aufgeräumt.“
Rip lächelte geschmeichelt. „Es tut mir leid um die Jungs. Es kann eben nicht jeder leben bleiben, das liest man alle Tage. Die Konkurrenz wird zu groß.“
„Da hast du recht“, nickte Topper. „Was, Williams?“ Williams bewegte seinen Kopf vorwärts. „Da hat er recht.“
So plauderten sie noch eine Weile, und die Zeit, bis er Rip mit dem Messer gekillt hatte, verging Topper wie im Fluge.
Es gibt eben Tage, da spürt man die Arbeit kaum. Williams legte noch ein paar nette Tellerminen für den Fall, dass unerwünschte Polizeiautos ihren Weg kreuzen sollten, und dann marschierten sie selbzweit, Topper und Williams, gen Chicago.
Von Tag zu Tag wurde es unruhiger in Chicago. Selbst der hartgesottenste Gauner war seines Lebens nicht mehr sicher. In der ehedem so klar organisierten Unterwelt der herrlichen Millionenstadt herrschten wahrhaft anarchistische Zustände!
Keiner der Gesetzesbrecher konnte mehr in Ruhe seiner Beschäftigung nachgehen. Es gab kaum einen Einbruch, Diebstahl oder Überfall, bei dem der Räuber nicht anschließend selbst ausgeraubt wurde.
Tatsächlich: So weit war es mit Chicagos Gangstern gekommen, dass es bei ihnen zuging wie im Existenzkampf.
Gangster überfüllten die schönen Friedhöfe von Chicago. Friedhöfe, die einst von einem wohlmeinenden Senator für die Bürger dieser Stadt angelegt worden waren, wurden zweckentfremdet.
Keine Straße, auf der sich nicht räuberische Banditen erbitterte Gefechte lieferten.
Eine Tatsache, die Senator Berriman veranlasste, in einer dringlich anberaumten Senatssitzung auszurufen: „Das, meine Damen und Herren, scheint mir doch eine gelinde Überschätzung der demokratischen Freiheiten zu sein, die wir den Leuten zugestehen! In der Frage, wer, wann und wo abgeschossen wird, sollten wir uns zumindest ein Mitspracherecht sichern!“
Hatte der Herr Bürgermeister seit Tagen und Wochen weise geschwiegen, so erhob er sich nun und wandte sich würdevoll dreinblickend an die erlauchte Versammlung.
„Meine Damen und Herren“, sagte er geistreich, „der Senator Berriman macht mir den Vorwurf, dass ich mich nicht kümmere um diese Angelegenheit. Ich möchte betonen, meine Damen und Herren, ausdrücklich betonen, dass ich konferiert habe mit allen zuständigen Herren der Stadtverwaltung. Ich habe auch konferiert mit den führenden Organen der beteiligten Interessengruppen. Und ich habe mit all den Herren gesprochen in einer sehr erfreulichen Atmosphäre, sowohl menschlich als auch sachlich. Wir haben völlige Übereinstimmung erzielt bei allen wesentlichen Fragen, die wir besprochen haben auf dieser Konferenz. Und ich kann dem Haus versichern, dass alle geeignet erscheinenden Maßnahmen ergriffen werden zur Bekämpfung des Übels, von dem der Herr Senator Berriman gesprochen hat.“
Die Versammlung klatschte Beifall. Es hörte sich an wie Regen auf einer Blechbüchse.
„Aber wann?“ schrie einer, der schreien musste.
Der Bürgermeister sah ihn ruhig an. „Wann? Sie können sich trösten. Es wird schon rechtzeitig geschehen.“
Da mussten wieder welche schreien. „Was heißt rechtzeitig? “
Der Bürgermeister, der sich schon wieder gesetzt hatte, erhob sich noch einmal, peinlich berührt von soviel Tamtam. „Aber meine Herren!“ sagte er gequält. „So seien Sie doch nicht so zimperlich! Es besteht ja noch nicht der geringste Anlass zu irgendeiner irgendwie gearteten Besorgnis! “
„BUMMM“ machte es, und eine Detonation zerriss die Stille, die den Worten des Bürgermeisters folgte, in Stücke. BUMMM! Und noch viele kleine, schnelle BUMMs folgten. Glas splitterte.
Gestühl polterte.
Maschinenpistolensalven bellten ihr stählernes Gemecker in schreiende, tobende Menschen.
Während die Senatoren drinnen debattierten, wogte vor dem Rathaus eine wilde Schlacht zwischen Banditen. Im Eifer des Gefechtes stürmten einige der Randaleure das Rathaus, offensichtlich in der irrigen Meinung, dass, wo geschrien und gestritten wird, ernsthafte Zerwürfnisse herrschen oder gar Anschauungen vertreten werden. Außerdem, so dachten sie, kann es niemals schaden, wenn man von Zeit zu Zeit ein Rathaus erobert.
Der Bürgermeister stellte fest, dass er vollkommen recht gehabt hatte mit seiner Annahme, es bestünde kein Anlass zur Besorgnis. Er hatte sich nur in den Zeiten geirrt.
Josua Benedikt Streubenguß seinerseits hatte viel Grund zur Beunruhigung. Er fand, dass Chicago einem Hexenkessel gliche und dass Ruhe, Ordnung und bürgerliche Sicherheit wieder einzukehren haben.
Gelernte Gangster haben es nicht gut in aufgeregten Zeiten. Sie leben gerne schlicht und einfach.
Es fällt dann nicht so auf, wenn man jemandem den Hals abschneidet. Auch hält der Bürger von nebenan um seines guten Lebens willen den Mund. Wer schreit schon gern wegen anderer Leute?
Josua Benedikt beschloss zu handeln.
Als erstes ging er zu Dickie Dick Dickens ins Gefängnis.
„Sie“, so sagte er mit Würde, „könnten Chicago retten, Mr. Dickens! Sie haben Persönlichkeit und Führertalent.“
Dick zeigte sich abweisend. Josua Benedikt, so sagte er, möge sich bitte vergegenwärtigen, dass ihm dieses Gefängnis Futterchen und Heiabettchen liefere und er ungestört seiner musikalischen Leidenschaft frönen könne. In der Freiheit aber lauere Maggi Poltingbrook auf ihn, die Zweizentnerdame mit dem Walfischleib.
Wäre diese freundliche Unterredung nicht durch den Besuch der Dame Edwina Shrewshobber unterbrochen worden, Josua Benedikt hätte verzweifeln müssen.
Die gute Edwina kam mit der Nachricht, dass es den Vereinigten Frauenverbänden gelungen sei, Strafaufschub für Dickie zu erwirken, und dass seinem Glück an der Seite Maggi Poltingbrooks nun nichts mehr im Wege stünde. In spätestens acht Tagen, so verkündete sie, hole Maggi, die Liebe, ihn vom Gefängnis ab.
„Meinen Glückwunsch!“, kicherte Streubenguß, „oder, wie sagt man: Tran Heil?“
„Wenn Ihnen Ihr Leben wert ist, Josua, hören Sie auf zu lachen!“ knirschte Dick.
Josua versprach, es sich zu verbeißen.
Dick schwieg. Grollte.
In acht Tagen holte ihn Maggi. In diesen acht Tagen musste etwas geschehen!
Dick stand vor dem kleinen Fenster seiner Zelle und besann sich auf das Beste, was er hatte.
Auf sich selbst.
Dann wandte er sich um.
„Gehen Sie nach Hause, Josua Benedikt“, sagte er leise, „und bestellen Sie Effie, sie soll mein Bett beziehen! Übermorgen komme ich.“
Josua Streubenguß antwortete nicht. Er nahm seinen Hut. Verließ Dick.
Dick, der nun wieder so ganz er selbst war.
Am Morgen des nächsten Tages ließ Dick den Gefängnisdirektor schön grüßen und ihm ausrichten, er beabsichtige, ein Geständnis abzulegen.
Der Gefängnisdirektor, ein gutherziger Mann, eilte darauf sofort in die Zelle von Dick.
Der Wärter meldete stramm und respektheischend: „Der Herr Gefängnisdirektor!“
„O fein“, meinte Dick, „ich lasse bitten.“
„Morgen, Mr. - äh - Poltingbrook ...“ sagte der Direktor höflich, „so war doch der Name?“
„Hm“, antwortete Dick, „ich glaube.“
„Sie glauben???“
Dick nickte eifrig. „Gestern jedenfalls hieß ich noch so. Aber bekanntlich ändern sich die Zeiten - und mit den Zeiten die Menschen. Sie brauchen nur bei Einstein nachzulesen. “
„Meine Zeit ist kostbar, Poltingbrook“, sagte der Direktor kühl, „was wollen Sie also?“
„Ich“, entgegnete Dick, „wollte Ihnen sagen, dass ich kein Geständnis ablegen kann. Man würde mich sonst totschlagen. “
„Wie bitte?“ Des Direktors Gesicht wurde eisig.
„Dabei bin ich ein schlechter Mensch“, flüsterte Dick. „Ich bin nämlich gar kein Bigamist. Ich habe mich nur gebrüstet.“ Er lachte schallend.
„Aber Poltingbrook! Sie können doch nicht leugnen, dass Sie in Irland schon mal verheiratet waren!“
„Oh“, lächelte Dick, „wenn Sie wüssten, was ich sonst noch alles kann! Zum Beispiel in den Zähnen stochern!“
„Na, na, na!“, machte der Direktor ärgerlich. „Wollen Sie etwa behaupten, Sie hätten sich nicht mit Margaret Stippling in Blackwater trauen lassen?“
„Freilich, freilich“, ereiferte sich Dick. „Wir haben lediglich unsere Bekanntschaft vor dem Standesbeamten bekräftigt. Das ist dort so Landessitte.“
„Aha! Nach Landessitte nennt man so etwas Eheschließung, mein Bester. Sie sind also verheiratet!“
„Und Sie sind ein Wortklauber!“, trumpfte Dick wütend auf und begann zu weinen.
Der Direktor sah Dick prüfend an.
„Was ist los, Poltingbrook? Sie sind so konfus? Aber gehen wir mal weiter. Sind Ihrer Ehe Kinder entsprungen?“
„Wenn Kinder schon gleich entspringen müssen, wenn sie auf die Welt kommen, ist das der beste Beweis, dass die Ehe ein Gefängnis ist“, sinnierte Dick düster.
Dann sah er auf.
„Natürlich habe ich Kinder. Sechzehn bis siebzehn Stück, so weit ich mich erinnere. Alles Söhne.“
„So?“
„Ja, ich habe niemals Töchter. Das wäre auch gegen die Natur. Denn ich bin ja ein Mann.“
„Wie heißen denn Ihre Söhne?“, fragte der Direktor mit einem seltsamen Unterton in der Stimme.
„Oh“, lächelte Dick, „die Namen sind leicht zu merken. Sie heißen alle Paul. Bis auf Thomas. Der heißt Richard.“
„Hören Sie mal, Poltingbrook“, sagte der Direktor langsam und leise, „wollen Sie mich zum Narren halten?“
Dick sah ihn reinen Blickes an. „Warum? Sind Sie denn keiner?“
Die Unterredung wurde damit beendet, dass der Direktor wütend die Zelle verließ und sich in sein Amtszimmer begab. Dort blätterte er in den vom Staat eigens für seine Diener verfassten Romanen, die alle den gleichen Titel ‚Vorschriften’ tragen.
Denn das ist das Glück des Beamten, dass er für alle absehbaren Fälle in seiner Praxis Verhaltungsmaßregeln und Richtlinien mitbekommt.
Für die absehbaren, wie gesagt.
So kostete es denn unseren Herrn Direktor keine unnötige Denkarbeit, die richtigen Schritte einzuleiten.
Zwölf Stunden später schon saß Dickie Dick Dickens in der psychiatrischen Abteilung des Gefängniskrankenhauses und wurde vom leitenden Arzt, Dr. Summerbird, untersucht. Dick musste zählen, und Doc Summerbird fand, dass es recht gut ginge.
„O ja!“, strahlte Dick. „Ich kann noch weiter. Gestern Abend zum Beispiel, bei der Voruntersuchung, bin ich bis 834 gekommen. Und nur zwei Fehler! Sie können die Schwester fragen!“
„Hm“, machte Doc Summerbird, „und Sie haben sechzehn Söhne?“
Dick nickte. „Den letzten nicht mitgerechnet. Aber der gilt nicht. Der war eine Missgeburt.“ Dick wandte sich ganz dicht zum Arzt hin und flüsterte: „Der hatte nur zwei Ohren! Und Haare auf dem Kopf!!“ Laut setzte er hinzu: „Ich hab’ mich vielleicht geschämt!!“
Der Arzt fragte Dick, ob er manchmal Kopfweh habe. „Hoho!“, antwortete Dick. „Gerne! Wie ein Mühlrad wälzt es sich in meinem Schädel! Haben Sie schon mal Mühlräder im Kopf gehabt?“
Summerbird sah seinen Patienten interessiert an. „Haben Sie diese Schmerzen öfter, Poltingbrook?“
„Nein“, hauchte Dick, „nicht öfter. Nur vieler. Immer wenn ich an Irland denke. An Maggi. Und an die Walfische. An die Zeit damals. Dann ist ein Schleier über meinem Kopf. Ganz aus Dunst und Nebel ... und das Mühlrad. Klipp-klapp.“
„Hm.“
Doc Summerbird fixierte Dick und sah ihm in die Augen.
„Herr Doktor“, jammerte Dick, „wenn ich meinen Verstand verliere, kriege ich ihn dann gegen Finderlohn wieder? Und wie viel Prozent Verstand muss man als Pflichtanteil abgeben?“
Der Doktor antwortete nicht.
Dick schwankte. Doch dann lächelte er versonnen. „Rübezahl meint, dass ich gesund sei.“
„Wer ist Rübezahl?“
„Den kennen Sie nicht? Der Geist der Deutschen.“
Der Doktor sprach lange mit Dick. Bat ihn, sich zu erinnern. Dick musste seine Jugend erzählen. Aber immer, wenn er „Auto“ sagte, geriet er ins Stottern. Der Schweiß brach ihm aus.
„Auto ... Auto ... Auto ...“, jammerte er und weinte.
Der Doktor drang in ihn. „Was war mit dem Auto?“ fragte er immer wieder.
Dick schüttelte den Kopf. Dann sagte er tonlos: „Machen Sie mal brrrrrrr, Doc!“
Der Arzt tat ihm den Gefallen. Doch Dick genügte es nicht. Brrrrrrr solle der Doktor machen, „aber bitte im zweiten Gang...“
Immer wieder Auto. Und dann war es ganz aus mit Dicks Erinnerungen. Nur noch Auto und brrrr ...
Den ganzen Tag lang wurde Dick untersucht. Man kam zu keinem Ergebnis.
Am Ende entschloss sich Doktor Summerbird, ein Experiment zu machen. Er wollte mit seinem Patienten eine Autofahrt unternehmen. Vielleicht, dass diese Fahrt den plötzlichen Schock und die Verwirrung des armen Geistesgestörten löste.
Noch am späten Abend wurde alles für das Experiment des Doktor Summerbird vorbereitet.
Bei Morgengrauen beabsichtigte man, den Patienten zu einer Autofahrt mitzunehmen. Doc Summerbird stellte großzügigerweise seinen eigenen Wagen zur Verfügung. Da es sich um einen Sträfling handelte, der bereits in einer Woche auf Bewährung entlassen werden sollte, lag auch dem Gefängnisdirektor viel an der Heilung des Patienten.
Welch fatale Lage könnte für ihn entstehen, erführe man höheren Ortes, dass Sträflinge in seiner Anstalt Nervenschocks bekämen?
Dass es sich um einen Simulanten handeln könne, war schon aus dem Grunde ausgeschlossen, da der Mann ja in Kürze entlassen werden sollte.
So harmlos das Experiment des Doktor Summerbird auch war, so hatte die menschliche Gemeinschaft, die in diesem Falle aus den Bürgern von Chicago bestand, doch Anspruch auf Schutz vor Sträflingen.
Also traf man gewisse Sicherheitsvorkehrungen, was nicht ganz leicht war, da der Patient auf alles, was auf Bewachung außerhalb seiner Zelle hindeutete, mit Verzweiflung und Weinkrämpfen reagierte.
So wurde der Gefängniswärter Harris, der Dr. Summerbird und Dick begleiten sollte, in Zivil gesteckt und als Kollege Dr. Harris ausgegeben. Den Tank des Wagens füllte man mit herzlich wenig Benzin, so dass auf keinen Fall eine weite Fahrt möglich war.
Ort und Stunde des Experimentes, so hieß es in den Akten des Gefängnisses, wurde als ‚zu äußerst früher Stunde und auf einsamer Landstraße auszuführen’ anberaumt.
Ein scheußlicher, nebliger Morgen kroch in die schmutzigen Steinritzen des Chicagoer Stadtgefängnisses.
Feiner Regen kitzelte die Wangen der drei Männer, die in einen haltenden Wagen stiegen.
Es war vier Uhr früh. Langsam fuhr der Wagen an.
Die drei Männer saßen vorn. Am Steuer Dr. Summerbird. Neben ihm Dick und der angebliche Arzt Dr. Harris, der in Wahrheit der Gefangenenaufseher Alfons Harris war.
Dick sah bleich und leidend aus. Der Ausdruck seiner Augen war leer und gläsern. Mechanisch strich seine Hand über den Revers seines Anzugs. Doch er schien nichts von dem wahrzunehmen, was um ihn geschah.
Während der Fahrt sprach Dr. Summerbird. Sprach leise und freundlich.
Dick antwortete nicht. Er rückte unruhig hin und her, stöhnte und klammerte sich an Dr. Summerbird fest. „Ich habe Angst... Angst ... Angst“, flüsterte er.
Summerbird sagte kluge Dinge darüber, dass nun bald eine Krise käme, und dass man nicht nachlassen dürfe. Er möge es sich bequem machen, die Beine ausstrecken, sich entspannen und versuchen, an jene Autofahrt zu denken, die offenbar seinerzeit den Schock ausgelöst habe.
Dick legte die Stirn in Falten und versprach, nachzudenken. Aber das Erinnerungsvermögen stellte sich immer noch nicht ein.
Sie fuhren hinaus, vor die Tore der Stadt. Die nasse Landstraße rutschte wie ein Fließband unter den Rädern des Autos hinweg. Dick stöhnte.
Doc Summerbird lächelte ihm aufmunternd zu, sagte aber nichts.
Die Straße führte nach Westen. Weit und breit nichts als Felder und manchmal ein Baum, dessen dürre Äste in sinnloser Gebärde gen Himmel zeigten.
Kein Haus. Keine Raststätte für Autos. Nichts.
Plötzlich hörte Dick zu stöhnen auf. Er beugte sich vor. Trat auf die Bremse.
„Anhalten!“ sagte er kurz.
Die Bremsen quietschten, der Wagen hielt.
„Aber, aber!“ machte Summerbird. „Was soll denn das?“
„Aussteigen!“
Summerbird sah Dick unwillig an. „Nehmen Sie Vernunft an, Poltingbrook! Wir führen das Experiment zu Ende, und Sie werden sich wohler fühlen!“
„Das Experiment ist zu Ende, ich danke Ihnen für Ihre Mühe, Doktor“, sagte Dick, und es klang hart und kalt. Nun wurde auch Summerbird ungemütlich.
„Hören Sie, Poltingbrook, Sie zwingen mich, Ihnen mitzuteilen, dass Mr. Harris kein Kollege von mir ist. Er ist Gefangenenwärter.“
Dick lächelte.
„Ei, ei, lieber Doc. Hat Ihnen Ihre Mutti denn erlaubt, zu schwindeln?“
Summerbird kniff seine Augen zusammen und versuchte einen hypnotischen Blick. „Falls Sie auf dumme Ideen kommen sollten, wird er von der Schusswaffe Gebrauch machen. Er hat nämlich eine Pistole bei sich.“
„Meinen Sie diese?“ fragte Dick und hielt beide Männer mit einer 12-Millimeter-Luger in Schach.
„Verdammt!“
Der Gefangenenaufseher versuchte, sich auf Dick zu stürzen. Aber dann sah er den kalten Blick des Mannes, sah, wie sich der Finger am Abzugsbügel krümmte.
Dick riss die Wagentüren auf, stieß gleichzeitig Summerbird mit dem linken Arm und Harris mit dem rechten Fuß aus dem Wagen. Dann gab er Gas und raste davon. Die einsame Landstraße entlang.
Es war genau 6 Uhr und 36 Minuten.
Dickie Dick Dickens selbst bezeichnete seinen Erfolg als einen Triumph des schlichten handwerklichen Könnens. Hätte er nicht sein ganzes Leben lang seinen Beruf als Taschendieb gepflegt und sich mit nie erlahmender Kraft darin geübt, wäre ihm diese Flucht nie geglückt.
Dr. Summerbird und Mr. Harris aber standen auf regennasser Landstraße, fluchten und schimpften.
Dann jedoch trösteten sie sich. Weit konnte der Sträfling Poltingbrook nicht kommen. Der Benzinvorrat des Wagens war nicht groß, und der Reservetank war leer. Summerbird überlegte fieberhaft. Poltingbrook hatte keine Ahnung, dass sein Benzin bald alle-alle war. Er würde also weiterfahren, würde auch an der Tankstelle vorbei fahren, die als nächste auf seiner Wegstrecke lag.
„Was kommt nach der Tankstelle?“ fragte er Harris, der die Gegend gut kannte.
Der blickte düster. „Nichts. Keine Stadt, kein Dorf, nicht einmal ein alter Hühnerstall. Der Musjöh steht nachher genauso auf der Straße wie wir auch.“
„Na warte!“ sagte Summerbird. Er hatte es plötzlich eilig. „Kommen Sie, Harris! Kommen Sie schnell!“
Und lief mit Riesenschritten die nasse Landstraße entlang. Allerdings in rückwärtiger Richtung.
Summerbird und Harris hatten richtig vermutet. Dickie fuhr nichtsahnend an der Tankstelle vorbei.
Dann aber machte es puff-puff und muck-muck, und der Motor stand still.
Dick stieg aus, nahm die Haube hoch, prüfte hier und prüfte da. Kein Zweifel, der Wagen war tadellos in Ordnung; das Lämpchen am Armaturenbrett hatte zu Recht aufgeglüht - er hatte kein Benzin mehr.
Im Kofferraum fand er einen leeren Kanister, Reifen, Wagenwerkzeug, alte Lappen und einem Monteuranzug. Das war alles.
Dick stand auf der Landstraße ...
Aber aufgeben? Jetzt, wo er so weit war, dass er Maggi Poltingbrook und diesem ganzen Verein von Weibern samt ihres führenden Ungeheuers Edwina Shrewshobber entronnen war? O nein!
Dickie Dick Dickens war nicht der Mann, sich damit abzufinden.
Summerbirds Tempo brachte den guten Harris in arge Verlegenheit, was seinen Atemhaushalt anlangte. Er schnaufte und schniefte dermaßen, dass der spindeldürre Summerbird ihm mit einem Seitenblick bedeutete: „Mehr Sport, mein Lieber! Der Mensch soll jeden Tag zweimal schwitzen und einmal außer Atem geraten.“
„Danke“, meinte Harris, „was das betrifft, nehme ich zur Zeit auf dreißig Tage Vorschuss!“
Endlich erkannte er, was Doc Summerbird vorhatte: Etwa drei Kilometer, bevor der Sträfling das Auto zum Halten gebracht hatte und ausgebrochen war, hatten sie ein Landhaus passiert, das etwas versteckt neben einem kleinen, seitwärts führenden Weg lag.
Dieses Häuschen nun steuerte Dr. Summerbird mit Riesenschritten an, klopfte tief atmend und bat, als ihm von einem liebenswerten Alten geöffnet wurde, telefonieren zu dürfen.
Der nette alte Mann ließ die beiden eintreten, nicht ohne einen erstaunten Blick auf das puterrote Gesicht des immer noch keuchenden Harris zu werfen.
Das Telefon aber war trotz der frühen Morgenstunde besetzt. Und das sollte noch eine ganze Weile so bleiben, denn die Dame des Hauses telefonierte mit ihrer Freundin. Da half nichts. Gar nichts. Keine Ermahnungen des freundlichen alten Mannes, kein verstohlenes Zupfen an ihrer Schürze, keine wilden, an griechische Tragödien erinnernde Gesten von Harris.
Und Dr. Summerbird musste feststellen, dass sich über nichts in der Welt soviel sagen lässt wie über Nichtssagendes.
Dr. Summerbird aber hatte nur einen Gedanken: So schnell wie möglich die nächste Polizeistation zu verständigen. Zwar meinte Harris, dass dies wenig Sinn mehr haben würde. Denn es war nicht anzunehmen, dass Poltingbrook im Auto sitzen bleiben und auf seine Verhaftung warten würde. Summerbird aber war mit seinen Überlegungen schon einen Schritt weiter.
„Sie denken zu schnell, mein Lieber, deswegen denken Sie falsch“, sagte er. „Was, glauben Sie, wird Poltingbrook tun, wenn er merkt, dass sein Benzintank leer ist?“
„Na, er wird schön fluchen“, knurrte Harris.
„Und dann?“
„Dann geht er stiften.“
Summerbird schüttelte den Kopf. „Aber Harris! Er ist wenige Minuten vorher an einer Tankstelle vorbeigefahren. Was liegt also näher, als dass er zu Fuß dorthin zurückgeht, um sich einen Kanister Benzin zu holen?“
„Ach so“, sagte Harris, „na, freilich.“
Nun wurde auch er unruhig und schaute blitzenden Auges hinüber zur Dame des Hauses, die immer noch telefonierte.
Tatsächlich tippelte Dickie Dick Dickens zur gleichen Zeit, in einen Monteuranzug gewandet, die fünf Kilometer zu jener Tankstelle zurück.
Dort angekommen, wusste er eine rührende Geschichte von seinem armen Auto zu berichten, und wie einsam es da so ganz ohne Benzin auf der Landstraße stand. Tja, und leider könne er dem guten Tankwart nicht einmal etwas zahlen, denn er sei ausgeraubt worden. Von zwei Straßenbanditen. Nur die Brieftasche hätten sie ihm gelassen. Ohne Geld. Sein Scheckbuch habe er allerdings noch ...
„Aber das ist doch ganz in Ordnung“, tröstete der Tankwart den unglücklich dreinschauenden Dick, „ein Scheck genügt mir vollkommen.“
Gerade wollte er den erbetenen Benzinkanister abfüllen, da läutete das Telefon.
Wie erstaunt war der gute Mann, als er von der nächstgelegenen Polizeistation in Wilderbich die Nachricht bekam, dass ein ausgebrochener Sträfling namens Poltingbrook bei ihm aufkreuzen und ihn um Benzin bitten werde. Der Mann habe vermutlich kein Geld.
Der Tankwart schnappte erstaunt nach Luft.
„Und was ... was, bitte, soll ich tun?“ fragte er ängstlich.
„Halten Sie den Mann fest, bis wir kommen“, war die Antwort.
Das Telefongespräch war beendet, und dem Tankwart schien es, als habe er plötzlich Gummibeine. Er setzte sich zu Dick. Versuchte verzweifelt, mit ihm ein Gespräch anzufangen. Vergeblich.
Der seltsame Mann im Monteuranzug hatte doch tatsächlich keinen anderen Gedanken als den: Er wollte die Polizei in Wilderbich anrufen.
Nun kannte sich der brave Tankwart überhaupt nicht mehr aus.
Doc Summerbird, der in dem kleinen Landhaus gewartet hatte, bekam Besuch von der Polizei. Ein Beamter aus Wilderbich fuhr vor und begann, Summerbird gründlich auszufragen.
Summerbird fragte seinerseits zurück, ob man alles Erforderliche veranlasst habe, den Ausbrecher zu stellen. Jawohl, erhielt er zur Antwort und: Gewiss doch! Tatsächlich, so wusste der Polizist zu berichten, sei ein Mann im blauen Monteuranzug an der von Summerbird beschriebenen Tankstelle aufgetaucht. Der Mann war mittellos und hatte um Benzin gebeten.
Dr. Summerbird strahlte.
„Fein!“ sagte er zu dem Polizisten. „Fabelhaft!“
„Ob das fabelhaft fein ist, wird sich herausstellen“, sagte der Beamte trocken. „Sie wollen also Dr. Summerbird sein?“
„Ja“, sagte der Arzt, „und das ist Mr. Harris, Gefängnisaufseher. “
„Komische Geschichte“, murmelte der Beamte und sah Summerbird und Harris schief an. „Sehr komisch! Am besten, Sie erzählen mir das Ganze auf der Fahrt zur Tankstelle noch einmal.“
„Ja“, beeilte sich Dr. Summerbird zu sagen, „noch dazu, da der arme Patient in einer Woche entlassen werden sollte! “
„Patient?“ fragte der Beamte und sah noch schiefer drein. Aber dann schwieg er. Ließ Harris und Dr. Summerbird in seinen Wagen einsteigen und fuhr los.
Richtung Tankstelle.
Der Tankwart hatte inzwischen keinerlei Schwierigkeiten gehabt, seinen eigentümlichen Gast festzuhalten.
Im Gegenteil. Er bat sogar um einen Schluck Whisky und ein Butterbrot. Und ob er sich nach dem Schock einen Augenblick ausruhen dürfe?
Oh, gern! Gern!
Ein Auto brauste heran. Bremsen quietschten. Autotüren klappten. Die Polizei von Wilderbich, vertreten durch Unterleutnant Stammer. In seiner Begleitung zwei Herren in Zivil. Summerbird und Harris.
Unterleutnant Stammer trat ein. Grüßte knapp. Sah auf Dick. Auf den Tankwart. „Wer von Ihnen hat mich angerufen? “
„Das war ich, Leutnant“, sagte Dick freundlich und bescheiden, „bin froh, dass Sie gekommen sind. Sie haben die beiden Burschen gleich mitgebracht! Großartig!“
„Ja, Herr Doktor“, antwortete Unterleutnant Stammer, „wir arbeiten prompt. Erkennen Sie die Männer wieder?“
„Und ob!“
Dick wurde ganz rot im Gesicht.
„Das sind die beiden, die mich überfallen haben. Der eine nannte sich Bob und der andere Joe.“
„Eine Frechheit!“ brüllte Summerbird, der alles mitangehört hatte.
Der Beamte wandte sich ihm zu. „Schreien Sie mich gefälligst nicht an!“ schnauzte er. „Dieser Mann hier behauptet ebenfalls, Dr. Summerbird zu sein. Wir werden ja sehen, wer der richtige ist!“
„Verzeihung“, ließ sich Dick mit Würde vernehmen, „ich behaupte nicht, Dr. Summerbird zu sein, ich bin es!“
Er maß Summerbird und Harris mit einem verächtlichen Blick. „Diese beiden Individuen“, fuhr er fort, „haben meinen Wagen angehalten und mich ausgeplündert. Der eine trägt meinen Anzug. Sie brauchen nur nachzusehen, Leutnant, der Anzug hat auf der linken Innenseite ein Etikett vom Schneider Peacock.“
Der echte Summerbird schnappte nach Luft. Harris sah aus, als drohe sein Kopf zu platzen.
Unterleutnant Stammer fragte: „Können Sie sich ausweisen? “
„Natürlich“, antwortete Dr. Summerbird und griff in seine Jackettasche. Dann wurde er weiß. Stammelte: „Ich habe ... nanu ... ich weiß doch genau... meine Brieftasche ... ich muss sie vergessen ... es war zwar kein Geld mehr drin ... aber ich habe sie doch ... „
„Aha!“ machte Stammer.
„Bitte“, sagte Dick freundlich und wies eine Brieftasche vor. „Meinen Führerschein habe ich leider im Auto gelassen. Hier ist wenigstens mein Jagdschein.“ Dick wirkte unsagbar höflich und vornehm.
Unterleutnant Stammer warf einen Blick in den Jagdschein, lächelte und sagte: „Danke, danke, es genügt.“
Nun wurde Harris wütend.
„Der Kerl hat alles geklaut, Unterleutnant, die Brieftasche, das Auto und meine Pistole! Der verdammte Schweinehund! “ Er fuchtelte Dick mit der Faust unter der Nase herum.
„Ordinär!“, sagte Dick und wandte sich peinlich berührt ab. „Typische Gangstermanieren!“
Summerbird verlangte mit lauter Stimme, dass der Unterleutnant gefälligst im Stadtgefängnis von Chicago anrufen solle, um diese verrückte Sache endlich zu klären.
Doch Stammer donnerte: „Schluss jetzt! Ich werde im Gefängnis anrufen, jawoll! Aber von der Wache aus. Sobald ich Sie in der Zelle weiß!“
Harris fluchte wie ein Pirat aus dem 15. Jahrhundert.9
„Und Sie begleiten uns bitte auch?“, wandte sich Stammer höflich an Dick.
Der zierte sich ein Weilchen und bat dann auf das Höflichste und Vornehmste, doch erst seinen Wagen flottmachen zu dürfen.
„Für einen Arzt“, so meinte Dick sanftmütig, „ist ein Wagen das nötigste Instrument.“
Und lächelte selbst über solch gewagten Scherz vor den Ohren hoher Obrigkeit. Doch Unterleutnant Stammer hatte Verständnis für Dinge, die feinen Herren am Herzen liegen.
„Ist es Ihnen recht“, fuhr Dickie fort, „wenn ich um ...“ Er sah auf die Uhr an seinem Handgelenk und überhörte den Aufschrei Summerbirds, „... um, sagen wir mal, 9 Uhr 45 bei Ihnen in Wilderbich bin? Das ist in etwa einer Stunde. “
Der Unterleutnant nickte gnädig. Für so höfliche Leute muss man ein offenes Ohr haben.
„Meine Uhr!“, stöhnte Summerbird im Hintergrund. „Meine schöne Uhr!“
Dick lächelte betörend. „Dass ich Ihnen sicher bin, lieber Leutnant, geht schon daraus hervor, dass ich dem Dingsbumskirchen da, dem Straßenräuber, meinen Anzug lasse. Sie verwahren ihn für mich, gell?“
Der Unterleutnant lächelte höflich.
„Übrigens“, sagte er vertraulich zu Dick, „dass die ganze Sache einen Haken hatte, war mir sofort klar. Die beiden da haben mir nämlich eine lange Geschichte von einem Sträfling vorgefaselt. Das heißt, einmal war es ein Patient, dann wieder ein Gefangener. Und der Kerl sollte ausgerechnet acht Tage vor seiner Entlassung ausgebrochen sein! So dämlich ist doch wohl keiner!“
„Gewiss nicht!“
Dick schüttelte dem Unterleutnant die Hand. „Hut ab vor Ihrer Intelligenz, mein Lieber! Bis auf bald also!“
Stammer lächelte. Ein feiner Mann wie dieser, dachte er, sieht eben gleich, wen er vor sich hat. Und schubste den erstarrten Doc Summerbird und den nach Luft ringenden Harris in seinen Dienstwagen.
„Ab!“, schnauzte er. Und zu dem Tankwart gewandt: „Sie sind dem Herrn Doktor behilflich und fahren ihn schnell zu seinem Wagen, nicht wahr?“
„Wird gemacht!“, strahlte der Tankwart. Er war der Polizei gern gefällig.
„Auf Wiedersehen in Wilderbich!“, lächelte Dick und hob die Hand grüßend wie ein König.
Es dürfte wohl zu erwähnen unnötig sein, dass dieses Wiedersehen in Wilderbich niemals stattgefunden hat. In einem Brief an seine Jugendfreundin Bella Cora del Hortini äußert sich Dick über diesen Vorfall wie folgt:
„So sympathisch mir der Polizeiunterleutnant Stammer auch war“, schreibt er, „so hervorragend die Zusammenarbeit mit ihm auch geklappt hatte, so wenig zog es mich nach Wilderbich. Es hätte die Sache nur unnötig kompliziert, zumal sich Unterleutnant Stammer sicherlich auf die Dauer nicht mit einem Jagdschein begnügt, sondern auch den Führerschein zu sehen begehrt hätte. Und auf diesem prangte ja bedauerlicherweise das Foto des echten Dr. Summerbird.“
Wir alle aber, die wir seinen Weg verfolgen, fragen uns bang: Wird es Dick gelingen, seine wiedergewonnene Freiheit zu nützen? Wird er sich sowohl dem Zugriff seiner Frau Maggi als auch dem der Gerichtsbarkeit entziehen können? Wird er sich im Hexenkessel Chicagos behaupten? Oder wird er untergehen? Fragen über Fragen!