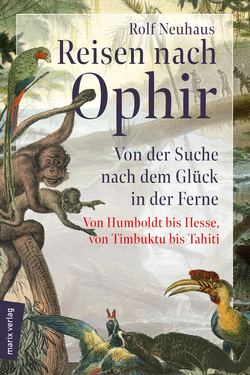Читать книгу Reisen nach Ophir - Rolf Neuhaus - Страница 10
4. Das unentrinnbare Ich – Paul Gauguin in Polynesien
ОглавлениеIm gleichen Alter, in dem Rimbaud starb, wurde Gauguin wiedergeboren. Vorher führte der gelernte Seemann als Börsenmakler und Sonntagsmaler ein komfortables bürgerliches Leben mit Gattin und fünf Kindern, nachher verschrieb er sich der Kunst als Vollzeitmaler und hielt sich mit Gelegenheitsjobs, sporadischem Verkauf seiner Arbeiten und der Hilfe von Freunden über Wasser. Nachdem er im Zuge des Börsenkrachs von 1882 seine einträgliche Stelle bei der Bank Bertin in Paris verloren oder aufgegeben und sich in Kopenhagen mit der Familie seiner dänischen Frau überworfen hatte, kehrte er im Juni 1885 allein mit seinem sechsjährigen Sohn Clovis nach Paris zurück. Er hatte kein Geld, hoffte auf den Verkauf einiger Bilder, suchte an der Börse erneut Fuβ zu fassen, arbeitete zeitweise als Plakatkleber auf Bahnhöfen, schlug jedoch eine feste Anstellung als Inspektor bei der Werbefirma aus. Im kalten Winter 1885/86 lebte er mit dem tapferen Clovis »kümmerlich« zwischen den vier Wänden seiner unbeheizten Mietwohnung und litt Hunger, abends lag auf dem Tisch nichts weiter als ein Kanten Brot, nachts lag Gauguin in seine Reisedecke gewickelt auf der Pritsche und fand keinen Schlaf, wie er in Briefen an seine Frau Mette klagte, die es vorgezogen hatte, mit den übrigen vier Kindern im Schoβ ihrer Familie in Kopenhagen zu bleiben. »Möge Gott geben, dass der Tod uns alle dahinrafft. Das wäre das schönste Geschenk, das er für uns bereithalten könnte.«
Ein Grafiker kauft Gauguin für 250 Francs ein Bild ab und vermittelt ihm die Bekanntschaft eines Keramikers, der Gauguin vorschlägt, für ihn im nächsten Winter Kunstvasen herzustellen. Man bietet ihm auch eine Stelle als Plantagenarbeiter in Ozeanien an, doch das würde seine ganze Zukunft als Künstler aufs Spiel setzen, an die er glaubt. Das Vernünftigste wäre, meint er, sich in ein kleines Nest der Bretagne zurückzuziehen, um ungestört arbeiten zu können, in der Bretagne sei es noch am billigsten. Mit Mühe bringt er das Fahrgeld auf, gibt Clovis in eine Pension, mietet sich im Fischerdorf und Künstlertreff Pont-Aven gegen monatlich 65 Francs für Kost und Logis in einem Gasthof ein – und lebt auf Kredit. Er arbeitet viel und mit gutem Erfolg, man hält ihn für den fähigsten Künstler der Kolonie, allerdings bringt ihm das nicht einen Sou ein. Er wird in diesem Beruf nicht fett, sagt er, sondern trocken wie ein Hering, die Geldsorgen bedrücken ihn, er will sich lieber das Leben nehmen als abermals ein Bettlerdasein wie im letzten Winter fristen. Glücklicherweise verbringt er Ende 1886 fast einen Monat in einem Pariser Krankenhaus, immer suchen ihn im Winter Katarrhe heim, schreibt er, diesmal glaubte er schon draufzugehen, aber sein verteufelter Körper aus Eisen gewann wieder die Oberhand, und zu seinem Leidwesen wird er aus dem Krankenhaus entlassen. Dann arbeitet er als Kunsttöpfer bei dem Keramiker, der Gauguins Tongefäβe für Meisterwerke hält, jedoch für allzu kunstvoll, als dass sie sich verkaufen lieβen. Im April 1887 fährt Gauguin nach Panama.
Gauguins Schwester Marie, die sich in Paris zeitweise um Clovis kümmerte, hatte ihrem Bruder einen Floh ins Ohr gesetzt. Ihr Mann, der kolumbianische Kaufmann Juan Uribe, der in Panama eine Handelsniederlassung hatte, dachte – vielleicht – daran, dort ein Kommissions- und Bankhaus zu eröffnen, und brauchte jemanden, der zuverlässig und im Bankfach bewandert war, ihn vertrat, wenn er auf Reisen in Europa weilte, und ihn nicht bestahl. Gauguin versetzte diese Perspektive nicht gerade in Verzückung, doch er fuhr trotzdem nach Panama. Ihn trieb vor allem der Wunsch, aus Paris zu fliehen, »das eine Wüste für einen armen Teufel ist, wie ich es bin«. Sein Ruf als Künstler wuchs von Tag zu Tag, manchmal hatte er jedoch tagelang nichts zu beiβen, hinzu kam die Hoffnungslosigkeit, an der sein Leben zu zerbrechen drohte, schrieb er seiner Frau. All das untergrub seine Gesundheit und vornehmlich seine Energie, und um diese zurückzugewinnen, hatte er eine bessere Idee, als ins Bankgeschäft zurückzukehren. Eine Meile von Panama-Stadt entfernt gab es eine kleine, vom Stillen Ozean umspülte Insel, die er aus seiner Zeit bei der Handelsmarine kannte: Taboga, fast unbewohnt und sehr fruchtbar, Früchte und Fische bekam man spottbillig, und die Luft war sehr gesund. Dort wollte er »wie ein Wilder leben«, fern von allen Menschen neue Kraft schöpfen und malen.
Zusammen mit Charles Laval, den er in Pont-Aven kennengelernt hatte, schifft sich Gauguin in Saint-Nazaire ein, die Überfahrt bei schlechtem Wetter ist sehr beschwerlich, in der dritten Klasse sind die Passagiere zusammengepfercht wie die Hammel. Nach Zwischenstopps in Guadeloupe und Martinique kommt er so gut wie mittellos in Colón an, doch er ist zuversichtlich, in acht Tagen werden sie sich auf Taboga eingerichtet haben und wie die Wilden leben, was nicht das schlechteste Los ist. Und wenn man einmal in der Klemme steckt, findet man in drei Tagen Arbeit, in Panama braucht man sich keine Sorgen zu machen. Wenige Tage später klingt Gauguin schon ganz anders, die Reise ist »so blöde wie nur möglich verlaufen«, schreibt er nach Kopenhagen, jetzt sitzen sie in der Patsche. Sein einfältiger Schwager, dessen Geschäft nicht im Mindesten den Eindruck macht, als florierte es, hat sie praktisch vor die Tür gesetzt, das billigste Hotel kostet 15 Francs pro Person und Nacht. Seit dem Baubeginn des Panamakanals sind auch die Grundstückspreise explodiert, und diese Trottel von Kolumbianern – Panama gehörte damals zu Kolumbien – überlassen einem kein Stück Land für weniger als sechs Francs pro Quadratmeter. Unmöglich, sich auch nur ein Kellerloch zu graben und auszubauen und von Früchten zu leben. Von Taboga, der 20 Kilometer vor Panama-Stadt gelegenen Insel, die Núñez de Balboa Isla de San Pedro genannt hatte und deren Name in der Eingeborenensprache »viel Fisch« bedeutet, ist fortan keine Rede mehr. Es wäre schlauer gewesen, gesteht Gauguin, auf Martinique zu bleiben, einem herrlichen Land mit freundlichen, heiteren Menschen, wo es für einen Maler viel zu tun gibt und das Leben billig ist. Jetzt gilt es, Geld zu verdienen, um nach Martinique zurückzukommen, Gauguin und Laval verdingen sich als Erdarbeiter beim Kanaldurchstich, von halb sechs morgens bis sechs Uhr abends hacken und schippen sie bei tropischer Sonne und täglichem Regen, nachts werden sie von Moskitos zerstochen. Die Sterblichkeit ist nicht so hoch, wie in Europa behauptet wird, schreibt Gauguin mit schwarzem Humor, von den »Negern«, denen man die schlechtesten Arbeiten gibt, sterben drei von Vieren, von den anderen nur jeder Zweite. Nach zwei Wochen werden Gauguin und Laval entlassen, die skandalumwitterte Compagnie Universelle du Canal Interocéanique, unter deren Leitung der Kanalbau stand und die ein Jahr später zahlungsunfähig wurde, baute Personal ab. Das rettete die beiden Maler vielleicht vor dem Tod.
Von Martinique ist Gauguin begeistert, er zeichnet und malt die tropische Natur der Blumeninsel und die exotische Natürlichkeit ihrer Bewohner, am besten gefallen ihm die Menschentypen, zumal die schwarzen Frauen mit ihren bunten Kleidern, ihrem anmutigen Gang unter der Last auf dem Kopf und ihren graziösen, mit den wiegenden Hüften harmonierenden Gesten. Eine etwa sechzehnjährige Schwarze schenkt ihm eine eingedrückte Guajave, Gauguin beginnt zu essen, da reiβt ihm ein Mann die Frucht aus der Hand und wirft sie weit von sich und erklärt, die Guajave sei verhext, die Schwarze habe sie an ihrer Brust gerieben, damit Gauguin ihr ins Netz gehe. Bald darauf wirft es Gauguin und auch Laval um, doch das hat seinen Ursprung im Sumpf von Panama, als Kanalarbeiter haben sie sich Ruhr, Malaria, Gelbfieber oder sonstwas eingefangen. Im August schreibt Gauguin seiner Frau aus Saint-Pierre, er sei gerade dem Tod entronnen, kraftlos liege er in einer Negerhütte auf einer Seegrasmatte, er könne jetzt wieder aufstehen, doch nicht auch nur einen Kilometer zu Fuβ gehen, er sei zum Skelett abgemagert, das wenige, was er esse, bereite ihm grausame Leberschmerzen, »wie bedaure ich, nicht gestorben zu sein«. Seine letzten Geldreserven sind für Medikamente und einige Arztbesuche draufgegangen, der Arzt hält es für absolut notwendig, dass er nach Frankreich zurückkehrt, Gauguin unternimmt alles, um repatriiert zu werden. »Auf baldiges Wiedersehen, meine liebe Frau! Ich küsse dich und ich liebe dich!« Manchmal klingt er in seinen Briefen sentimental.
Laval wurde auf Staatskosten nach Frankreich zurückgeführt, Gauguin heuerte als Matrose auf einem Segler an, die Seeluft lieβ ihn wieder etwas zu Kräften kommen, doch die Schmerzen in den Eingeweiden hielten an. In Paris nahm ihn sein Freund Émile Schuffenecker auf, der Maler, Zeichenlehrer und ehemalige Kollege im Bankhaus Bertin, der Gauguin bei dessen ersten Schritten in die Welt der Malerei an die Hand genommen hatte. Gauguins Bilder aus Martinique finden »nur Bewunderer«, sie treffen den Geschmack am Exotischen und Ursprünglichen, das so unverdorben nicht mehr war, schlieβlich gehörte die Insel – mit kurzen Unterbrechungen – seit zweieinhalb Jahrhunderten zu Frankreich. Einige Bilder werden gekauft, von dem Erlös geht Gauguin in die Bretagne, wo er wilde Natur findet, aber auch die Ruhr ihn wieder packt, mehrere Rückfälle fesseln ihn ans Bett, und in der Pension gerät er in Zahlungsrückstand. Im Oktober 1888 fährt er in die Provence nach Arles, um dort mit Vincent van Gogh auf Kosten dessen Bruders Theo, des Kunsthändlers, zusammenzuleben und zu arbeiten. Sie lernen voneinander, aber passen nicht zusammen, wenigstens unternehmen sie gemeinsam nächtliche Gesundheitstrips in Kneipen und Bordelle. Aus Arles schreibt Gauguin an Schuffenecker: »Die Hygiene und der Beischlaf gut geregelt, dazu die Chance, in völliger Unabhängigkeit arbeiten zu können, nur so wird es einem rechten Mann gelingen, sich aus der Schlinge zu ziehen«. Am Ende geht Vincent van Gogh mit dem Messer auf Gauguin los, schneidet sich aber doch lieber das eigene Ohr ab.
Gauguin schlüpft wieder bei »Schuff« unter, in den folgenden beiden Jahren ist er mal in Paris und viel in der Bretagne, er macht Fortschritte in seiner Kunst, stellt seine Arbeiten aus, sie erregen Aufsehen, werden jedoch nicht gekauft, eine Ausstellung avantgardistischer Künstler während und neben der Exposition Universelle von 1889 wird ein Lacherfolg. Gauguin weiβ selber, dass seine Bilder noch unvollkommen sind, ungewisse Versuche, schwebende Ideen ohne einen bestimmten und endgültigen Ausdruck, doch dieser flüchtige Traum, in dem er die Vollendung ahnt, diese Minute, in der er den Himmel berührt, ist etwas viel Gewaltigeres als alle Materie, lieber nimmt er alles materielle Elend auf sich, als von seinem Traum zu lassen. Malen, nur um vom Verkauf seiner Bilder zu leben, will er nicht, selbst wenn er es könnte. Seiner Frau wirft er vor, die Kunst nur zu lieben, wenn der Künstler gut verdiene, sie habe ihn immer als Dukatenesel betrachtet. Als Angestellter würde er zwei- oder viertausend Francs verdienen, doch zwischen ihnen würde sich nicht viel ändern, sie hätten den gleichen Ärger miteinander, die gleichen Streitereien, die gleiche Hölle im Haus. Er darf die errungene Freiheit nicht gegen ein Schattendasein als Angestellter eintauschen, die Kunst ist sein Kapital, im Übrigen auch die Zukunft ihrer Kinder, denen sich alle Türen öffnen werden, weil sie Gauguin heiβen. Er kann nichts Besseres tun, als seine Kunst zu perfektionieren, das bringt ihm gegenwärtig nichts ein, aber er setzt alle Hoffnung auf die Zukunft. »Möge der Tag kommen, möge er nicht fern sein, an dem ich in die Wälder einer einsamen Insel im Stillen Ozean entfliehen werde, vom Wunsch beseelt, mich der Verzückung, dem Frieden und der Kunst hinzugeben, umringt von einer neuen Familie, fernab von diesem europäischen Kampf ums Geld. Dort auf Tahiti könnte ich in der Stille der schönen tropischen Nächte den sanft rauschenden Klängen in meinem Inneren lauschen (…). Endlich frei, ohne Sorgen um das Geld, würde ich alsdann lieben, singen und sterben.« Manchmal klingt Gauguin pathetisch-romantisch, kehrt den Idealisten, Träumer, Visionär, Besessenen heraus, der niemandem, nicht einmal sich selbst, nur seiner Mission verpflichtet ist, genauso wie Charles Strickland, der Gauguin Somerset Maughams in The Moon and Sixpence.
Im April 1890 schreibt Gauguin an Émile Bernard, den er in der Bretagne kennengelernt hat, er sei am Ende seiner Kunst, bei ihm herrsche jetzt Ebbe, und er halte es für überflüssig, den Kampf fortzusetzen, ohne Trümpfe in der Hand zu haben. Er steht kurz vor dem Verkauf einer Anzahl Bilder für 5000 Francs, von dem Geld will er sich neue Eindrücke, Ideen kaufen, sein Entschluss steht unwiderruflich fest, »ich fahre nach Madagaskar«. Er will dort auf dem Land ein Lehmhaus erwerben und vergröβern, die Erde bearbeiten und bepflanzen und wie die Eingeborenen leben, sich Modelle und alles andere für seine Studien beschaffen und das »Atelier der Tropen« gründen. Jemand aus Bourbon (La Réunion) hat ihm versichert, mit 5000 Francs könne man auf Madagaskar 30 Jahre lang leben, es sei spottbillig dort, allein die Jagd liefere genug Nahrung, »ich werde mich der Freiheit freuen und Kunstwerke schaffen«. Drei Jahre zuvor hatten Geschäftsleute ihn nach Madagaskar schicken wollen, wo er ein Unternehmen führen sollte, doch daraus war nichts geworden, und Gauguin hatte sich nach Panama gewandt und von Taboga fantasiert. Zwei Monate nach seinem Brief an Bernard schreibt er ihm, er bemühe sich um eine gute Stelle in Tongking, um dort ein, zwei Jahre zu arbeiten, Ersparnisse anzulegen, zu malen und neue Kraft zu schöpfen. Der ganze Ferne Osten sei der Mühe wert, studiert zu werden, der Westen dagegen sei verfault, aber alles, was noch gesund und lebensfähig, herkulisch sei, vermöge aus der Berührung mit dem Boden dort unten gestärkt hervorzugehen. Einen Brief später schwärmt er wieder von Madagaskar und besonders der Insel Mayotte (Komoren), wo die Frauen sehr sanft seien, genauso wie auf Tahiti, wo man fast ohne Geld leben könne, stattdessen von wilden Bananen, Brotfrüchten und Kokosnüssen. Gauguin und Bernard hatten gemeinsam von Tahiti geträumt und erwogen, zusammen nach Polynesien zu gehen.
Das Geschäft über 5000 Francs kam nicht zustande, obendrein verfiel Theo van Gogh, der Gauguin häufig unterstützt und viel unternommen hatte, um den Verkauf seiner Bilder anzukurbeln, nach dem Selbstmord seines Bruders Vincent dem Wahnsinn. Das war »ein entsetzlicher Schlag« für Gauguin, sein Madagaskar-Mayotte-Tahiti-Traum schien sich aufzulösen. Er organisierte eine Versteigerung seiner Werke, rührte die Werbetrommel, sogar in England wurde man auf ihn aufmerksam, die Auktion verlief glücklich, wenn auch in kommerzieller Hinsicht nicht übermäβig erfolgreich, doch der künstlerische Erfolg war nach Ansicht Gauguins »immens und wird in kurzem seine Früchte tragen«. Er ersuchte das Ministerium für Unterricht und Schöne Künste um Unterstützung, wurde mit der offiziellen, ebenso unbesoldeten wie unbestimmten künstlerischen Mission betraut, den Charakter und das Licht Tahitis zu erforschen, erhielt vom Staatssekretär für Kolonien eine verbindliche Empfehlung an den Gouverneur Französisch-Polynesiens, von der Schifffahrtsgesellschaft eine Fahrpreisermäβigung und vom Direktor der Schönen Künste die mündliche Zusage für den Ankauf eines Bildes nach seiner Rückkehr. Bevor er – ohne Bernard – nach Tahiti aufbrach, sah er Frau und Kinder in Kopenhagen wieder und schrieb, zurück in Paris, seiner »angebeteten Mette«, er ginge einer gesicherten Zukunft entgegen, und er werde sehr glücklich sein, wenn Mette bereit sei, die Zukunft mit ihm zu teilen. Er werde in den kommenden drei Jahren eine Schlacht schlagen, nach deren siegreichem Ausgang sie in Sicherheit leben könnten, »wenn ich zurückkomme, werden wir uns wieder verheiraten«. So schrieb er, während er seit Monaten mit einer Geliebten zusammenlebte, der er ein Kind machte. Seine Freunde gaben Gauguin noch ein Abschiedsbankett unter Vorsitz Mallarmés, dann nahm er den Nachtzug nach Marseille.
Im gleichen Jahr, in dem Rimbaud in Marseille starb, begann Gauguins polynesisches Leben. Nach zehnwöchiger Überfahrt mit Stationen in Aden, im französischen Mahé auf den Seychellen, in mehreren Häfen Australiens und in Nouméa (Neukaledonien) landete er Anfang Juni 1891 in Papeete. Gauguin kam 100 Jahre zu spät. »Dies war ja Europa – das Europa, von dem ich mich befreit zu haben glaubte –, nur noch vergröbert durch die Spielarten des kolonialen Snobismus und eine kindliche, bis zur Karikatur groteske Nachahmerei. Das war es nicht, was ich gesucht hatte«, schrieb er in seinem autobiografischen Bericht Noa Noa. Marinesoldaten, Matrosen von Walfängern, Deserteure wie Herman Melville, Abenteurer, Strandläufer, Missionare hatten Feuerwaffen, Alkohol, ansteckende Krankheiten und christliche Tugenden eingeschleppt, die Europäer hatten einen der acht Stammesfürsten Tahitis, Pomare I., gegen andere Stämme militärisch unterstützt und als König der gesamten Insel anerkannt, Pomare II. zum rechten Glauben bekehrt und ihm einen von anglikanischen Missionaren ausgeklügelten Katalog drakonischer Strafen für unchristliche Praktiken wie Götzenverehrung oder Unzucht zur Unterzeichnung vorgelegt. Als die französisch-katholische Konkurrenz auf den Plan trat und vom britischen Konsul, einem Missionar, ausgewiesen wurde, erschien die französische Fregatte »Reine Blanche« unter Konteradmiral Du Petit-Thouars auf der Bildfläche, und la Grande Nation nahm 1842 Tahiti als Protektorat unter ihre Fittiche, schlieβlich dankte Pomare V. 1880 ab, der ganze Archipel der Gesellschaftsinseln war nun französische Kolonie. Als Gauguin in Papeete eintraf, lag der pensionierte König gerade im Sterben, er wurde begraben und mit ihm die Tradition Tahitis; die Zivilisation – Militär, Verwaltung, Kirche, Handel – triumphierte. »War ich einen so langen Weg gekommen, um dies zu finden, eben dies, vor dem ich geflohen war? Der Traum, der mich nach Tahiti geführt hatte, wurde von der Gegenwart grausam zerstört: Es war das Tahiti der Vergangenheit, was ich liebte«, das romantische, exotische Tahiti aus Pierre Lotis Erfolgsroman Le Mariage de Loti von 1880 zum Beispiel.
Enttäuscht und »angeekelt von dieser ganzen europäischen Banalität« entschloss sich Gauguin, Papeete zu verlassen, um das Echte und Schöne der tahitianischen Kultur zu suchen, das sich unter dem »unpassenden Putz unserer Importe« erhalten haben mochte. Doch vorher musste er sich noch ins zivilisatorische französische Hospital begeben, er spuckte Blut, einen Viertelliter pro Tag. Der Arzt verordnete Senfumschläge für die Beine, Schröpfköpfe für die Brust und eine Digitaliskur gegen Herzschwäche, Gauguin schrieb zwar, dass es sich um die Überbleibsel einer Bronchitis handele, die er sich im Winter in Paris zugezogen habe, doch es war wohl ein erneuter Ausbruch jener venerischen Krankheit, die man Gauguin vor seiner Abreise aus Europa noch in Paris diagnostiziert hatte. Als er wieder auf den Beinen war, nahm er Titi an die Hand und ging mit ihr in den Busch, um ganz wie die Eingeborenen zu leben. Titi war eines jener gefälligen leichten Mädchen, die mit der Geschmeidigkeit und Anmut gesunder junger Tiere, mit schwingendem Hintern, spitz vorgestreckter Brust und einer wohlriechenden Blüte im Haar oder hinter dem Ohr barfuβ durch den Straβenstaub patschten. »Diesen Frauen von Tahiti liegt allen die Liebe so sehr im Blut, ist so sehr ein Teil ihres Wesens, dass sie, eigennützig oder uneigennützig, immer Liebe ist.« Unpassenderweise war Titi nicht gerade ein Ausbund an Reinheit und Schönheit des tahitianischen Menschenschlags, vielmehr halb Engländerin und halb Maori und nicht mehr ganz jung, aber sie wollte bei Gauguin bleiben und mit ihm in die Wildnis gehen, sprach praktischerweise auch etwas Französisch.
Die Hütte, die Gauguin im Bezirk von Mataeia an der Südküste mietete, 45 Kilometer von Papeete entfernt, lag zwischen dem Meer und einem ungeheuren Spalt im zerklüfteten Gebirge mit einem Mangohain davor. Zwischen Gauguin und dem Himmel war nichts weiter als das hohe, leichte Dach aus Pandanusblättern, über dem er nachts Mond und Sterne stehen sah. Tagsüber stand Titi zwischen ihm und dem Himmel. Er begann zu arbeiten, Material zu sammeln, Skizzen, Studien, Notizen zu machen, nicht nach dem Bild, das die Natur ihm zeigte, vor allem blickte und suchte er in sich selbst. Derweil langweilte Titi sich und redete zu viel, dies war nicht ihre Welt, sie war den städtischen Betrieb, die Schmeicheleien und den Luxus der französischen Kolonialbeamten gewohnt, Gauguin wurde ihrer überdrüssig, sie trennten sich. Monatelang sprach er kein Wort Französisch, nur die paar aufgeschnappten Brocken Tahiti-Maori mit seinen Nachbarn, die ihn nicht verhungern lieβen, hier konnte man für Geld nichts kaufen, musste alles aus der Natur holen, doch die Bananen wuchsen nicht in den Mund und die Fische sprangen nicht an Land, man musste in die Berge steigen und mit den Stauden auf dem Rücken zurückkehren, auf den Meeresgrund tauchen und die Muscheln von den Steinen lösen, musste wissen, wie man Fische fängt und auf hohe Bäume klettert, um eine Kokosnuss zu pflücken. Nicht die braunhäutigen Eingeborenen mit ihren Kannibalenkiefern, die ihm Essen brachten oder ihn einluden, waren hier die Wilden, sondern Gauguin, der weder die einfachsten Handgriffe noch Sprache und Sitten kannte. Nach dieser Logik zivilisierte er sich, während die westliche Verwilderung von ihm abfiel. Er begann, unkompliziert zu denken, sich von Hassgefühlen, Eitelkeit, innerer Unruhe und allem Erkünstelten zu befreien, wie er sich der Kleidung entledigte. Er ging barfuβ wie die Eingeborenen und nur mit einem geblümten Baumwolltuch um die Lenden, also nackt bis auf die Hauptsache, die die Frauen nicht sehen mochten, wie sie sagten. Wenn er nicht arbeitete, teilte er das Müβiggängerdasein seiner Nachbarn und lernte ihre Sprache. Abends versammelten sie sich in einer Art Gemeinschaftshütte oder unter den Kokospalmen, um zu plaudern und zu singen, die matten Farbtöne ihrer Körper passten gut zu dem Samt des Buschlaubs, und aus der bronzefarbenen Brust einer Sängerin stiegen schwingende Melodien und leidenschaftliche Schreie auf. Gauguin wurde fast einer von ihnen, trotzdem fühlte er sich einsam.
Er unternahm eine Reise zu Pferd, das ihm ein Gendarm lieh, zog an der Ostküste entlang, ein Eingeborener lud ihn in seine Hütte ein, eine Maori fragte ihn beim Essen, wohin er wolle und was er dort vorhabe, und Gauguin verriet ihr spontan den wahren, bis dahin ihm selbst vielleicht unbewussten Zweck seiner Reise: eine Frau für sich suchen. Und die Maori sagte: Ich gebe dir meine Tochter. So unkompliziert war das. Die Tochter hieβ Tehura und war ein Mädchen von vielleicht 13 Jahren, eine Kindfrau, die von den Tonga-Inseln abstammte. Tehura folgte dem Pferd zu Fuβ, unterwegs machten sie Halt in einer groβen, reich ausgestatteten Hütte, in der Tehuras zweite Mutter wohnte, ihre Ziehmutter, die Gauguin fragte, ob er Tehura glücklich machen werde. Ja. Sie gab ihm Tehura zur Probe mit, nach acht Tagen sollte er sie zurückschicken, und sie werde nicht zu ihm zurückgehen, wenn sie mit ihm nicht glücklich sei. Tehura ging nach acht Tagen und kehrte wenig später in Gauguins Hütte zurück. Und so begann »das vollkommen glückliche Leben«. Morgens badeten sie im nahen Bach wie Adam und Eva im Paradiesfluss, mittags hielten sie Siesta alle Tage nackt, wenn Gauguin malte oder schnitzte oder träumte, schwieg Tehura, sie störte ihn nicht und fiel ihm nicht lästig, sie kümmerte sich gewissenhaft um den Hüttenhaushalt, abends im Bett führten sie lange Gespräche über Gott und die alten Götter Tahitis und den Ursprung der Welt, und Gauguin erzählte ihr vom verfaulten Europa und schwängerte sie. »Himmel und Hölle! Ich muss also überall meine Saat aussäen.« Aber das war nicht weiter schlimm, auf Tahiti gab es kein schöneres Geschenk als ein Kind, welche Pflegemutter es wohl bekommen werde, fragte sich der vierundvierzigjährige, halb verfaulte Europäer.
In Noa Noa, diesem romantischen, idealisierenden Text, den Gauguin mit Nachhilfe des Schriftstellers Charles Morice im Winter 1893/94 in Paris ausarbeitete, um nicht zuletzt Stimmung für den Verkauf seiner Tahiti-Bilder zu machen, lieβ er sich über die Entstehung der Welt nach der Maori-Version, den Götterhimmel Tahitis, die Geheimgesellschaft der Insel, über Menschenopfer, Kannibalismus, Kindestötung und rituelle Prostitution aus, also über das alte Tahiti, das er liebte und nur aus dem Mund der jungen Tehura kannte und aus dem Buch Voyages aux Îles du Grand Océan von 1837 des belgischen Kaufmanns Jacques-Antoine Moerenhout, der von Chile aus durch die polynesische Inselwelt geschippert und zeitweise Konsul zunächst der Vereinigten Staaten, dann Frankreichs auf Tahiti gewesen war. Und in Noa Noa beschrieb Gauguin sein Leben als glücklicher Wilder unter den Relikten der besiegten Rasse und ihrer unterdrückten Kultur. In seinen Briefen aus Tahiti hingegen erzählte er eine andere Geschichte. Von Anfang an war er in Geldnot, zumindest wollte er den Adressaten seiner Briefe glaubhaft machen, dass er es sei, hauptsächlich seinem engsten Freund in dieser Zeit, dem Maler Daniel de Monfreid, der – neben Morice – für ihn als Verbindungsmann zur Pariser Kunstszene fungierte. Die Benefiz-Vorstellung im Pariser Théâtre d’Art zugunsten Gauguins und des verarmten Verlaine, die acht Wochen nach Gauguins Abreise aus Frankreich stattfand, warf keinen Gewinn ab, Gauguin hatte für sich mit etwa 1500 Francs Ausbeute gerechnet, »die werden mir hier schrecklich fehlen«, schreibt er im November 1891. Morice schuldet ihm Geld, aber schickt es nicht, Gauguin ist fassungslos, bereits im Mai 1892 überlegt er, nach Frankreich zurückzukehren, denn ohne Geld und ohne Aussicht auf Geld geht er vor die Hunde. Im Juni fährt er nach Papeete, will mit dem Gouverneur sprechen, um sich repatriieren zu lassen, vor der Tür des Gouverneurs trifft er einen Kapitän, der mit seinem Segelschiff alle Inseln abklappert und als Freibeuter gilt. Der Kerl drückt ihm 400 Francs in die Hand und sagt, er solle ihm ein Bild dafür geben, dann seien sie quitt. So etwas kann auch nur ihm passieren, meint Gauguin. »Meine ganze Existenz ist so: Ich stehe am Rande des Abgrundes und falle nicht hinein.« Wenig später sind die 400 Francs fast aufgegessen, er ist in der gleichen Lage wie zuvor und beantragt seine Rückführung nach Frankreich. Seit mehr als einem Jahr lebt er nun auf Tahiti, und die Pariser Galerien haben nichts verkauft. Er hat keine Leinwand mehr, aber zwei Holzschnitzereien gemacht und für 300 Francs verkauft. Dann bekommt er 300 Francs von Monfreid, damit kann er für den Augenblick durchhalten. Vor seiner Heimkehr nach Frankreich würde er gerne noch auf den Marquesas-Inseln arbeiten, doch dazu braucht er eine Summe, die ihm für einige Monate Ruhe verschafft. Die elenden Sorgen um das verfluchte Geld bereiten ihm geradezu Schmerzen, nicht dass er krank wäre, aber er ist abgemagert und schwach und ganz plötzlich erstaunlich alt geworden. Er isst und trinkt ja auch nichts, nur ein bisschen Brot und Tee, wollte er wilde Bananen im Gebirge holen, könnte er nicht arbeiten und bekäme einen Sonnenstich. Natürlich drückte er auf die Tränendrüse, doch übermäβig glücklich hörte er sich nicht gerade an.
Im November 1892 bekommt Gauguin aus Papeete Bescheid, er könne abreisen, wann er wolle. Anfang Dezember spricht er beim Gouverneur vor, der ihm eröffnet, er könne doch nicht abreisen, Paris habe gebeten zu prüfen, ob die Kolonie die Reisekosten tragen könne, eine solche Ausgabe erlaubten deren Finanzen jedoch nicht. Gauguin hatte sich schon darauf eingestellt, im Januar Tahiti zu verlassen; bis die Entscheidung eingeht, ob Paris die Kosten übernimmt, wird es Ende April werden, jetzt sitzt er wieder mit 150 Francs in der Tasche da. Ende Dezember sind es noch 50 Francs, Gauguin ist vollkommen niedergeschlagen. »Wenn ich richtig darüber nachdenke, so muss ich nach meiner Rückkehr mit der Malerei aufhören, die mich nicht zu ernähren vermag.« In 18 Monaten hat er nicht einen Centime mit seiner Malerei verdient, wovon soll er leben, wovon auch nur seine Farben kaufen? Gewiss, er wird einige Bilder nach Frankreich mitbringen, und diese Bilder sind besser als alles, was er bisher gemalt hat, doch das heiβt auch: noch schwerer zu verkaufen. »Ich sitze in der Tinte.« Im Februar 1893 steckt er »im gröβten Dreck«, er muss mindestens noch drei Monate warten, bis er abfahren kann, vorausgesetzt, der Minister genehmigt seine Repatriation. Gauguin erfährt, dass Morice ihm die erkleckliche Summe von 1353 Francs schuldet und Madame Gauguin in Kopenhagen Bilder für mehr als 2000 Francs verkauft hat; das Geld behält sie ein, schlieβlich zahlt er keinen Unterhalt für sie und die fünf Kinder. Von dem Geld könnte er seine Rückreise und den geplanten Abstecher nach den Marquesas selbst finanzieren, »ich bin toll vor Wut! Nur der Zorn hält mich noch aufrecht«. Dann findet er jemanden, der ihm gegen Zinsen und einige Bilder als Bürgschaft das Reisegeld vorschieβt, falls die französische Regierung ihn nicht auf Staatskosten zurückführt; so oder so wird er sich Anfang Mai einschiffen. Monfreid schickt ihm 300, dann noch einmal 700 Francs, hätte er das Geld einen oder zwei Monate früher erhalten, wäre er nach den Marquesas gefahren, aber das nächste Schiff zu den Inseln geht nun erst anderthalb Monate später ab, und er ist müde von dem ganzen Gerangel, er begräbt also seine Marquesas und wird eines Tages in Paris auftauchen, mit 66 mehr oder weniger guten Bildern und einigen ultrawilden Schnitzereien unter dem Arm.
In Noa Noa heiβt es am Schluss, gebieterische Familienangelegenheiten hätten Gauguin heimgerufen. »Ich scheide um zwei Jahre älter, um zwanzig Jahre jünger, barbarischer auch als bei meiner Ankunft, und doch wissender. Ja, die Wilden haben den alten Kulturmenschen viele Dinge gelehrt, (…) Dinge vom Wissen um das Leben und von der Kunst, glücklich zu sein.« Als Somerset Maugham im Jahr 1916 den Weg nach Mataeia fand, zeigte man ihm ein Haus, in dem sich drei Bilder Gauguins befinden sollten. Es war ein höchst schäbiges Holzhaus, so Maugham, grau und baufällig, auf der Veranda wimmelte es von schmutzigen Kindern, ein junger Mann lag auf dem Boden und rauchte, eine Frau saβ müβig daneben – die glücklichen Eingeborenen. In dieser Hütte war Gauguin eine Zeitlang von den Eltern des jetzigen Besitzers gepflegt worden, zum Dank hatte er die Bilder hinterlassen. Im Innern gab es keine Möbel, nur Strohmatten, und in einem der beiden Zimmer befanden sich drei Türen, zur Hälfte aus Glas, die Glasscheiben hatte Gauguin bemalt. An zweien waren Reste zu erkennen, die die Kinder noch nicht abgekratzt hatten, das dritte war ganz gut erhalten, dieses wollte Maugham käuflich erwerben. Der Hausherr verlangte nur den Wert einer neuen Tür als Bezahlung; was Gauguin so viel wert gewesen war, die Malerei, war dem edlen Wilden nichts weiter wert. Der Kulturmensch Maugham gab ihm das Doppelte, schraubte die Schaniere ab und sägte die untere Türhälfte ab, um das Bild leichter transportieren zu können.
Völlig abgebrannt kommt Gauguin im August 1893 in Marseille an. Von den 1000 Francs Monfreids hat er auf Tahiti seine Schulden beglichen, in Nouméa, wo er 25 Tage auf ein Anschlussschiff warten musste, Hotel und Gepäckaufbewahrung bezahlt und auf dem Schiff 400 Francs Zuschlag für die zweite Klasse abgedrückt, denn es befanden sich 300 Soldaten an Bord und jeder in der dritten Klasse hatte nur einen halben Quadratmeter Platz. »Teufel, welch dreckige Reise!« In Sydney herrschte Kälte, bis zu den Seychellen schlechtes Wetter, im Roten Meer unerträgliche Hitze, drei Hitzetote wurden über Bord gekippt. Gauguin telegrafiert seinen Freunden, sie sollen ihm Geld schicken, damit er von Marseille nach Paris fahren kann. In Paris erfährt er, dass sein Onkel in Orléans »den glücklichen Einfall zu sterben« hatte, die kleine Erbschaft muss er sich mit seiner Schwester teilen, für sich erwartet er etwa 10 000 Francs, mit deren Auszahlung ist aber erst in ein paar Monaten zu rechnen. Er stürzt sich in die Arbeit zur Vorbereitung der groβen Ausstellung seiner Tahiti-Bilder, die ihm den erhofften Durchbruch bringen soll, sowohl die breite Anerkennung als Künstler als auch die Aussicht auf eine finanziell einigermaβen gesicherte Zukunft. Er kauft Rahmen auf Pump, lässt Plakate und den Katalog drucken, zu dem Morice das Vorwort verfasst, zusammen mit Morice arbeitet er an Noa Noa, das Opus soll Verständnis für seine Kunst wecken, erscheint allerdings erst 1897 in der Revue Blanche in Fortsetzungen und 1901 als Buch. Mehr als 40 Bilder aus Tahiti hängt er in der Galerie Durand-Ruel aus, doch die Ausstellung wird ein Fiasko. Blaue Bäume, rote Hunde und überhaupt die grellen Farben, nachgeäffte Götzen primitiver Blumenkinder, unbegreifliche Symbole des heidnischen Aberglaubens der Wilden vom anderen Ende der Welt und die unverständlichen Titel in Maori-Sprache – das soll Kunst sein? Die Reaktion des Publikums verletzt Gauguin, die Kritik, der Hohn, das Gelächter, wo er doch mit Bewunderung, Begeisterung gerechnet hat, er wendet sich abermals innerlich von Europa und den Europäern ab, im Übrigen deckt der Verkaufserlös nicht einmal seine Unkosten.
Als er sein Erbteil erhält, löst er Schulden ab, schickt Mette eine Summe, gibt seiner Pariser Geliebten von 1890/91, die ein Kind von ihm hat, etwas ab und richtet sich ein Atelier ein, in dem er mit Annah »la Javanaise« lebt, der dreizehn- oder vierzehnjährigen Mulattin indisch-singhalesisch-malaiischer oder sonst welcher Herkunft, die mitsamt einem Äffchen zu ihm gekommen ist und als Hausmädchen, Modell und Gespielin dient. Mit Annah und dem Äffchen zieht er sich im April 1894 in die Bretagne zurück, eines schönen Maitages macht die malerische Malertruppe nebst aufgetakelten Gattinnen und Geliebten einen Ausflug von Pont-Aven zum alten Fischerort Concarneau, wo man schrille Aufzüge extravaganter Bohemiens und zirkusreifer Artisten mit Affen an der Leine nicht gewohnt ist. Kinder laufen hinter ihnen her, machen sich vornehmlich über Annah und den Affen lustig, werfen schlieβlich mit Steinen nach der Gruppe. Einer der Maler zieht einem Bengel die Ohren lang, da stürzt dessen Vater aus der Hafenkneipe und streckt den Maler mit einem Faustschlag nieder, woraufhin dem Vater das Gleiche durch Gauguins Faust widerfährt. Ein Haufen Seeleute macht sich über Gauguin her, der sich wehrt, bis er über ein Loch im Boden stürzt und sich den Knöchel bricht. Bis ans Ende seiner Tage sollte er unter den Folgen dieser Schlägerei zu leiden haben.
Die unmittelbare Folge war, dass er monatelang das Bett hüten musste. Er hat »furchtbare Schmerzen«, besonders nachts, wenn er nicht schlafen kann, also nimmt er Morphium und ist ganz benommen. Als er wieder aufstehen kann und Gehversuche macht, hinkt er und muss am Stock gehen. Obendrein hat er hohe Ausgaben für Arzt und Medizin und Kost und Logis. »Das alles ist nicht sehr lustig und trägt nicht eben dazu bei, dass ich in diesem schmutzigen Europa zu bleiben wünsche«, schreibt er Monfreid. Er fasst den Entschluss, »für immer in Ozeanien zu leben«. Schuffenecker kündigt er an, sobald wie möglich werde er sein »Talent bei den Wilden vergraben«, und man werde nichts mehr von ihm hören. »Leb wohl, Malerei.« Sowie er dazu imstande sei, will er nach Paris zurück und seinen »ganzen Laden« verhökern. Als er im November in Paris eintrifft, ist sein Laden leer. Annah, die schon im September von Pont-Aven abgereist war, hat das Atelier geplündert und ist verschwunden. Was ihr Wert zu haben schien, hat sie mitgehen lassen, nur der »Schund« ist Gauguin geblieben: die Bilder.
Er organisiert die Versteigerung seines Restbesitzes und bittet August Strindberg, den er durch seine Nachbarn, schwedische Künstler, kennengelernt hat, das Vorwort für den Katalog zu schreiben. Strindberg erklärt ihm in einem langen Brief, er könne und wolle das Vorwort nicht liefern, weil er Gauguins Kunst nicht begreife und nicht liebe. Prompt druckt Gauguin diesen abschlägigen, doch wohlwollenden Brief als Vorwort ab, zusammen mit seinem erhellenden Antwortschreiben. Die Versteigerung vom Februar 1895 wird trotzdem ein Reinfall, die Ausbeute bleibt weit hinter Gauguins Erwartungen zurück. Zu allem Überfluss schlägt die Syphilis wieder zu, sein ganzer Körper ist mit Ausschlag bedeckt, auβerdem machen sich bereits Sehschwäche und Gedächtnisschwund bemerkbar. Anfang Juli kann er endlich in See stechen, bloβ weg von Europa.
Über Australien und Neuseeland erreichte Gauguin im September 1895 Tahiti. In Punaauia an der Westküste lieβ er sich auf einem gepachteten Stück Land eine Hütte bauen, »einen groβen Vogelkäfig mit Bambusstäben und Kokosdach« zwischen dem Strand und dem »überwältigenden Gebirge« im Rücken. Vorhänge teilten die Hütte in ein helles Atelier und ein dunkles, aber luftiges Schlafzimmer, »alle Nächte treiben sich verteufelte Mädchen in meinem Bett herum, gestern sind drei angetreten«, schreibt er im November an Monfreid, »ich bin im Augenblick nicht zu beklagen«. Auch Tehura, seine vormalige Gefährtin, die jetzt ganz christlich verheiratet ist, besucht ihn und schwänzt acht Tage lang die Ehe, Gauguin ist »gezwungen, ihrem Gatten Hörner aufzusetzen«, aber Tehura bleibt nicht bei ihm. Da nimmt er die dreizehnjährige Pahura zu sich, mit der er bis ans Ende seiner Tahiti-Tage zusammenleben wird, ohne Trauschein, versteht sich. Das Leben ist so heiter und leicht auf Tahiti wie die Mädchen, und künstlerische Arbeit ist so heilsam, dass es Wahnsinn wäre, woanders nach dem Paradies zu suchen. Er fühlt sich groβ in Form, will auf Teufel komm raus arbeiten und glaubt, bessere Bilder als früher machen zu können. Er will weder Ruhm noch Luxus, einzig und allein in seinem »herrlichen Erdenwinkel« in Ruhe leben, in voller Freiheit zur eigenen Befriedigung arbeiten und sein Leben in seiner stillen Hütte beschlieβen.
Gauguins Leben auf Tahiti verlief in Wellen, die meiste Zeit trieb er im Tal. Schaffensphasen wechselten mit langer Untätigkeit ab, je nach Gesundheitszustand, finanzieller Lage und Moral. »Wie immer, wenn ich Geld in der Tasche habe, gebe ich es aus, ohne zu rechnen (…), und eines Tages sitze ich wieder auf dem Trockenen.« Im selben Atemzug rechnet er: Nach Bezahlung seines Hauses bleiben ihm noch 900 Francs, und seine Auβenstände belaufen sich auf mehr als 4000 Francs. Fünf Monate später ist er nicht nur am Ende seines Geldes, vielmehr hat er schon wieder 1000 Francs Schulden und ist auch am Ende seiner Kräfte. Seit seiner Ankunft verschlechtert sich sein Gesundheitszustand »mit jedem Tag«, sein gebrochener Knöchel bereitet ihm groβe Schmerzen, der Arzt bekommt es nicht fertig, die Wunde zu schlieβen, und offene Wunden sind in den Tropen eine heikle Sache. Er liegt am Boden und fühlt sich als Versager, lässt sich im Hospital behandeln, das er nicht bezahlen kann, wird zur Hälfte geheilt, wenigstens hören die Schmerzen auf, aber er ist sehr schwach, und das ist auch kein Wunder, er hat nur Wasser zu trinken und in Wasser gekochten Reis zu essen, seit einem Jahr, das er nun auf Tahiti ist, bekommt er von seinen Schuldnern in Paris nicht einen roten Heller, klagt er. Da erhält er 400 Francs, die Schuffenecker für ihn aufgetrieben hat, davon zahlt er die dringendsten Schulden zurück, er will versuchen, von dem Rest ein paar Monate zu leben. »Wann hört dieses Martyrium auf!« Es macht ihm keine Freude mehr, einen Pinsel anzurühren, sein Fuβ ist immer noch nicht heil, Gauguin ist demoralisiert, mutlos und müde.
Nur einen Monat später geht es Gauguin »viel besser«, er beginnt, gesund zu werden, meint er, wäre es nicht so, würde er sich eine Kugel durch den Kopf jagen. Er arbeitet wieder, macht Tonskulpturen für seinen Rasen, eine nackte Frau, einen Löwen, seine eingeborenen Nachbarn sind ganz platt, auf Tahiti gibt es keine wilden Tiere. Stolz berichtet Gauguin, dass er bald Vater eines Mischlings wird, »meine reizende Dulcinea hat sich zu brüten entschlossen«. Und er bekommt eine gröβere Summe von seinen Galeristen, mit dem Geld bezahlt er ausstehende Rechnungen, kauft Medikamente und Malutensilien und hofft, sechs oder acht Monate in Ruhe leben zu können. Doch kaum steht er im Begriff zu gesunden, kaum hat er ein bisschen Geld und malt wieder Bilder, da erreicht ihn aus Kopenhagen die »fürchterliche« Nachricht vom Tod seiner Tochter Aline. Mette teilt ihm kurz und kühl, »rücksichtslos« mit, dass Aline nach wenigen Tagen an einer Lungenentzündung gestorben ist. Gauguins einzige Tochter mit Mette war gerade 20 Jahre alt geworden, in seiner Antwort weist Gauguin seine Frau darauf hin, dass Aline den Namen seiner Mutter trug, es sollte sein letzter Brief nach Kopenhagen bleiben. Später unterrichtet Mette ihren Mann nicht einmal über den Tod Clovis’, des nach Gauguins Vater geheiβenen Sohnes, der den Winter 1885/86 mit ihm im Pariser Elend verbracht hatte und mit 21 Jahren nach einer Operation an Blutvergiftung starb. Kurz vor Aline war auch Gauguins Tochter mit Pahura wenige Tage nach der Geburt gestorben. Und er hat erfahren, dass er seine Hütte räumen muss. Gauguin ist »ganz verzweifelt«.
Der Eigentümer des Grundstücks, auf das Gauguin seine Hütte gestellt hat, ist gestorben und hat verwickelte Verhältnisse hinterlassen, Gauguin muss die Hütte abreiβen, ein anderes Stück Land suchen und ein neues Haus bauen. Ganz in der Nähe steht die einzige verfügbare Parzelle zum Verkauf, die mit ihren 100 Kokospalmen viel zu groβ für ihn ist, für 700 Francs kann er sie haben. Das rentiert sich, die Kokosbäume bringen 500 Francs im Jahr ein, kalkuliert er, auβerdem will er Vanille pflanzen, die nicht viel Aufwand erfordert und guten Ertrag abwirft. Da der Nachschub an Geld aus Paris wieder stockt, ist er gezwungen, vor der widerspenstigen Bank in Papeete einen Kniefall zu machen, um einen Kredit von 1000 Francs über ein Jahr zu bekommen. »Mein Leben voller Schulden soll also wieder beginnen.« Die Schulden wachsen und wachsen, bald kriegt er beim Chinesen nicht einmal mehr Brot auf Kredit, die Geldsorgen tragen nicht unerheblich dazu bei, dass es gesundheitlich abermals bergab mit ihm geht, »meine Krankheit«, die Maladie française, befällt ihn mit Macht von neuem, das Brennen in den Beinen, der Ausschlag, Schwindelanfälle, Augenentzündung, Fieber, Herzbeschwerden, Atemnot und das Blutspeien, er fürchtet sehr, nie wieder ganz gesund zu werden. Er sieht schwarz und ist ohne jede Hoffnung, sieht nichts als den Tod, der von allem befreit. »Wahnsinniges, aber trauriges und böses Abenteuer, meine Reise nach Tahiti.« Das Paradies ist nicht anderswo – wo, wenn nicht auf Tahiti, sollte es liegen? –, es ist entweder nirgendwo, denn man schleppt sich und seine Vergangenheit überallhin mit, oder es liegt in einem selbst, dann kann es überall sein.