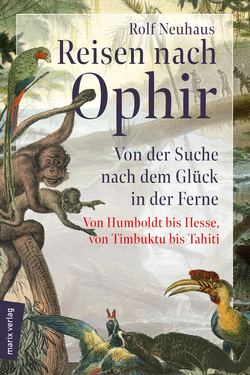Читать книгу Reisen nach Ophir - Rolf Neuhaus - Страница 7
2. Abgetrieben – Alexander von Humboldt zwischen Südsee und Orient
ОглавлениеDer Drang, bestimmte Orte, Länder, Landschaften zu sehen, hängt nicht allein von ihrer Schönheit, Bedeutung oder Groβartigkeit ab, sondern auch von zufälligen Eindrücken der Jugend, meinte Alexander von Humboldt. Die Unwahrscheinlichkeit, solche Reiseziele zu erreichen, erhöht dabei noch ihren Reiz, verstärkt die Sehnsucht. Schon als Kind beeindruckten Humboldt die Erzählungen von dem grauenhaften Marsch des Vasco Núñez de Balboa über die Landenge von Panama, wo dieser Abenteurer im Jahr 1513 als erster Europäer den Pazifischen Ozean erblickt hatte. In seiner Jugend erregten die jüngsten Südseefahrten und Weltumseglungen Bougainvilles, Cooks und anderer Entdecker Humboldts besonderes Interesse, in ihm wuchs die Leidenschaft für das Meer und längere Schiffspassagen heran. Als er dann in Göttingen Georg Forster kennenlernte, der an Cooks zweiter Pazifikfahrt teilgenommen hatte, und als Forster ihm auf ihrer gemeinsamen Reise den Rhein hinunter nach den Niederlanden und weiter nach England und Frankreich von den Inseln des Stillen Ozeans und besonders von O-Taheiti (Tahiti) erzählte, steigerte sich Humboldts schon von früher Jugend auf gehegter Wunsch noch, »in die schönen Länder des heiβen Erdgürtels« zu reisen und ferne, von Europäern kaum berührte Welten zu erforschen. 1797 war es so weit: Nach dem Tod seiner Mutter und dem Antritt des Erbes, das ihn finanziell unabhängig machte, pfiff er auf seine Bergbeamtenkarriere, quittierte den Staatsdienst und schmiedete Pläne für ausgedehnte Forschungsreisen. Doch manche seiner Reisewünsche blieben unerfüllt, die Wirklichkeit verweigerte sich seinen Träumen, selbst ein Humboldt war ein Spielball der Umstände, und seine Reisen hingen ebenso vom Zufall ab wie die Eindrücke der Jugend. Aus ihm wurde ein zweiter Kolumbus, der wissenschaftliche Entdecker Amerikas, wie man ihn genannt hat, er leistete eine immense Forschungsarbeit in vielen Einzeldisziplinen und zugleich in universeller Sicht, aber er befuhr nicht die Südsee, und er sah Indien nicht.
Alexander besuchte seinen Bruder Wilhelm in Jena, betrieb dort mit Goethe naturwissenschaftliche Studien, in Dresden astronomische, in Wien botanische, in Salzburg geologische Forschungen, anschlieβend wollte er nach Italien, um vulkanologische Untersuchungen am aktiven Objekt – Vesuv, Stromboli, Ätna – durchzuführen, musste aber davon absehen, weil in Italien erneut der Krieg ausbrach und Napoleon wieder einmal Ordnung schaffte. Zum Trost schlug ihm der exzentrische Reise-, Kunst-, Altertums- und Frauenliebhaber Lord Bristol, Bischof von Derry, Namensgeber der Hotels, einen kleinen Ausflug von nur acht Monaten nach Oberägypten vor, mit Zeichnern und astronomischen Instrumenten den Nil bis Assuan hinauf; Humboldt willigte ein, behielt sich aber vor, auf der Rückreise allein einen Abstecher nach Syrien und Palästina zu machen. Doch Lord Bristol wurde in der französischen Satellitenrepublik Mailand verhaftet, Napoleon ging selbst nach Ägypten, begleitet nicht nur von mehr als 30 000 Soldaten, sondern auch von bald 200 Ingenieuren und Gelehrten, die das Land erschlieβen sollten, sodass für fremdländische Einzelkämpfer überhaupt keine Aussicht bestand, dort in Ruhe forschen zu können. Humboldt begab sich in die damalige Welthauptstadt der Wissenschaften, Paris, um sich mit modernen Beobachtungs- und Messinstrumenten einzudecken und in den Instituten, Akademien und Salons Kontakte zu knüpfen, er tauschte sich mit Geologen, Astronomen, Mineralogen, Zoologen aus, traf den alten Bougainville und den jungen Aimé Bonpland, der als Naturforscher an der Weltumsegelung Kapitän Baudins teilnehmen sollte, die gerade vorbereitet wurde. Humboldt erhielt vom Direktorium, der französischen Regierung, die Erlaubnis, auf eigene Faust an der Baudin-Expedition teilzunehmen, die an die Küsten Südamerikas und um das Kap Hoorn bis nach Panama hinauf und durch die Inselwelt der Südsee nach Neuseeland, Tasmanien und Neuholland (Australien) führen und über Madagaskar und um das Kap der Guten Hoffnung herum zurückkehren sollte. Humboldt genoss einige Monate lang die Vorfreude, sich mit seinen Geräten auf einer der beiden Korvetten zu einem solch groβen Unternehmen einzuschiffen, sich im Übrigen von der Expedition trennen zu dürfen, wo und wann es ihm beliebte, um seinen eigensten Interessen nachzugehen, da drohte ein neuer Krieg zwischen Frankreich und den antirevolutionären europäischen Koalitionsmächten auszubrechen, die Baudin-Expedition wurde abgeblasen und auf unbestimmte Zeit verschoben. »Da beschloss ich, nur so bald als möglich, wie es auch sei, von Europa wegzukommen.«
In Paris lernte Humboldt den schwedischen Konsul des türkischen Algier kennen, der sich auf der Durchreise nach Marseille befand, von wo ihn eine schwedische Fregatte nach Nordafrika bringen sollte. Der Konsul glaubte, beim Bey von Algier für Humboldt die Erlaubnis erwirken zu können, das noch von keinem Mineralogen untersuchte Atlasgebirge bereisen zu dürfen. Auch schickte der Bey jedes Jahr ein Schiff nach Tunis, mit dem Mekka-Pilger nach Ägypten fuhren; Humboldt sollte es ebenfalls benutzen können. Kurzentschlossen hasteten Bonpland und er nach Marseille, um die schwedische Fregatte nicht zu verpassen, aber die Fregatte kam und kam nicht nach Marseille. Nach zwei Monaten ungeduldigen Wartens erfuhren sie aus den Zeitungen, dass das Schiff vor der Küste Portugals in einen Sturm geraten und schwer beschädigt worden war und das spanische Cádiz hatte anlaufen müssen, um repariert zu werden, was mindestens ein halbes Jahr in Anspruch nehmen würde. Zertrümmerte Masten, zertrümmerte Hoffnungen. Doch Humboldt gab nicht auf. Im Hafen von Marseille lag ein kleines Schiff aus Ragusa (Dubrovnik), das im Begriff stand, nach Tunis auszulaufen: eine günstige Gelegenheit, näher an Ägypten und Syrien heranzukommen. Sie einigten sich mit dem Kapitän über den Preis für die Überfahrt, am nächsten Tag sollten sie unter Segel gehen, im letzten Moment verzögerte sich die Abfahrt wegen einer Kleinigkeit – glücklicherweise, denn so erreichte sie noch die Nachricht, dass die Regierung in Tunis neuerdings alle dort ansässigen Franzosen verfolge und alle aus französischen Häfen kommenden Personen ins Gefängnis werfe. Aus der Traum. Humboldt und Bonpland beschlossen, den Winter in Spanien zu verbringen, in der Hoffnung, sich im folgenden Frühjahr in Cádiz oder Cartagena nach dem Orient einschiffen zu können. Ende Dezember 1798 machten sie sich auf den Weg nach Katalonien.
In Madrid wies der sächsische Gesandte am spanischen Hof Humboldt darauf hin, dass die Möglichkeit bestehe, von der Regierung die Erlaubnis zu erhalten, auf eigene Kosten durch das Innere Spanisch-Amerikas zu reisen. Humboldt erhielt Zugang zur Regierung und in der Frühjahrsresidenz Aranjuez eine Audienz beim König, bei der er Gründe und Vorteile einer Forschungsreise in die spanischen Besitzungen von Amerika und nach den Philippinen darlegte, die er später in einer Denkschrift ausformulierte. Der Vorschlag wurde wohlwollend aufgenommen und Humboldt ermächtigt, mit seinem »Diener« (Bonpland) nach Spanisch-Indien überzusetzen und dort alle Beobachtungen, Messungen, Probeentnahmen und sonstige Studien durchzuführen, die er zur Förderung der Wissenschaften für angebracht hielt. Er begab sich mit Bonpland nach La Coruña, wo sich ihre Einschiffung nach Kuba verzögerte, weil drei britische Schiffe den Hafen blockierten; England hatte eine Seeblockade über das napoleonische Frankreich und verbündete Länder verhängt. Am 5. Juni 1799 stahl sich die Korvette »Pizarro« bei dichtem Nebel und günstigem Wind aus dem Hafen, obwohl die Küstenwacht ein britisches Geschwader vor der Nordwestecke Spaniens signalisiert hatte. Vor der Küste Portugals sichtete die »Pizarro« einen weiteren englischen Konvoi und wich im Schutz der Dunkelheit von ihrem Kurs ab, um nicht von den Brits gejagt zu werden. Bei ihrer Ankunft in Santa Cruz de Tenerife lief sie im dichten Nebel an mehreren britischen Schiffen vorbei, ohne sie zu bemerken und von ihnen bemerkt zu werden. Wäre sie aufgebracht worden, hätten Humboldt und Bonpland sich von ihrem amerikanischen Traum verabschieden können und wie alle anderen Passagiere ihrer Rückführung nach Europa entgegengesehen.
Humboldt war begeistert von Teneriffa, insbesondere von der Vegetation und der Gartenlandschaft im Westteil der Insel und vom Teide, gegen den der Vesuv bloβ ein Hügel war. Der Kapitän der »Pizarro« hatte Befehl zu warten, bis Humboldt von der Besteigung des Teide zurückkehrte. »Fast mit Tränen reise ich ab«, schrieb Alexander seinem Bruder Wilhelm in einem Brief aus Orotava, »ich möchte mich hier ansiedeln«. Vorerst aber lockten die Tropen. Auf der Überfahrt nach Amerika wurde er nicht müde, nachts die Schönheit des südlichen Himmels zu bewundern, und es erfüllte sich ein Jugendtraum, als er zum ersten Mal das Kreuz des Südens erblickte. Doch die Tropen zeigten sich auch von ihrer hässlichen Seite. Auf der »Pizarro« brach ein bösartiges Fieber aus, mehrere Infizierte delirierten schon am zweiten Tag nach den ersten Anzeichen, die Krankheit drohte epidemisch zu werden, nicht eine Unze Chinarinde befand sich an Bord, nur ein Ignorant von Wundarzt, der Aderlässe verordnete. Gleich vielen anderen Passagieren beschlossen Humboldt und Bonpland, in Cumaná (Venezuela), dem östlichsten Hafen Spanisch-Amerikas, an Land zu gehen und später mit einem anderen Paketboot nach Kuba oder Mexiko weiterzusegeln. Sie wollten den Zwischenstopp von ein paar Wochen dazu nutzen, das Hinterland Cumanás ein wenig zu erkunden; aus einigen Wochen wurde dann mehr als ein Jahr. Ohne die Seuche an Bord der »Pizarro« wären sie nie an den Orinoko und bis an die Grenze der portugiesischen Besitzungen am Río Negro gekommen.
Wunder über Wunder fanden Humboldt und Bonpland in Cumaná und Umgebung: Bäume mit ungeheuren Blättern und Blüten, Vögel und Fische in leuchtenden Farben, prachtvolle Pflanzen, von denen sie 1600 sammelten, darunter 600 unbekannte – eine verschwenderische Überfülle der Natur. »Ich fühle es, dass ich hier sehr glücklich sein werde«, gestand Humboldt seinem Bruder. Über Caracas zogen sie auf Maultieren in die Llanos, diese weite, unermessliche, völlig ebene Einöde ohne jegliche Anhöhe, ebener als die Wüste oder selbst das Meer, aber heiβ und stauberfüllt wie die Wüste, unter glühendem Himmel ohne einen Lufthauch, als wäre die ganze Natur erstarrt – groβartig und deprimierend. Es schien, als wiche der Horizont beständig vor ihnen zurück, so wie er vor Georg von Speyer, Nikolaus Federmann und Philipp von Hutten und deren Landsknechten zurückgewichen sein musste, als sie Mitte des 16. Jahrhunderts für das Augsburger Bank- und Handelshaus der Welser, Statthalter von Venezuela, die Llanos durchquerten, um jenseits des Río Apure und anderer Flüsse einem Hirngespinst nachzujagen, nämlich Eldorado im reichen Land der Omagua zu suchen. Einige Jahre darauf machten sich Pedro de Ursúa und Lope de Aguirre mit ihren Spaniern und Indios von Peru auf den Weg, das sagenhafte Reich der Omagua zu erreichen, das Timbuktu des neuen Kontinents, wie Humboldt es nannte, fuhren den Amazonas hinunter und erreichten bloβ, sich gegenseitig zu zerfleischen. Humboldt und Bonpland fuhren den Apure zu Beginn der Regenzeit hinunter, in einer Piroge mit vier indianischen Ruderern plus Steuermann und einer kleinen palmblattgedeckten Hütte am Heck, hier und da waren die Ufer bewaldet, Tapire, Wasserschweine und der Jaguar kamen zum Saufen an den Fluss, auf dem Sand lagen regungslos Krokodile, Vögel mit buntem Gefieder und Federbusch stolzierten am Wasser entlang, es war wie im Paradies, alles erinnerte an den Urzustand der Welt, doch Humboldt wäre nicht Humboldt gewesen, hätte er nicht genau beobachtet und erkannt, dass die Tiere einander fürchteten und mieden. Einmal ging er am Ufer auf eine Gruppe von Krokodilen zu, um sie aus der Nähe zu beobachten, da stieβ er auf die frische Fährte eines Jaguars, die in Richtung Wald wies, und sah das prächtige Kätzchen 80 Schritt entfernt im Gebüsch liegen. Er erschrak, tat aber doch, was die Indios für solche Fälle geraten hatten: weitergehen, ohne zu laufen, die Arme möglichst nicht bewegen. Dann kehrte er scheinbar ruhig zurück, spazierte vor den Augen der Bestie am Wasser entlang und widerstand eine Zeitlang der Versuchung, sich umzusehen. Manchmal ist das Paradies die Hölle.
An der Mündung des Apure in den Orinoko kamen sie in ein ganz anderes Land. Vor ihnen dehnte sich eine gewaltige Wasserfläche aus, einsam und majestätisch, wie ein See ohne Ende. Diesen Eindruck rief nicht nur die Breite des Orinoko hervor, sondern auch dessen kahle, sandige Ufer, die infolge der Luftspiegelung Lachen stehenden Wassers zu sein schienen und die Konturen des Stroms verwischten. In dieser flüssigen Wüste wären sie beinahe gekentert. Bei einem unglücklichen Manöver des Steuermanns mitten auf dem Fluss, den sie hinaufsegelten, fuhr ein heftiger Windstoβ in das Segel, sodass die Piroge fast umgeschlagen wäre. Über ein Bord stürzte Wasser ins Boot, Humboldt schrieb gerade Tagebuch, im nächsten Augenblick schwammen Papiere, Bücher und getrocknete Pflanzen umher, die Piroge verharrte in ihrer Schieflage, die Bordkante im Wasser. Die Indios waren schon drauf und dran, ins Wasser zu springen, das voller Krokodile sein musste, und ans Ufer zu schwimmen, das eine halbe Meile entfernt lag. Selbst wenn sie Land erreicht hätten, wären sie dort vom Hunger oder vom Jaguar verzehrt worden. Sich durch die Wälder schlagen zu wollen, war aussichtslos, in 20 Tagen kam man kaum eine Meile vorwärts. Da rettete sie ein neuerlicher Windstoβ, der das Tauwerk des Segels zerriss, sodass die Piroge sich wieder aufrichtete; nur ein Buch war verloren gegangen.
Vor den Katarakten wechselten sie das Boot und den Steuermann, der die Stromschnellen noch nie befahren hatte. Ein Missionar überlieβ ihnen einen hübschen Einbaum, 13 Meter lang und knapp einen Meter breit, für die Gepäckstücke, die getrockneten Pflanzen, den Sextanten, den Inklinationskompass und die meteorologischen Instrumente blieb kaum Platz in diesem elenden Fahrzeug, wollte man ein Gerät benutzen, musste man ans Ufer fahren, um das Instrument auszugraben. Das niedrige Palmblätterdach über einem mit Ochsenhäuten und Jaguarfellen bedeckten Gitter aus Zweigen bot Schutz weder vor der erstickenden Hitze noch vor dem in Strömen fallenden Regen. Die indianischen Ruderer waren ganz nackt und sangen ihren eintönigen, trübseligen Gesang, dazu schrien die gefangenen Affen. Aber die Ufer des Orinokos wurden immer malerischer, und die Vegetation strotzte von Opulenz und Farbenglanz, leider auch die Luft von Moskitos, kleinen giftigen Mücken und groβen Schnaken, die pausenlos Hände und Gesicht befielen, in Nase und Mund krochen und durch die Kleider stachen. Im sich verengenden Flussbett lagen immer mehr Granitblöcke, dann unzählige, von einem Ufer zum anderen laufende Felsdämme, natürliche Wehre, Schwellen, der Strom teilte sich in eine Unmenge Arme und Sturzbäche und löste sich in Schaum auf. Die Piroge musste gegen die mächtige Strömung am Seil über die Hindernisse gezogen werden, wozu ein Indio vorausschwamm, um das Seil an einer Felsspitze zu befestigen. War diese Operation undurchführbar, wurde das Gefährt über Land transportiert, wobei Äste als Walzen dienten.
Oberhalb, also südlich der Katarakte, begann ein unbekanntes Land, bewohnt von Völkern mit Hundeköpfen, einem Auge auf der Stirn oder dem Mund unter dem Magen, wollte man den frühen Missionaren oder alten Indianersagen Glauben schenken. Keiner der Missionare, die vor Humboldt den Orinoko beschrieben hatten, war über die Katarakte hinausgekommen, diese natürliche Schranke vor den wilden Ländern und Völkern des Innern. Humboldt fand auf den nächsten 450 Kilometern nur drei Missionsstationen längs des Orinokos, in denen eine Handvoll Weiβe lebten, die ihre Hautfarbe zum Teil irgendwelchen Desperados, Goldsuchern oder Missionaren verdanken mochten. Dann bogen sie vom Orinoko ab, um über mehrere kleine Flüsse, durch einen überschwemmten Wald und über eine Landenge zum Río Negro vorzustoβen, dem groβen Zufluss des Amazonas. Auf der Fahrt durch den jetzt in der Regenzeit auf zehn Quadratkilometern überfluteten Urwald stand ein Indio im Bug der Piroge und schlug mit der Machete die wuchernde Vegetation kreuz und klein. Beim Transport über die Landenge zwischen den beiden groβen Flusssystemen des Orinokos und des Amazonas zogen 23 Indios aus einer Mission das Boot während vier Tagen durch den Wald, über einen Weg, der erst fünf Jahre zuvor geschlagen worden war. In dem ganzen Gebiet zwischen Orinoko und Río Negro lebten nicht mehr als zwei Mönche, und Humboldt gewöhnte sich beinahe an den Gedanken, dass der Mensch nicht notwendig zur Naturordnung gehöre. Krokodile und Boas waren die Herren der Flüsse, der Jaguar Gebieter des Dschungels, der Mensch nichts in der Fülle der Natur. Gerade hier, wo alles Fruchtbarkeit und ewiges Grün war, fand sich keine Spur vom Wirken des Menschen, und das hatte für Humboldt etwas Niederschlagendes, mehr noch als das Fehlen von Zeichen menschlichen Schaffens in der Ödnis der Wüste oder der Einsamkeit des Ozeans.
Die Frage, ob es eine natürliche Verbindung zwischen den Becken des Orinokos und des Amazonas gab, war unter Gelehrten jahrhundertelang umstritten gewesen. Seit ein Jesuitenpater 1744 einen Seitenarm des Orinokos befahren hatte, zweifelte man in den Missionen nicht mehr daran, dass dieser Orinoko-Arm, der Río Casiquiare, in den Río Negro floss, der seinerseits bei Manaus in den Amazonas mündet. Hauptzweck der ganzen Flussreise Humboldts war es, den Lauf des Casiquiares mittels astronomischer Beobachtungen verlässlich zu bestimmen. Während er sich auf dem Río Negro dem Casiquiare näherte, zog sich allerdings der Himmel zu, und Humboldt befürchtete schon, die lange und beschwerliche Fahrt vergebens unternommen zu haben. Doch über dem Casiquiare fraβen Sonne und Sterne die Wolken auf, wie der indianische Steuermann sagte. Humboldt und Bonpland hätten auch durch Brasilien bis zur Mündung des Amazonas weiterfahren können, was nicht viel mehr Zeit in Anspruch genommen hätte als die Rückfahrt über Casiquiare und Orinoko an die Küste Spanisch-Guayanas. Aber in einer Mission am Grenzfluss Río Negro riet man ihnen wegen akuter Spannungen zwischen Spaniern und Portugiesen, die sich seit drei Jahrhunderten über den Grenzverlauf stritten, davon ab. Was Humboldt nicht ahnte und erst nach seiner Rückkehr nach Europa erfuhr, war, dass seitens der portugiesischen Verwaltung Befehl ergangen war, sich der Person, Instrumente und insbesondere der astronomischen Aufzeichnungen Humboldts zu bemächtigen. Die portugiesischen Beamten vor Ort hatten von Humboldts Reise Wind bekommen und vermochten sich nicht vorzustellen, dass ein vernunftbegabter Mensch eine solche Reise tat, um Land zu vermessen, auf das er oder seine Auftraggeber keinen Anspruch erhoben; Humboldt wäre festgenommen und nach Lissabon verschickt worden.
Das Land am Casiquiare war äuβerst wild und menschenarm. Die meisten Nächte verbrachten Humboldt und Bonpland im Freien, wobei sie ihr Lager mit einem Ring von Feuern umgaben, um die Jaguare fernzuhalten. Aber die Ameisen wanderten an den Stricken in ihre Hängematten oder lieβen sich aus den Bäumen auf sie fallen und plagten sie mehr noch als die Moskitos. Auβerdem machten ihnen die Feuchtigkeit und der Mangel an Nahrungsmitteln zu schaffen, es war die unangenehmste und entbehrungsreichste Zeit ihres Aufenthalts in Amerika. Seit einem Monat war ihnen auf den Flüssen, die sie hinauffuhren, kein Kanu begegnet, auβer in nächster Nähe der Missionsstationen; auf dem Casiquiare, mehr als 300 Kilometer lang und so breit wie der Rhein, herrschte erst recht kein Verkehr. Keine 200 Menschen lebten am Fluss, weniger als vor Ankunft der Missionare, die Indios waren in die Wälder gegangen. In einem der Dörfer erzählte ihnen ein Pater, der seit 20 Jahren von den Moskitos zerstochen wurde und keine weiβe Haut mehr hatte, sondern gefleckte, dass die Eingeborenen einen Teil des Jahres von den groβen Ameisen lebten und auch Menschenfleisch nicht verschmähten. Ein Häuptling hatte unlängst eins seiner Weiber gemästet und verspeist, aber normalerweise aβen die Wilden ihre Feinde, das heiβt alle, die nicht ihrem jeweiligen Stamm angehörten, wobei sie Frauen und Kinder bevorzugten. Einer der Ruderer Humboldts, der ihm bei den nächtlichen Beobachtungen gute Dienste leistete und so gutmütig wie gescheit war, versicherte, dass seine Stammesbrüder besonders die Handballen als Leckerbissen schätzten. Selbstverständlich fand Humanist Humboldt Kannibalismus abscheulich, aber er sah auch ein, dass es rein gar nichts half, den Eingeborenen deswegen Vorwürfe zu machen. Wir Europäer würden uns auch nicht von einem Brahmanen, der Europa besuchte, davon abhalten lassen, Tierfleisch zu essen. Und wie viel Grässliches war nicht schon bei zivilisierten Völkern vorgekommen, wenn sie Hunger schoben wie die Wilden?
Vom Casiquiare fuhren Humboldt und Bonpland den Orinoko hinauf, um der Lösung des zweiten geografischen Orinoko-Problems, der Lagebestimmung seiner Quellen, näherzukommen. Doch vor jenem strategischen Punkt, an dem selbst militärische Expeditionen schon gescheitert waren, weil die hungrigen Indios mit ihren Giftpfeilen alle Eindringlinge zu erlegen pflegten, machten sie kehrt, fuhren den Orinoko hinunter und kamen von den Menschen- zu den Erdefressern. Sie machten Station in einem kleinen Dorf, in dem Indios vom Stamm der Otomaken lebten. Diese ernährten sich während des gröβten Teils des Jahres hauptsächlich von Fischen und Schildkröten, aber in der Regenzeit, wenn der Orinoko auf eine Breite von fünf Kilometern anschwoll und das Land zwei, drei Monate lang überschwemmte, war es mit dem Fischfang vorbei, und die Indios bekamen nur selten einmal eine Farnwurzel, eine Eidechse oder einen toten, auf dem Wasser schwimmenden Fisch zu fassen. Dann aβen sie nicht nur gelegentlich Erde, um den Hunger zu beschwichtigen, vielmehr ernährten sie sich geradezu von Lehm, einer fetten Tonerde, die sie zu kleinen Kugeln formten und zu Pyramiden stapelten. Mit einer Tagesration von etwa einem halben Kilo kamen sie in Zeiten der Not über die Runden, aber auch den Rest des Jahres naschten sie gerne Erdkugeln. Das Erstaunlichste war, dass sie nicht vom Fleische fielen und keinen aufgedunsenen Bauch bekamen, sondern im Gegenteil sehr kräftig und gesund aussahen. Die Otomaken waren keineswegs die einzigen Indios am Orinoko und seinen Zuflüssen, die der Geophagie zusprachen, wie auch die Anthropophagie im Orinoko-Becken kein singuläres Phänomen darstellte. Vielleicht hatte Kolumbus ja doch Recht gehabt, als er auf seiner dritten Westindienfahrt im Jahr 1498 zum ersten Mal amerikanisches Festland erreichte und angesichts des Orinoko-Deltas nicht nur vermutete, sondern geradezu felsenfest überzeugt davon war, dass hinter der Orinoko-Mündung der Garten Eden, das irdische Paradies liegen müsse; das erste Land im Westen war für Kolumbus das östlichste Asiens, wo die Sonne aufging, von wo im Augenblick der Schöpfung der erste Lichtstrahl ausgegangen war, dort lag das Paradies, in dem Wasser und fetter Fango flossen. Und vielleicht lag Sir Walter Raleigh gar nicht so falsch, als er 1595 auf der Suche nach Eldorado den Orinoko hinauffuhr, aber nicht weit kam, und 1617 noch einmal nach Guayana segelte, um zwischen dem Quellgebiet des Orinokos und dem Amazonas die groβe Stadt Manoa und ihre mit massiven Goldplatten bedeckten Paläste zu entdecken, was ihm nicht gelang. Womöglich konnte man sich auch von Gold ernähren und gesund und kräftig bleiben. Humboldt jedenfalls wurde dort »vom Regen, fürchterlichen Mosquiten und Ameisen und vorzüglich vom Hunger grausam geplagt«, wie er seinem Bruder schrieb, nicht gerade vom Hunger nach Gold und Glückseligkeit wie Kolumbus und Raleigh, auch nicht vom Hunger nach Erkenntnis, denn den konnte er reichlich stillen. Als er nach zweieinhalb Monaten und 2250 Flusskilometern in die Zivilisation des Provinzstädtchens Angostura (Ciudad Bolívar) zurückkehrte, wo einfache Wohnräume ihm prachtvoll erschienen und jeder, der ihn anredete, beinahe geistreich war, verschlang er »mit unbeschreiblicher Freude« zum ersten Mal wieder Weizenbrot, zunächst mit den Augen. In den Schoβ der Kultur zurückzukehren war ein Hochgenuss, doch er hielt nicht lange vor, die Natur rief erneut. Vorerst aber forderte der Urwald Tribut: Bonpland und Humboldt befiel ein Fieber, der Diener, der sie seit Cumaná begleitet hatte, starb nach wenigen Tagen, man war davon überzeugt, dass sie den Keim des Typhus aus den Regenwäldern am Casiquiare mitgebracht hatten, man gab Humboldt ein Gemisch aus Honig und dem Extrakt der Chinarinde, daraufhin verstärkte sich das Fieber, hörte am nächsten Tag jedoch auf, Bonplands Zustand hingegen verschlimmerte sich durch Beimischung von Ruhr, beinahe wäre er dem Fieber erlegen, sehr langsam genas er wieder.
Mit den gesammelten Pflanzen, Gesteinsproben, lebenden Tieren und menschlichen Skeletten zogen Humboldt und Bonpland auf Maultieren durch die venezolanischen Ebenen nach Neu-Barcelona. In einem kleinen offenen Schmugglerboot, das Kakao zur Insel Trinidad brachte, fuhren sie weiter nach Cumaná, um sich dort nach Kuba einzuschiffen, wurden aber auf der kurzen Küstenfahrt von einem Kaperschiff aus Halifax (Kanada) gestellt. Während Humboldt mit dem Kapitän verhandelte, weil er keine Lust hatte, nach Neuschottland verschleppt zu werden, schickte die Vorsehung eine englische Korvette vorbei, deren Kapitän mit George Vancouver die amerikanische Westküste zwischen San Francisco und Alaska erforscht und kartiert hatte und aus englischen Zeitungen über die Reise des Kollegen Humboldt informiert war. Die Korvette lieβ das Kakaoboot laufen, aber von Cumaná ging es erst einmal nicht weiter. Die regulären Paketboote von La Coruña nach Mexiko und Kuba waren seit Monaten ausgeblieben, wahrscheinlich von britischen Kreuzern aufgebracht worden. Nur Humboldts Affen, die er der Menagerie im Pariser Botanischen Garten vermachen wollte, kamen von Cumaná weg, mit einem ganzen Geschwader französischer Schiffe, die nach Guadeloupe gingen. Humboldt und Bonpland entschlossen sich, wieder nach Neu-Barcelona zurückzufahren, denn von dort sollte ein kleines nordamerikanisches Schiff, das Pökelfleisch lud, nach Kuba abgehen. Nach 16 Monaten in Venezuela und 25-tägiger Überfahrt, bei der sie vor der Südküste Jamaikas beinahe an den Klippen zerschellt wären, kamen sie kurz vor Weihnachten 1800 in La Habana an.
Auf Kuba entschloss sich Humboldt, nach Nordamerika überzusetzen, bis zu den Groβen Seen hinaufzugehen, auf dem Ohio und dem Mississippi nach Louisiana hinunterzufahren und dort den wenig bekannten Landweg nach Mexiko einzuschlagen. Kaum hatte er diesen Entschluss gefasst, da brachten amerikanische Zeitungen die Meldung, dass die seit Langem geplante französische Expedition unter Kapitän Baudin nun endlich von Le Havre abgegangen sei und in einem Jahr in Lima erwartet werde. Humboldt hatte mit Baudin in Paris abgesprochen, von Algier oder Tunis aus zur Expedition zu stoβen, sobald die Fahrt losginge. Aus La Coruña hatte er Baudin mitgeteilt, dass er statt nach Nordafrika nach Spanien gegangen sei, im Begriff stehe, nach Amerika zu fahren, und sich Baudin anschlieβen wolle, wo immer in den spanischen Überseebesitzungen der Kapitän anlegen möge, ob in Montevideo, Chile oder Lima. Nun ließ Humboldt seinen Nordamerika-Plan fallen, um nach Lima zu gehen, und fragte Baudin brieflich, ob er dort an Bord gehen dürfe. Falls nicht, werde er seine Reise einfach nach Acapulco (Mexiko) und dann über die Philippinen und Persien bis Marseille fortsetzen. Eine Antwort konnte er nicht abwarten, zumal es fraglich war, ob Briefe, die zusammen mit anderen Dokumenten bei unangenehmen Begegnungen mit Schiffen verfeindeter Länder zuerst über Bord geschmissen wurden, überhaupt ankamen. Humboldt und Bonpland beeilten sich, wieder nach Südamerika zu kommen, sie entschieden sich für den Landweg über Bogotá und Quito anstelle des langwierigen und langweiligen Seewegs von Acapulco oder Panama über Guayaquil (Ecuador), auf dem sie gegen den später so genannten Humboldt-Strom hätten anschwimmen müssen. Auf dem Landweg mussten sie bloβ über »die ungeheure Cordillere der Anden« steigen, aber das hatte unter anderem den Vorteil, dass Humboldt dann eine allein auf eigenen Beobachtungen beruhende Karte ganz Südamerikas nördlich des Amazonas erstellen konnte. Sie machten – groβenteils zu Fuβ – 3600 Kilometer über Land, das sie gar nicht hatten betreten wollen, doch Baudin trafen sie nicht, und die Südsee befuhren sie auch nicht. Ihre gesamte Amerikareise mutet erratisch an, erratisch wie das Leben selbst, aber darin besteht wohl auch ein Reiz, es wäre weniger lebhaft, verliefe es nach Plan.
In Batabanó an der Südküste Kubas nehmen Humboldt und Bonpland ein kleines Schiff, bei äuβerst schwachen Winden brauchen sie fast einen Monat für die Überfahrt, kurz vor Cartagena de Indias (Kolumbien) geraten sie in einen Sturm und kentern fast, ganz wie auf dem Orinoko, das Schiff legt sich auf die Seite, das Steuer gehorcht nicht mehr, nur durch beherztes Kappen der Taue richtet das Boot sich wieder auf. In einer Piroge mit indianischer Rudermannschaft fahren sie den angeschwollenen, mächtig strömenden Río Magdalena wochenlang stromaufwärts, bis Honda, dort steigen sie mit schwer bepackten Maultieren einen schmalen Pfad nach Bogotá hinauf, wo sie zwei Monate bleiben, Bonpland hat wieder Fieber. Humboldts Gesundheit dagegen »ist so gut als sie vorher nie war«, und er ist »äuβerst glücklich«, wie er seinem Bruder schreibt. Über Cartago, Popayán und Pasto gehen sie nach Quito, sie stapfen durch Sümpfe und reiβen sich an den Stacheln des Bambusschilfs Schuhe und Füβe auf, zwei Monate lang werden sie bei Tag und Nacht von Regengüssen durchnässt und ertrinken beinahe, als bei einem Erdbeben plötzlich das Wasser steigt. Auf den Hochebenen hingegen toben Schneestürme und herrscht eine erbärmliche Kälte. Sie besteigen die Vulkane bei Quito, legen sich über Kraterrände, schauen in abgrundtiefe Schlünde und ersticken fast an den Schwefeldämpfen, während alle zwei, drei Minuten heftige Erdstöβe die Kraterränder erschüttern. Sie besteigen den Chimborazo, der bis zur Vermessung der Himalaya-Spitzen als höchster Berg der Welt galt, und obwohl sie den Gipfel nicht erreichen, stellen sie doch einen alpinistischen Rekord auf, der fast 30 Jahre halten sollte. In der dünnen Luft auf knapp 6000 Metern wird ihnen schwindelig und übel, sie bluten aus Zahnfleisch und Lippen, nicht einmal der Kondor lässt sich in diesen Höhen blicken.
Humboldt und Bonpland stiegen ins heiβe Tal des Amazonas-Quellflusses Río Marañón hinab, kletterten die westlichste der Andenketten hoch, um in die Küstenebene Perus hinunterzusteigen, und sehnten sich schon seit Tagen danach, wie Núñez de Balboa den Pazifik zu erblicken, da zerriss auf dem höchsten Punkt des Passes tatsächlich die Nebelwand. Der ganze Westhang der Kordillere bis zur Küste bei Trujillo lag erstaunlich nah vor ihren Augen, und die Südsee strahlte wie eine groβe Lichtmasse, die in ihrer Unermesslichkeit gegen den Horizont anstieg. So mochte dem Kolumbus, als er an der Orinoko-Mündung Paradiesluft witterte, der Ort des ersten Lichtstrahls erschienen sein. Es war für Humboldt und Bonpland ein feierlicher und zugleich wehmütiger Anblick, denn inzwischen hatten sie erfahren, dass die Korvetten Baudins nicht den Hafen von Lima anlaufen würden. Statt nach Südamerika und in die Südsee zu fahren, hatte Baudin von der französischen Regierung Anweisung erhalten, um Afrika nach Australien zu segeln und mit den 20 Wissenschaftlern an Bord die Südwestküste des fünften Kontinents zu erkunden. Humboldt muss diese Nachricht wie der Schlag getroffen haben, es war wie ein böses Erwachen aus einem schönen Jugendtraum, und dies nach der strapaziösen Reise durch die Anden, die er nie beabsichtigt hatte. Und dennoch: Er sah keinen Grund, diese Reise zu bedauern, konnte vielmehr mit der wissenschaftlichen Ausbeute von 19 Monaten, zu deren Fortbewegung eine ganze Maultierkarawane nötig war, hochzufrieden sein. Und im Callao de Lima konnte er zum Trost noch den Durchgang des Merkurs vor der Sonnenscheibe beobachten.
Es hätte nun für Humboldt nahegelegen, den Marañón und den Amazonas bis zu dessen Mündung in den Atlantik bei Pará (Belém) hinunterzufahren und so Südamerika von West nach Ost vollständig zu durchqueren, das hätte seine Reise abgerundet, den Kreis oder vielmehr das Trapez geschlossen. Doch erstens hatte er dafür keinen Freibrief der portugiesischen Regierung, und zweitens hatte diese Fahrt Charles Marie de La Condamine bereits 1743 zu wissenschaftlichen Zwecken unternommen, nachdem er im Auftrag der Pariser Akademie der Wissenschaften in den Anden Vermessungsarbeiten durchgeführt und einigen Vulkanen ins Maul geschaut hatte. Condamine war keineswegs der erste Europäer auf dem Amazonas, 200 Jahre vor ihm war Francisco de Orellana von Quito kommend über den Río Napo auf den Strom gelangt und hatte ihn bis zur Mündung befahren, allerdings auf der Suche nach Eldorado. Für Humboldt und Bonpland hätte es auch jetzt noch Arbeit genug gegeben, das zeigten die Ergebnisse der Naturforscher des 19. Jahrhunderts wie zum Beispiel Alfred Russel Wallace und Henry Walter Bates. Zwar verlor Wallace seine botanischen und zoologischen Sammlungen auf der Rückfahrt nach England durch einen Brand an Bord, doch Bates brachte allein 14 000 Tier- und Pfanzenarten aus dem Amazonasgebiet mit, von denen 8000 bis dahin unbekannt gewesen waren. Humboldt hing wohl auch noch an seinem Südsee- und Weltumseglungstraum, er nahm sich nun vor, von Lima mit dem Schiff nach Mexiko, von Acapulco nach den Philippinen zu fahren und um das Kap der Guten Hoffnung nach Europa zurückzukehren, »so vollende ich meine eigene Reise um die Welt«. Dann gab er diesen Plan auf, er hätte eine ungeheure Seereise gemacht und doch nur Manila und das Kap gesehen, jetzt wollte er von Mexiko über Kuba direkt nach Spanien segeln, aber er machte noch einen Abstecher nach Philadelphia und Washington, wo er sich mit Thomas Jefferson austauschte, dem Präsidenten der Philosophischen Gesellschaft und der Vereinigten Staaten, und traf mit einer französischen Fregatte im April 1804 in Bordeaux ein.
Während Humboldt in Paris mit der Ausarbeitung und Herausgabe seines dreiβigbändigen amerikanischen Reisewerks in französischer Sprache beschäftigt war, was 22 Jahre dauern und den Rest seines Vermögens verschlingen sollte, spielte er mit dem Gedanken, seinen Forschungen in der westlichen Hemisphäre solche im Ostteil der Erde an die Seite zu stellen. Ihm schwebte eine Reise von sieben, acht Jahren in die Tropenländer Asiens vor, besonders lockten ihn Indien, der Himalaya und Tibet. Als er 1811 von der russischen Regierung das Angebot erhielt, eine voll finanzierte Expedition ins weite Russische Reich zu unternehmen, erwiderte Humboldt, es falle ihm schwer, die Hoffnung aufzugeben, den Ganges zu sehen. Den Baikalsee und die Vulkane Kamtschatkas zum Beispiel fand er nicht so prickelnd, weniger noch den Kaukasus, ob man denn wenigstens nach Kabul, Samarkand und Kaschmir vordringen könne, fragte er. Aus dem Projekt wurde nichts, die Spannungen zwischen den seit dem Tilsiter Frieden verbündeten Staaten Russland und Frankreich verschärften sich und mündeten in Napoleons Russlandfeldzug von 1812. Erst Italien, dann Ägypten, jetzt Russland – wieder kam Napoleon seinem Altersgenossen Humboldt in die Quere. Doch 1817 ging für Humboldt erneut die Sonne im Osten auf: Bei mehreren Aufenthalten in England, wo Bruder Wilhelm gerade preuβischer Gesandter war, gewann er den englischen Prinzregenten und die Ostindische Kompanie für seinen Asienplan, die Kosten wollte der preuβische König übernehmen, Humboldt bereitete sich zwei Jahre auf die Reise vor, doch sie fand nicht statt, scheiterte vermutlich an verstecktem Widerstand der Ostindienkompanie, deren Direktoren wohl befürchteten, mit seinem forschenden Blick könnte der liberale Humboldt zu sehr hinter die Kulissen und ihnen in die Karten schauen.
Zehn Jahre darauf wandte sich Russland in Gestalt seines Finanzministers deutscher Herkunft, des Freiherrn, später Grafen Georg von Cancrin aus Hanau, erneut an den erst vor Kurzem von Paris nach Berlin übergesiedelten Humboldt und schlug ihm eine Reise zum Ural vor. Cancrin war auβer an dem gefeierten Forschungsreisenden und angesehenen Naturwissenschaftler vor allem auch an dem Geognostiker und Bergbaufachmann Humboldt gelegen, die Reise sollte zu zahlreichen Gruben, Steinbrüchen, Salzflözen, Gold- und Platinseifen und -wäschen, Hüttenwerken und Schleifereien führen, Erkenntnisse über die Ergiebigkeit der Vorkommen und Verbesserungsvorschläge zur Steigerung der Produktion liefern und womöglich neue Lagerstätten entdecken helfen, im Ural hatte man 1822 Platin gefunden, Humboldt vermutete auch Diamantenvorkommen, zu Recht, wie sich herausstellen sollte. Die Idee führte bei Humboldt nicht gerade zu Begeisterungsausbrüchen, der Ural schien ihm nicht unbedingt Quintessenz der Tropen und Inbegriff der Exotik zu sein. In seinem höflichen Antwortschreiben an den hochwohlgeborenen Freiherrn und hochzuverehrenden Herrn Finanzminister erwähnte er vorsichtig den Berg Ararat und den Baikalsee, um zu verstehen zu geben: wenn schon Russland, dann der Süden, besser noch Gebiete südlich des russischen Südens. Der hochgeehrteste Herr Baron sei also geneigt, schrieb Cancrin, eine »gelehrte Reise nach unserem Osten« zu unternehmen, sprich nach dem Ural; den Ararat, die sibirischen Gebirge und ihren Baikal fand Cancrin zwar »auch sehr merkwürdig«, doch weiter entfernt, sollte wohl heiβen: abwegig.
Der Königlich-Preuβische Kammerherr von Humboldt wurde nun bald 60 Jahre alt, doppelt so alt wie zu Beginn seiner Amerikafahrt, er hatte sein Vermögen »für nicht ganz unrühmliche Zwecke vernichtet« und durfte nicht mehr darauf hoffen, eine längere Reise aus eigenen Mitteln bestreiten zu können, umso weniger konnte er sich seine Reiseziele aussuchen. Noch war er gut zu Fuβ, lief trotz seines Alters und seiner grauen Haare neun bis zehn Stunden, ohne zu ruhen, wer weiβ, wie lange er dazu noch imstande sein würde. Humboldt nahm Cancrins Anerbieten schlieβlich an, erbat sich aber von Seiner Kaiserlichen Majestät Nikolaus I. »die Gnade, mich wenigstens an den Irtysch gehen zu lassen«. Es sei nämlich ein heiβer Wunsch seiner Jugend, sowohl den Amazonas als auch den Irtysch gesehen zu haben, fabulierte er, Armenien, der Ararat und das Kaspische Meer »würden freilich meine Einbildungskraft noch mehr anregen; aber für den Ararat ist es besser, friedlichere Zeiten zu erwarten«. Der Ararat lag auf osmanischem Gebiet, im russisch-türkischen Krieg von 1828/29 drangen die Russen über den Kaukasus vor und nahmen – während Humboldt in Russland unterwegs war – Erzurum in Ostanatolien ein, nicht weit von den Kupfer- und Silbergruben in Richtung Trabzon, und im Friedensvertrag von Adrianopel (Edirne) wurde Russland die Oberherrschaft über Georgien und Armenien übertragen. Als Humboldt kurz vor seiner Abreise nach Russland erfuhr, dass Cancrin andere Gelehrte zum Ararat und ins Elburs-Gebirge schickte, wurmte es den Wirklichen Geheimen Rat aber doch: »Ich bin (…) neidisch«, schrieb er Seiner Exzellenz dem Finanzminister.
Mitte April 1829 brach Humboldt zusammen mit dem Chemiker und Mineralogen Gustav Rose sowie dem Zoologen und Botaniker Christian Gottfried Ehrenberg in zwei mit astronomischen Instrumenten, physikalischen Apparaten und mit Material für chemische Versuche beladenen Kutschen von Berlin auf, die Fahrt führte über Königsberg (Kaliningrad), Memel (Klaipeda), Dorpat (Tartu) durch Eis und Schnee und Tauwettermatsch nach Sankt Petersburg, Humboldt hasste die Kälte. In der Hauptstadt des Russenreichs vergingen drei Wochen mit Besichtigungen, Besuchen, Gesprächen, Gesellschaften, Diners beim Zaren, abendlichen Visiten bei der Zarin, mit edler Hospitalität allenthalben, man überschlug sich, bot »überall Geld wie Heu an« und kam jedem Bedürfnis zuvor, doch »die ewige Notwendigkeit der Repräsentation« empfand Humboldt zunehmend als Last, er sehnte sich nach freier Luft fern der Städte, nach Luftgenuss sozusagen, denn »von groβem Naturgenuss kann in so einförmigen Ländern, wo wahrscheinlich die Kiefern-Natur sich bis Asien hineinzieht (…), nicht die Rede sein«, schrieb er seinem Bruder. In drei gefederten, von insgesamt 16 Pferden gezogenen Wagen ging es in Begleitung eines hohen russischen Bergbeamten, eines Kuriers und eines Kochs über Moskau nach Katharinenburg (Jekaterinburg) im Ural, es war »ein ewiges Begrüβen, Vorreiten und Vorfahren von Polizeileuten, Administratoren, Kosakenwachen«, da war »fast kein Augenblick des Alleinseins«. Und weiter nach Tobolsk am Irtysch, das der östlichste Punkt der Reise hätte sein sollen, doch Humboldt nahm eine »kleine Erweiterung unserer Reisepläne« vor, ihn zog es gen Süden, am Irtysch hinauf zum Altai-Gebirge und an die Grenze zur chinesischen Dsungarei. »Eine sibirische Reise ist nicht entzückend wie eine südamerikanische«, schrieb er, »man reist oder vielmehr flieht durch diese einförmigen sibirischen Grasfluren wie durch eine Meeresfläche«. Die Ausbeute an neuen Pflanzen war bescheiden, die Fauna arm auβer an gelben Mücken, gegen die sie sich mit erstickenden Masken panzerten, dazu litten sie unter Hitze und Staub und kamen durch ein Gebiet, in dem die Sibirische Pest (Milzbrand) grassierte und jedem Infizierten den Tod nach fünf Tagen versprach. Sie tranken Tee mit den chinesischen Grenzsoldaten, die in kirgisischen Jurten hausten, dann ging es vom Irtysch durch die Staubsteppe zum Ural zurück und weiter an die Wolga. Dabei vermehrte »die groβe und allzu gütige Sorgfalt der Regierung« täglich ihr Begleitpersonal, Kosaken eskortierten sie, sogar ein russischer General gab sich die Ehre. Der Ausflug an die Wolga war Humboldts zweite eigenmächtige Planmodifikation, er galt weniger den Bodenschätzen oder den Wolgadeutschen als vielmehr dem Kaspischen Meer. »Ich kann (…) nicht sterben, ohne das Kaspische Meer gesehen zu haben«, rechtfertigte er sich vor Cancrin, dem Zaren und Gott. Über Sarépta (Wolgograd) gingen sie nach Astrachan, fuhren durch die Wolgamündung ein Stück weit auf den Kaspisee hinaus, entnahmen Wasserproben und kehrten per Kutsche über Moskau Mitte November 1829 nach Petersburg zurück. In 23 Wochen hatten sie mehr als 15 000 Kilometer zurückgelegt.
Vor Antritt seiner Russlandfahrt war Humboldt mit Cancrin so verblieben, dass er seine Reise in den folgenden Jahren auf Kosten des Zaren zum Ararat und in andere südliche Gefilde fortsetzen möge. 1831 kam ein konkretes Angebot: Finnland – seit 1809 russisch – oder Kaukasus. Nein danke, wird Humboldt sich gedacht haben, bitte nicht noch mehr Kilometer durch eintönige Groβräume, nicht noch mehr Mücken und andere Plagegeister und charmante Gesellschafter.
Humboldt unternahm keine gröβere physische Reise mehr, wohl aber einen wissenschaftlichen Höhenflug in den Kosmos. Knapp drei Jahrzehnte waren ihm noch vergönnt, sein Hauptwerk, den Kosmos, zu schreiben, bevor er 1859 in seinem Berliner Bett starb.