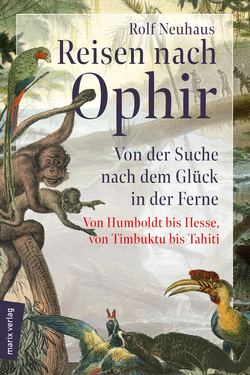Читать книгу Reisen nach Ophir - Rolf Neuhaus - Страница 8
3. Verfehlt – Hermann Hesse jenseits von Indien
ОглавлениеIm Jahr 1913 erschien ein Buch von Hermann Hesse mit dem Titel Aus Indien – Aufzeichnungen von einer indischen Reise. Der Band enthielt Impressionen, Reflexionen, Gedichte, Skizzen, Berichte von einer Seereise durch den Suezkanal, das Rote Meer und den Indischen Ozean zu Teilen der Malaiischen Halbinsel und Sumatras, nach Singapur und Ceylon. Nichts aus Indien. Zwar etwas über Indien, doch nichts von einer Reise nach Indien. Jedenfalls nichts aus Indien im heutigen Sinn. Hesse setzte seinen Fuβ nicht auf den Subkontinent, sofern man Sri Lanka nicht zum Kontinent zählt. Zwar hatte er vorgehabt, die südwestindische Malabar-Küste zu betreten, doch daraus wurde nichts. Hesse selbst nannte seine Reise von 1911 schon treffender Indonesienreise oder malaiische Reise, obgleich er nur zu einigen Punkten beiderseits der Straβe von Malakka vordrang, aber dies war das Zielgebiet seiner groβen Reise, die bloβ drei Monate dauerte, wovon er die Hälfte auf See zubrachte. Was ihn auf dieser Reise am meisten beeindruckte, das waren die Chinesen.
So wie der Orient von Marokko bis Japan reicht, obwohl Nordafrika nicht gerade im Osten Europas liegt, so lag auch Indien auf vielen Längengraden, etwa zwischen Amerika und Borneo: Westindien, Vorderindien, Zwischenindien, Hinterindien, Ostindien … Das geheimnisvolle Indien, für Jahrhunderte Inbegriff aller Schätze und Kuriositäten, war der Garten Adams und Evas persönlich. Für Hesse, dessen Groβvater, Vater und Mutter jahrelang in Indien gelebt hatten und wohl mehr von Indien missioniert worden waren, als dass sie dort protestantischen Glauben verbreitet hätten, und die das häusliche Ambiente, in dem Hesse aufgewachsen war, entschieden indisch geprägt hatten, für ihn war Indien eher das Land der Spiritualität, der Urquell ewiger Weisheit, Sitz Tausender Götter, wo die Menschen zu Tausenden in der Gosse lagen und zugleich über allem standen, dort waren die Wurzeln alles Menschenwesens und die Quelle alles Lebens, von dort waren die Völker und ihre Lehren und Religionen ausgegangen, dort standen die Bilder der Götter und die Tafeln der Gesetze, im Asien des ehrwürdigen Bobaums, des goldenen Drachens und der heiligen Schlange. Als Hesse erfuhr, dass sein Freund Hans Sturzenegger, der Maler aus begüterter Schaffhausener Kaufmannsfamilie, eine »Indienreise« plante, um seinen Bruder Robert, der das Überseegeschäft der Familie in Singapur übernommen hatte, zu besuchen, schloss er sich ihm kurzerhand an. Für Hesse, der damals noch am deutschen Ufer des Bodensees lebte, war es eine Gelegenheit zur Flucht aus seiner ersten Ehe und zur Flucht aus Europa mit seiner grellen Geschmacklosigkeit, seinem lärmenden Jahrmarktsbetrieb, seiner hastigen Unruhe und seiner rohen Genusssucht. Hans Sturzenegger machte 1913 eine zweite Reise nach Südostasien, arbeitete in Singapur längere Zeit im Atelier und kehrte mit noch mehr Zeichnungen und »indischen« Bildern zurück, die den Einfluss Gaugins erkennen lassen.
Hesse und Sturzenegger schifften sich Anfang September 1911 in Genua auf der »Prinz Eitel Friedrich« des Norddeutschen Lloyd ein, lagen einen halben Tag im Hafen von Neapel, sahen den unheimlichen, elenden schwarzen Kohlenträgern zu, Italienern und Chinesen, »darunter hübsche nackte Kulis«, wie Hesse in sein Tagebuch notierte. Sie hörten den kitschigen Volkssängern zu, die abends an Bord kamen, um sich folkloristisch zu prostituieren, aus Quarantänegründen durften die Passagiere bis Colombo nirgendwo an Land gehen. Hesse hat eine winzige Kabine mit kleinem Fensterloch und elektrischem Fächer in der ersten Klasse, Mitreisende sind der deutsche Generalkonsul in Batavia nebst Gemahlin, ein Italiener, der in Singapur reich geworden ist, ein deutscher Gummibauer aus Borneo mit norwegischer Frau, ein Petroleumbohrer, der von Rumänien und Indien erzählt, ein britischer Captain, der den Zulukrieg mitgemacht hat und im Burenkrieg in Gefangenschaft geraten war, ein deutscher Botaniker aus Neuguinea, ein Chinese aus Schanghai, der das alte Weisheitsbuch I Ging auswendig kann und mit einem englischen Beamten aus Ceylon über Gummipreise redet, Rubber ist das beherrschende Wort im Osten, das Hesse bisher unbekannt war. Die meisten Mitreisenden kehren von kurzen Ferien oder Besuchen in der Heimat zurück oder fahren zum ersten Mal hinaus wie die sieben Bräute an Bord, die nach Übersee verheiratet werden. Man speist in wechselnden Gruppen, plaudert und gibt Anekdoten zum Besten, man ruht in Deckstühlen, die manchmal angebunden werden müssen, dann liegt man matt und apathisch, doch still und gesittet, die weiβbeschuhten Füβe der Reling zugekehrt, schaukelt im Seegang und starrt in die ewige Meeresöde. Man spielt Scheffelbord und Schach, veranstaltet Dicht- und Rätselspiele, Wettrennen an Deck, Kissenkämpfe, Kotillons, Maskenbälle im Saal, man knobelt um Bowle, im Rauchsalon würfeln junge Deutsche unter Führung eines alten Australienkapitäns und saufen alles deutsche Bier weg. So hätte Rimbaud reisen mögen. Oder auch nicht. Wo sind die Streifzüge, die Gewaltritte, wo die Freiheit? Das Bordleben erster Klasse ist eine angenehme Mischung aus bequem und elegant, etwas leichthin und träge, man macht Ausflüge in die zweite und dritte Klasse, wo mehr Leben ist und bessere Laune herrscht, in der zweiten reisen Missionare aus dem Schwarzwald, eine Opernsängerin, der Schweizer Direktor eines Elektrizitätswerks bei Kuala Lumpur, Hesse leidet an Schlaflosigkeit sowie Magen- und Darmbeschwerden, mehr noch vielleicht unter dem Vegetieren, an Untätigkeit und Smalltalk, »er meint«, schreibt Sturzenegger nach Schaffhausen, »man komme hier aus der Operette nicht heraus«.
Nach fünf Tagen kommt die ägyptische Küste am Nildelta in Sicht, ein schmaler Streifen gelben Landes mit einzelnen, merkwürdig verlassenen und seltsam zwischen Himmel und See schwebenden Palmen. Port Said liegt grell und öde, neu und kahl in der Sonne, hat nur wenige arme Bäume, aber der Hafen ist voller Boote mit schönen Arabern und voll prächtiger Kohlenträger. Dann der schmale, endlose Suezkanal, zur einen Seite Sand und Schlamm, zur anderen der lange gerade Bahndamm mit Gebüsch, dahinter Lachen, Sümpfe, Binsenteiche. In der Nacht verstummt die Maschine, das Schiff verharrt regungslos in unerhörter Stille, bleiche Sandhaufen liegen im matten Mondlicht, giftige Reflexe zucken über den schwarzen Wasserstreifen, entfernte Scheinwerfer ziehen genauso lautlos und unheimlich ihre geradlinige Bahn wie der fürchterliche Kanal, es ist die ödeste Gegend, unsäglich tot und unwirklich, hier ist zum ersten Mal alles fremd, ein anderer Erdteil, die »Prinz Eitel Friedrich« liegt wie verzaubert in der Wüste. Das Rote Meer wird seinem Ruf gerecht, eine tolle Hitze und schwere Schwüle lasten auf ihm, Hesse schwitzt ohne Pause, die fliegenden Fische und springenden Delphine sind quicklebendig, die Passagiere aber liegen wie tot herum, erschöpft und schläfrig, die Dritte-Klasse-Chinesen halbnackt. Die Inseln im Bab al-Mandab sind völlig nackt, purer glühender Fels, es ist eine quälende Hölle, besonders abends im Smoking. Hinter Aden sorgt eine leichte Brise für Erleichterung, beim Verlassen des Golfs werden Wind und Seegang stärker, bald ist alle Welt seekrank und liegt abermals elend herum, bei Tisch sind mehr Stühle leer als besetzt. Hesse hält sich leidlich aufrecht, das Meer ist wild und aufregend schön, dann lässt der Sturm nach, es wird wieder wärmer, viele Tage lang ist nichts als die blauschwarze Scheibe des Indischen Ozeans zu sehen, das kreisrunde Meer in seiner grausigen Unendlichkeit, darüber der glühende Himmel und nachts die in sattem Dunkelblau strahlende Weite des Sternenzelts, und inmitten des Kosmos schleicht verloren und sinnlos das Schiff dahin, Hesse lehnt melancholisch an der Reling und gibt sich der »Trauer des ungeheuren leeren Horizonts« hin.
Nach 16 Tagen an Bord endlich neun Stunden Landgang in Colombo, neun Stunden bunter, greller Orient, die erste Kostprobe der Tropen. Die Bordkapelle schmettert, die Passagiere drängen in die Motorboote und in die Barken mit den nackten Ruderern, am Strand wedeln die Kokospalmen, in der Ferne ragen fantastisch schöne Berge auf, die Damen entfalten ihre Sonnenschirme, die Herren setzen sich ihr Wahrzeichen auf, den Tropenhelm. Die neue Stadt ist hübsch und lebendig, doch brutal europäisiert, ein kleiner Tempel mit hundert Figuren an der Fassade und heilig goldener Dämmerung im Innern repräsentiert das alte Colombo. Auf dem Eingeborenenmarkt sieht er wunderliche, aromatische, saftige Früchte und schöne dunkelbraune Menschen, der Orient ist köstlich und märchenhaft, die Frauen tragen Goldplatten in den Nasenflügeln, die Kinder betteln, überall liegen Würde und Groteskerie nah beieinander. Man fährt mit der Pferdekutsche zum eleganten Galle Face Hotel ans Meer, Händler und Gaukler mit Kobras und Mungos lagern davor, man trinkt Whisky und spielt Billard, dann nimmt man eine Rikscha und fährt mehrere Stunden an herrlichen Gärten mit seltsamen Bäumen und groβen Schmetterlingen, an Sportanlagen, Polospielfeld und Badeplatz vorbei und durch schillernde Gassen mit kleinen Läden. Die leicht und zart gebauten Singhalesen mit ihren mageren Prinzengesichtern und ergebenen Rehaugen sind höflich, kindlich, lachen gern, die weiβen indischen Soldaten mit Turban sind schöne stolze Männer und haben die Zähne rot vom Betelkauen, Ceylon ist unwirklich, fabelhaft in seiner grellen Farbenfülle. Für Hesse ist Europa grell, Arabien grell, Indien grell, aber jeweils anders grell.
In George Town auf Penang (Pinang), einem der britischen Straits Settlements an der Malaiischen Halbinsel, werden Hesse und Sturzenegger von dessen Bruder abgeholt und als Erstes zum malaiischen Schneider geführt, der den Neuankömmlingen Maβ zu nehmen hat für standesgemäβe weiβe Tropenanzüge. Weiter per Rikscha zum Eastern and Oriental Hotel, dem schönsten Europäerhotel der hinterindischen Halbinselwelt, in dem Hesse eine fürstliche Wohnung angewiesen wird: Vorzimmer, Schlafzimmer, ein Riesenbett mit Moskitonetz, Waschraum, Ankleidezimmer, ausschweifend bequeme Liegestühle, vor der Veranda klatscht das blaugrüne Meer an die Mauer, ehrwürdige Palmen stehen im roten Sand, die rotbraunen und gelben Segel der Dschunken leuchten. Vom stickigen Kabinenloch in die luxuriöse Sahib-Suite, in den Tropen wird man automatisch befördert und ist gleich wer. Ein kleiner Chinese mit Philosophenaugen und Diplomatenhänden trägt im luftigen Vorzimmer geräuschlos Tee und Bananen auf, zum Dinner geht es in den hübschen Speisesaal, wo man bei ganz guter Tafelmusik das üble Essen eines anglo-indischen Hotels mit leiser Enttäuschung hinunterwürgt. Dafür entschädigt die Nacht, die keine ist, denn hier gibt es keinen Sonntag und keine Nacht, sondern überall und zu jeder Stunde brennendes Leben. Der flinke, starke Rikschakuli läuft in frohem Trab in die drollig elegante Stadt, an allen Amtsgebäuden und groβen Kaufhäusern prangt eine Art Pseudorenaissance, die Chinesenhäuser hingegen sind einfach, leicht und hübsch, überall sieht man Chinesen, die heimlichen Herrscher des Ostens, überall chinesische Läden, Werkstätten, Schaubuden, Teehäuser, Freudenhäuser, hin und wieder geht es durch eine Malaien- oder eine Hindugasse an weiβen Turbanen über dunklen Vollbärten und an Frauengesichtern voller Goldschmuck vorbei. Köche sieden und braten auf der Straβe, ihre Klienten essen an langen Brettertischen für zehn Cents nicht schlechter als Hesse für drei Dollar im Hotel gegessen hat, kleine Straβenhändler kauern auf hohem Brett über ihrer Bude und warten geduldig auf Abnehmer für eine Handvoll getrocknete Fische oder ein Häuflein Betel, in einer Schusterwerkstatt hämmern und nähen 20 Arbeiter, ein Barbier schert ruhig und würdevoll am Rand der brausenden Straβe, Obsthändler verkaufen fantastische Erfindungen einer überbordenden Natur, auf Arbeit wartende Träger hocken zusammen und erzählen sich Geschichten, ein muslimischer Kaufmann breitet auf seinem Ladentisch Tücher aus, die fast immer aus Europa stammen. Auf dem Bordstein sitzen japanische Dirnen und gurren wie fette Tauben, in den chinesischen Bordellen glänzt golden der Hausaltar gegenüber dem Eingang, auf offenen Veranden über der Straβe spielen sich alte Chinesen beim Glücksspiel heiβ, andere liegen und rauchen, alle Gestalten der östlichen Märchen sind hier versammelt, nur die Könige, Wesire und Henker fehlen.
Man besucht eine Bretterbude von chinesischem Theater, die Chinesen sitzen Zopf an Zopf, die Männer still und rauchend, die Frauen still und Tee trinkend, in alten Kostümen wird ein altes Stück gespielt, von dem Europäer wenig verstehen, Gebärden und Bewegungen sind streng vorgeschrieben und perfekt einstudiert, alles ist stilisiert und zeremoniell, alles greift rhythmisch und harmonisch ineinander, Schritte, Gesten, Stimmen und Musik sind tadellos aufeinander abgestimmt, die einfache Melodie kehrt immer wieder, monoton, mit winzigen Variationen, die ewigen Becken- und Paukenschläge stören allerdings, sonst ist alles fein und delikat, nur etwas zirpend. Leider geht man auch noch in ein Malaientheater, malaiische Mimen singen und tanzen die Räubergeschichte von Alibaba, die Musik ist völlig europäisch und stammt aus einer modernen Harmoniummaschine, übler Operettenstil, varieteeartig, die Prachtkulissen sind wahnsinnig grell und von grotesker Hässlichkeit, in gelungener Spekulation auf die »Affeninstinkte« der Malaien fabriziert, es ist eine unfreiwillige Parodie auf alle Entgleisungen europäischer Kunst. Hier und jetzt wie auch später und überall sieht Hesse die armen Malaien, diese lieben, schwachen Kinder, rettungslos den schlimmsten europäischen Einflüssen ausgeliefert. Anderntags Visite in Sturzeneggers hiesigem Geschäft, dort arbeiten chinesische Schreiber mit feinen zarten Händen klug und still und machen freundliche Gesichter, malaiische, chinesische und indische Händler kaufen ein, der Import versaut den Osten mit Kleiderstoffen, üblen Tassen, Tellern, Schuhen, Whisky, Spielkarten. Ausflüge führen im Autobus am Strand und an Kokos- und Fächerpalmen und primitiven Rohrhütten der Fischer entlang, durch Europäerstraβen mit hübschen Villen in weiten dunklen Gärten, zu Fuβ den Penang Hill hinauf zum Cray Hotel, wo man ein Bad nimmt und die Kleider wechselt und den Lunch einnimmt, zurück durch Farnwildnis und den Dampf fruchtbarer Täler, durch Kokoshaine und Dörfer, vor deren Hütten Muskatnüsse auf Tüchern trocknen.
Auf dem Festland fährt man per Eisenbahn durch Kautschukpflanzungen und Urwaldrodungen Richtung Singapur. In jedem Coupé erster Klasse sind vier breite Ledersessel, drauβen wälzen sich Wasserbüffel träge im Sumpf. Bei der Ankunft in Ipoh vermisst Hans Sturzenegger zwei Koffer, sein Bruder hat hier geschäftlich zu tun, die Stadt ist ohne Reiz. Im Kinematographen gibt es üble europäische Filme, dazu spielt eine Malaienband europäische Musikfragmente miserabler und rührender als jede kleine, hilflose, besoffene heimische Dorfkapelle. Die Koffer tauchen nicht auf. Kuala Lumpur macht einen eleganten, wohlhabenden, gediegenen Eindruck, das feine Hotel Empire ist äuβerlich imposant, doch Kost und Service sind zum Kotzen. Sturz kriegt seine Koffer wieder, Hesse geht in den Blumengärten eines öffentlichen Parks auf Schmetterlingsfang. Besuch zweier Tropfsteinhöhlen, Rückweg durch Rubber-Estates und Tamilendörfer, die Weiber tragen all ihr Vermögen an sich. Ein bequemes Bett aus zwei Sitzen im Nachtzug nach Johore, doch kein Schlaf, sondern ein schnarchender Holländer. Übersetzen nach Singapur, viel Jungle und Sumpf, Autofahrt über rote erdene Straβen und durch Kokoswald ans Meer, dann Besuch eines malaiischen Theaters, lustiges Zeug weit besser gespielt als in George Town. Bis Mitternacht Whisky im Singapore Club, morgen, vier Wochen nach Genua, geht’s erst richtig los.
Mit ihren 15 Kisten und Koffern schifften sich Hesse und die Brüder Sturzenegger auf einem kleinen holländischen Küstendampfer ein. Sie waren die einzigen Passagiere der ersten Klasse und hatten das Hinterdeck für sich. Dort saβen sie in altväterlichen Lehnstühlen am weiβ gedeckten Tisch und lieβen sich von drei aufmerksamen und hübschen Javanen bedienen. Im Unterschied zu den chinesischen Boys der Hotels in den Straits Settlements und den Malay States, die ebenso schlecht und lieblos zu servieren pflegten wie europäische Kellner in einem Durchschnittshotel, umkreisten jene Javanen die Gäste mit der einschmeichelnden Treue guter Krankenschwestern, kamen jedem Wunsch lächelnd und ohne Hast zuvor, schenkten die Gläser nach jedem Schluck wieder voll, standen mit brennendem Streichholz bereit, noch bevor der Raucher bemerkte, dass seine Zigarre ausgegangen war. In holländischer Behaglichkeit tuckerten die Reisenden an hundert Inseln vorüber durch die brütende Nacht, überquerten den Äquator und sprachen über Sumatra, Krokodile und Malaria, tranken Whisky und waren nass vom unablässig rieselnden Schweiβ, dann legten sie sich zum Schlafen an Deck oder in die Kabine.
Am Morgen fuhr das Schiff mit der Flut in die breite braune Mündung eines der groβen Ströme Sumatras ein. In Tonkal verlieβen viele aus der dritten Klasse das Schiff, und der einzige Europäer am Ort, ein holländischer Beamter, kam kurz an Bord. Vom Dorf waren nur etwa zwei Dutzend Hütten zu sehen, Pfahlbauten, die alle durch einen schmalen Laufsteg hoch über dem Schlamm miteinander verbunden waren, dahinter erhoben sich Kokospalmen. Stundenlang ging es den Batang Hari hinauf, durch ununterbrochenen Urwald mit wirrem Farn- und Baumgewimmel direkt hinter dem Ufer. Ab und zu tauchten spitze schmale Einbäume auf, die von den Eingeborenen mit bewundernswerter Geschicklichkeit gerudert wurden, vielfach diente ihnen nur ein abgeschnittenes Palmblatt als Ruder. In der Abenddämmerung stieg in einem der kleinen Dörfer ein neuer Passagier zu, Hiese aus Ulm, mit dem Hesse aus Calw die Kabine teilte. Der Kapitän meinte, er habe seit Langem nicht mehr so viele Kajütenpassagiere gehabt. Hiese lebte seit 16 Jahren im Busch allein unter Natives, Tigern, Schlangen und Krokodilen, er sprach flieβend Holländisch, besser und lieber noch Malaiisch, lobte Land und Leute und verachtete die Europäer, die er fast alle für Gauner hielt.
Das Schiff blieb früh in der Nacht wegen Niedrigwasser weit unterhalb von Djambi liegen. Louis Hasenfratz, Schweizer Kaufmann und Kompagnon der Holzhandelsfirma Djambi-Maatschappji, holte seine Gäste am Morgen im kleinen Boot vom Dampfer ab. Der breite Batang Hari lag jetzt fünf, sechs Meter unter dem Uferrand, bei Hochwasser füllte der Fluss sein Bett aus. Die Fischer- und Handwerkerhütten an der Einfahrt zum Städtchen schwammen auf Flöβen aus Baumstämmen oder Bambus. Hasenfratz wohnte mit Frau und Tochter und einem drolligen, schwanzlosen Affen in einem Bungalow am Fuβ eines kahlen Hügels. Nahm man ein Bad, erschien das kleine schwarze, vom weiβen Bart eingerahmte Gesicht des Affen im Giebel der offenen Hütte, und man musste um seine Kleider fürchten. An den Wänden saβen rosagraue Echsen, die Fliegen und Motten fingen und im Kampf mit gröβeren Insekten auch schon mal zu Boden gingen. Drauβen im Wasserbecken lagen sechs junge, ganz reizende Alligatoren.
Mit einem kleinen chinesischen Raddampfer fuhren Hasenfratz und seine Gäste weiter flussaufwärts. Das Unterdeck war voller Kisten mit Paranusspflanzen, das Oberdeck gehörte den Passagieren. Ein javanischer Schneider arbeitete fleiβig an seiner Singer-Nähmaschine, Chinesen spielten Karten. Der Strom wand sich durch den Dschungel, hinter den hohen Ufern ragten einzelne Urwaldriesen aus dem Dickicht. Kokospalmen zeigten Dörfer an, Kinder spielten im Wasser, Büffel badeten. In einem dieser Kampongs erntete ein dressierter Affe Kokosnüsse. Flink lief er den Stamm hinauf, drehte die Nuss um ihren Stiel und lieβ sie fallen. Wollte der angebundene Affe eine grüne Frucht pflücken, wurde ihm durch Zurufe und Ziehen an der Schnur signalisiert, dass die Nuss noch nicht reif war. Am Abend breiteten die Passagiere ihre Matten und Matratzen auf Deck aus und verbreiteten einen groβen Gestank. Die Natives pflegten nicht nur mit Kokos- oder Citronellaöl zu kochen, sondern sich auch den Körper damit einzureiben, und dieser zähe, ekelhafte Geruch war für Hesse während seines ganzen Aufenthalts im Osten der einzige, aber zwingende Anlass, Widerwillen gegenüber den Eingeborenen zu empfinden. Er fand keinen Schlaf und ging aufs Vorderdeck, wo der Steuermann mit rätselhafter Sicherheit durch die rabenschwarze, undurchdringliche Nacht ins Herz der Finsternis fuhr, diese abgrundtiefe Dunkelheit, die genauso zäh und dicht war wie die heiβfeuchte Luft und der schwere Kokosölgeruch; er musste Tigeraugen haben. Dann sah und hörte Hesse zu, wie der Raddampfer an einem Floβ anlegte und Holz für die Feuerung aufnahm. Zwei Stunden lang gingen Tausende Scheite im Fackellicht von Hand zu Hand, und der Oberkuli zählte sie mit lautem Singsang, was die Geister der Toten, die nachts über dem Fluss schwebten, und die Krokodile fernhalten sollte.
In Pelaiang wohnten Hasenfratz und Gefolge in einem gelben Käfig, der zwischen dem steilen Flussufer und dem Urwald zweieinhalb Meter über dem Boden hing, in einer Hütte aus Bambus und geflochtenen Palmblättern, die auf Pfählen stand. Pelaiang war eine kleine Siedlung mit hundert malaiischen Kulis der holländischen Handelsgesellschaft sowie einem chinesischen Kaufladen. Das Gebiet war erst seit drei Jahren befriedet, das heiβt die Ureinwohner waren vertrieben oder niedergeschossen worden. Hasenfratz’ Djambi-Maatschappji hatte in dem noch völlig ungenutzten Land die erste Holzkonzession bekommen und begann nun, Eisenholz zu gewinnen. Scharen keuchender und singender Kulis schleppten und zerrten die eisenschweren Stämme mit Winden und Hebeln, an Drahtseilen, Tauen und Ketten, auf Rollen und Schlitten aus den Schluchten, durch Sumpf und Urwald, um sie zu 20 Meter langen Balken hauptsächlich für den Werftenbau zu verarbeiten, die auf dem Fluss, der einzigen Straβe, verschifft werden mussten, denn Eisenholz schwimmt nicht. Wir Weiβen – so Hesse – »schreiten ruhig und herrisch durch die Wildnis, erteilen in unserem verdorbenen Malaiisch kalte Befehle und sehen die dunklen, uralten Eisenholzbäume ohne Rührung fallen«. Die Malaien aber täten es auch in Zukunft niemals den Europäern, Chinesen oder Japanern gleich und betrieben solche Werke als Unternehmer, blieben vielmehr immer nur Holzfäller und Schlepper, und was sie dabei verdienten, das ginge fast alles für Bier und Tabak und Uhrketten und Sonntagshüte wieder an die ausländischen Unternehmer zurück.
Hesse ging mit dem Schmetterlingsnetz auf Falterjagd, stapfte zum Schutz vor Blutegeln und Schlangen in Lodengamaschen durch den Urwald wie durch ein fabelhaftes Bilderbuch, von Farnen und Dorngestrüpp überwucherte Baumstämme lagen faulend herum, baumdicke Lianenstränge hingen von aufrechten Riesen herab, auf dem Boden wuselte es in erstickendem Zeugungstaumel, fuβlange Tausendfüβler rannten durcheinander, ganze Ameisenvölker waren unterwegs, schillernde Schmetterlinge flogen unerreichbar über Hesse hinweg, grüne Vögel sahen ihn aus groβen Augen an, er schoss auf einen Nashornvogel und verfehlte ihn, die Insekten summten tausendstimmig, Affenfamilien sprangen durchs Geäst und schrien, die Natur war im Rausch, alles war geiles Gären, war Fruchtbarkeit und Verschwendung, und ein Leben zählte nicht viel. Hesse, Hasenfratz und die Sturzeneggers fuhren in einer schlanken, flachen Prau den Fluss hinauf, schossen Waldtauben und kehrten gerade noch rechtzeitig nach Pelaiang zurück, um sich am Ufer ein paar Eimer Flusswasser über den Kopf zu gieβen, bevor die Nacht und die Krokodile kamen. Hasenfratz’ chinesischer Koch bereitete das Nachtmahl zu und trug auf, die Herren saβen auf der Veranda ihres goldenen Käfigs und verfügten über vier groβe Kisten mit Whisky und Sodawasser, Weiβ- und Rotwein, Sherry, Schnaps und Bremer Schlüsselbier. Sie sahen in die tiefe, satte Dunkelheit, vor und hinter dem schwarzen Vorhang sangen und surrten Millionen Insekten, aus der unergründlichen Finsternis strömte der Geruch wollüstigen Wachstums, »was Nacht ist, weiβ man nur in den Tropen«. Dann legten sie sich unters Moskitonetz und schliefen oder lauschten dem Konzert der Insekten oder hörten dem Regen zu, wie er zart übers Blätterdach rieselte oder wütend auf den Wald trommelte, sogen durchs offene Fensterloch den schweren Geruch des aufgewühlten Urwaldbodens ein und spürten die wilde Natur vor Geilheit brodeln. Hier fühlte sich Hesse im Schoβ der Natur, hier war die Welt noch genauso wie vor hunderttausend Jahren, an die gefällten Eisenbäume dachte er nicht mehr. Ihre leeren Flaschen versenkten sie im Fluss, bevor sie mit dem chinesischen Raddampferchen zurück nach Djambi fuhren, auf ihm den nächsten Saufabend veranstalteten und 19 Flaschen auf dem Tisch hinterlieβen.
Pelaiang war der erste Ort auf dieser Reise, der Hesse sehr gefiel und wo er gern länger als vier Tage geblieben wäre; er sollte der einzige bleiben, von dem er dies sagte. Hans Sturzenegger hingegen war von Pelaiang und dem Urwald enttäuscht, für ihn war der Dschungel »zu chaotisch in der Form, nicht darstellbar, unsere Wälder sind schöner«, schrieb er in sein Tagebuch. Auβerdem ärgerte er sich über die Malaienweiber, gerade die hübschesten wollten sich partout nicht abzeichnen lassen, jedes Mal, wenn er sich ihnen mit dem Malkasten näherte, stoben sie davon. Im Übrigen ermüdete ihn das Klima: »Das kleinste Aquarell strengt mich hier zehnmal mehr an als zu Hause«.
Auf einem holländischen Schiff fuhren die Kumpane über das ölglatte Meer nach Palembang im Südosten Sumatras, Hasenfratz war mit von der Partie. Palembang war eine 75 000 Einwohner zählende, fantastische Pfahlbau- und Wasserstadt, die sich zu beiden Seiten des Musis und an den sumpfigen Ufern zahlloser Zuflüsse und Kanäle entlangzog. Auf dem Wasser herrschte viel Betrieb, im kleinsten Kanal drängelten sich hundert schlanke Prauen, Marktfrauen mit Fischen und Krebsen im Boot, fliegende, sprich schwimmende Händler mit Erfrischungen, Hausierer mit ihrem Kram, die alle Buden abklapperten. Auf dem Fluss lagen Flöβe mit chinesischen Kaufläden oder mit Bambushütten, in denen Baumwolle aus dem Hinterland lagerte, über das Wasser zogen Kähne, auf denen Kochfeuer brannten. Auβer im Strom mit seinen Krokodilen badete alle Welt in den Wasserstraβen, die Kinder nackt, die Frauen verhüllt, und überall sah man Leute, die in aller Unschuld auf der untersten Stufe der Treppe, die von jedem Haus ins Wasser führte, ihre Notdurft verrichteten, gleich daneben putzte sich der Nachbar die Zähne oder wusch seinen Reis. Und überall in der malerischen Stadt spiegelten sich die Pfahlbauten in dem bräunlichen, wenig bewegten Wasser.
Den halben Tag lag Palembang im Wasser, die andere Hälfte des Tages im Schlick. Viermal am Tag wechselte das Wasser die Flieβrichtung, zweimal am Tag floss es flussaufwärts. Palembang lag 70, 80 Kilometer vom Meer entfernt, aber nur zwei Meter über dem Meeresspiegel. Bei Ebbe sog das Meer den Strom aus, und Palembang blieb in einem Brei aus grauem, zähem Schlamm und schwarzem Wasser und all seinem Markt- und Küchenabfall und Mist und Kot liegen, ein Dreck, der unter der unbarmherzigen Äquatorsonne rasch gärte und fabelhaft stank. Die Locals badeten trotzdem in dieser Brühe. Der Giftgestank überzog die ganze Stadt und verfolgte besonders Hesse bis in sein Zimmer im Hotel Nieukerk und in den Schlaf. Auf dem Fischmarkt erhielt der Güllegeruch eine extravagante Note, lebende Fische aller Art lagen herum und abgeschlagene Köpfe auf groβen Haufen. Palembang handelte mit Gummi und Rotang, Kaffee und Pfeffer, Elfenbein und Baumharz, mit Spitzen und den Erzeugnissen seiner Erdölraffinerien und importierte imitierte Sarongstoffe aus England und der Schweiz, Bier aus München und Bremen, sterilisierte Milch aus Holland und Mecklenburg, eingemachte Früchte aus Kalifornien. Japanische Schundgeschäfte versorgten die Einheimischen mit billigem, goldglitzerndem Schmuck aus Deutschland und Amerika, in den Europäerläden gab es Uhren, Schnitzereien, geschmacklose und hinterwäldlerische Geschenkartikel aus Glas, Zinn und Silber, die selbst in Europas Kleinstädten wohl nicht mehr an den Mann zu bringen waren. Hesse kaufte auf dem groβen bunten, üppig stinkenden Basar einen alten chinesischen Seidenschal für dreieinhalb Gulden, nur anderthalbmal so viel wie eine Zwölfdutzendschachtel europäischer Stahlfedern kostete. Trotz der hohen holländischen Zölle war das Leben hier halb so teuer wie in den Freihäfen der britischen Straits Settlements mit ihren Prachthotels und dem Essen, das man dort vorgesetzt bekam, gegen das eine hiesige Reistafel im ungünstigsten Fall Manna war.
Im würzigen Urwald holten Hesse und Genossen tief Luft. Sie lieβen die stinkende, zugegebenermaβen unvollendete städtische Zivilisation hinter sich und fuhren mit der Flut ein schmales Nebenflüsschen hinauf, vorbei an fischenden Malaien, badenden, schreienden Kindern, hinter den letzten Hütten kamen nur noch Sumpf und Busch und Bäume am Ufer und im Wasser. Der Bach wurde zusehends schmaler und seichter, aber die Prau hatte kaum eine Handbreit Tiefgang, und schwankend tauchte sie tief in die schweigende Wildnis ein. Bald lieβen sich die Bäume nicht mehr voneinander unterscheiden, Wurzeln, Luftwurzeln, Äste, Schlingpflanzen, Lianen, alles wuchs durcheinander und bildete ein dichtes Blätterdach, das Boot schob sich durch groβblättrige Wasserpflanzen, ein Eisvogel flog auf, der Bach wand sich jeden Augenblick in neuer Biegung, alle saβen stumm und staunend da, trieben durch die grüne Dämmerung und verloren das Raum- und Zeitgefühl, der Dschungel umschlang sie. Plötzlich wurde der Zauber durch wildes Geschrei gebrochen, eine Horde groβer grauer Affen schwang sich durch das Dickicht, die langschwänzigen Tiere glotzten aus der Höhe Boot und Insassen fassungslos an, knurrten und schnaubten empört, schimpften und fauchten, zeterten und fletschten aus nächster Nähe die Zähne. Da zogen es die Eindringlinge vor, still und behutsam umzudrehen, statt sich von hundert Affen erwürgen zu lassen. Sie probierten es mit einem bereits profanierten Fluss, dem breiten Ogan, und gingen auf die Suche nach malaiischer Unschuld und Krokodilen. Weiber und Kinder standen am Strand und starrten sie an, und sobald das Dampferchen näher kam, rannten sie mit den Händen vorm Gesicht davon. In einem Dorf wurde ihnen eine junge Tänzerin vorgeführt, die krallenartige Verlängerungen mit Silberglöckchen an den Fingern trug und zu Trommel-, Pauken- und Kesselklängen leise mit Armen, Händen und Fingern tanzte. Einen Fischadler verfehlten sie, und die drei Krokodile, die sie sichteten, verschwanden im Wasser, bevor sie zum Schuss kamen.
Nach fünf Tagen in Palembang wollten sie mit einem chinesischen Dampfer nach Singapur zurückfahren. Nach fünf Tagen in dieser sonderbaren Stadt voller Jauche und Moskitos, Hitze und Schweiβ und ohne Bad fieberte Hesse schlaflos der Abfahrt entgegen. Doch das Schiff kam nicht. Zu lesen hatte er längst nichts mehr, seine Bücherkiste stand in Singapur, er konnte nichts anderes tun als sich in der Stadt herumtreiben und viele lange Stunden lang liegen und warten und malaiische Vokabeln lernen und sich bei dem Gedanken beruhigen, alles Widerwärtige dieser Tage würde bald vergessen sein und nur das Schöne und Bunte in der Erinnerung überleben. So vergingen zwei Tage, ehe der Dampfer einlief, und ein weiterer Tag, bis es hieβ, am nächsten Tag liefe er vielleicht aus, man solle sich aber schon abends einschiffen. Hesse & Co. vermieden mittels zweier Zigarren eine erneute Zollkontrolle, fuhren im Boot zum Schiff hinaus, tasteten sich in der Dunkelheit mit ihrem Gepäck halsbrecherisch über Boote und schlafende Ruderkulis zum Fallreep des Dampfers, der noch beladen wurde, 20 Lastkähne mit Rotang lagen beim Schiff, hundert Kulis liefen an Deck herum, man kletterte über Kisten und Balken und traf auf den holländischen Kapitän. Hesse bekam eine von Dampfrohren umgebene Kabine über dem Heizraum, das elektrische Licht und der Ventilator funktionierten nicht, ein stinkendes Petroleumlämpchen übernahm die Beleuchtung, das Bullauge war so groβ wie das Zifferblatt einer Taschenuhr. Heftiger Regen brach aus, der das Verladen hinauszögerte, man saβ auf Deck im kümmerlichen Regenschutz und hielt sich mit Zigarren wach, alle waren sie halbtot vor Müdigkeit und genervt von Hitze, Gestank, Lärm und Enge. Schlieβlich zog sich Hesse in seine Kabine zurück, lag dort wie im Dampfbad, von seiner herabhängenden Hand fielen groβe Tropfen, über ihm liefen die Kulis mit dröhnenden Schritten hin und her, das Schiff hallte von den Ladekränen wider, es wurde die ganze Nacht hindurch beladen. Hesse stand wieder auf, irrte auf Deck umher, stieβ sich an Kisten, fiel über Schläfer, warf einen Käfig mit Affen um und fühlte sich bei Tagesanbruch vollkommen zerstört. Es war die schlimmste Nacht der ganzen Reise.
Hesse hatte noch nie frühmorgens eine Flasche Bordeaux getrunken, jetzt tat er es aus lauter Verzweiflung. Der Dampfer, der vor drei Nächten hätte auslaufen sollen, lag immer noch da und nahm Rotang auf. Doch gegen Mittag legte er ab und fuhr langsam flussabwärts. An Bord nahm Hesse sein erstes Bad nach zehn Tagen, seifte sich gründlich ein und begoss sich mit frischem Flusswasser, danach konnte er wieder aus den Augen sehen. Ein halber Zoo fuhr mit nach Singapur, der Kapitän hielt sich ein halbes Dutzend Katzen, einen räudigen Hund und zehn oder elf Singvögel, und die chinesischen Matrosen hatten einen jungen Jaguar, zwei Gürteltiere und ein Stachelschwein billig eingekauft, um die Tiere in Singapur teuer zu verkaufen. Hesse unterhielt sich mit den niedlichen Affen, von denen es verschiedene Sorten gab, leider stanken sie bestialisch. Beim Abendessen wurde die holländische Kapitänsfrau munter und warf den Gästen zu Ehren ihr groβes Grammophon an, Dollarprinzessin und Caruso, alle Europäer in den Tropen besaβen Grammophone und lebten in einer Art Operetten-Atmosphäre. Noch auf dem offenen Meer hatte Hesse den kolossalen Gestank von Palembang in der Nase und ein Gefühl von Ekel und Fieber.
Groβer Kontrast: In Singapur quartierten sich die Urwald-Urlauber im Raffles ein. Das Riesenhotel war teuer aber gut, so Hesse, obwohl es eine schauderhafte Akustik hatte, in seinen ungeheuren Gängen und Treppenhäusern dröhnte es wie eine Trommel. Im Säulensaal, unter dessen hoher Decke die Flügel der Fächer surrten, trugen die ganz in Weiβ gekleideten Chinesenboys still und gelassen das miserable indisch-englische Essen auf. Man konnte Billard spielen und im groβen Ballsaal Rollschuh laufen, und es kam vor, dass sich ein paar junge angetrunkene Tommys die halbe Nacht in der Hall herumtrieben, wie die Säue tobten und schrien und dem armen Postkartenhändler seinen Schaukasten in Scherben schlugen. Geschäftsführer Müller, seit drei Jahren im Raffles, vertraute Hesse an, dass ein Hotelleiter nach einigen Jahren in den Tropen für Europa nicht mehr tauge, da er sich hier drauβen daran gewöhnen müsse, in hundert Dingen ein Auge zuzudrücken. Vor dem Hotel verkaufte ein kluges, geschäftstüchtiges elfjähriges Chinesenmädchen Spielzeug, ernährte damit seit sechs Jahren seine Familie und lieβ sich von keinem alten Orienthasen beim Feilschen übers Ohr hauen.
Singapur war eine Schatzinsel. Diamanten und grüne Jettsteine, dünne Halskettchen mit bleichen bläulichen Mondsteinen, goldene Armbänder mit Rubinen und dergleichen Sachen lagen bei den indischen Juwelieren aus, die den europäischen Geschmack schon zu gut kannten und nach englischem und französischem Design arbeiteten. In den chinesischen Läden gab es alles, von Zahnbürsten und Blechkoffern bis zu alten Göttern und Vasen und Porzellantellern mit Drachen und Pfauen, vieles zwar Imitat und Fälschung, doch echt in den Formen. Bei den Japanern war der Schwindel am gröβten, und man durfte eigentlich nur kleine, wertlose Dinge kaufen, hölzerne Geduldspiele, Holzschachteln mit eingelegten Verzierungen, die sich auf Fingerdruck an verborgener Stelle öffneten, oder verspielte Fächer mit feinsten Holzstäbchen. Bei den Javanen und Tamilen lohnten sich alte Batik-Sarongs mit Blätter- und Vogelmustern, Kopftücher und Schärpen aus chinesischer oder indischer Seide, Sarongs aus schwerem Goldbrokat, aus Elfenbein geschnitzte Buddhas, Tempel, Götzen und Elefanten mit erhobenem Rüssel. Und dann die Antiquitätengeschäfte und Trödelläden der North Bridge Road, in denen es verschlissene Soldatenstiefel und die schönsten chinesischen Schmucksachen wie Goldkettchen gab, an denen Fische mit tausend Schuppen und glotzenden Augen aus Opalen hingen, oder Broschen und Manschettenknöpfe aus alten chinesischen und siamesischen Goldmünzen. Aber wer so arm wie Hesse war und so viel Geld für Erste-Klasse-Kabinen und Luxushotels ausgeben musste, weil er mit den reichen Sturzeneggers reiste, konnte das meiste nur mit den Augen in Besitz und im Gedächtnis mit nach Hause nehmen, nachdem er tagelang den groβen, bunten asiatischen Basarglanz eingesogen und manchmal stundenlang in einem Laden verweilt und nach allem gefragt hatte, ohne etwas zu kaufen, das war no problem, denn die Zeit, Geduld und Höflichkeit der asiatischen Händler schienen unendlich zu sein.
Chinatown war ein hunderttausendköpfiges Gewimmel in Blau, Weiβ und Schwarz, wo das uniforme gelbe Ameisenvolk fleiβig seinem ernsthaften Bienenleben nachging – »eine geschlossene Welt, die uns nicht braucht«. Das heftige Straβenleben erinnerte Hesse an italienische Städte, kam aber völlig ohne das Gebrüll aus, mit dem in Italien jeder Streichholzhausierer seine Bagatelle ausschrie und jeder Zeitungsjunge sich als schallender Mittelpunkt der Welt darstellte. Zwischen den diskreten Chinesen in blauen Leinenhosen und weiβen Hemden und den Chinesinnen in weiten schwarzen Hosen und blauen Blusen schritten schwarzbraune, hochgewachsene, hagere Inder und Tamilen stolz einher, jeder ein entthronter Radscha, die jedoch ebenso wie die Malaien »mit negerhafter Hilflosigkeit« auf jeden Importartikel hereinfielen und sich kleideten wie Dienstmägde am Sonntag, nämlich in grelle, schreiende Farben. Die smarten Kaufleute des Westens hatten die indischen Seiden und Leinen entbehrlich gemacht, Baumwolle und Kattune noch viel greller, giftiger, indischer gefärbt und bedruckt, und die Inder und Malaien waren gute Kunden geworden für die billigen Stoffe aus Europa. Zehn solcher indischer Papageienfiguren genügten, um eine belebte, dabei aber fast stille Straβe im Chinesenviertel optisch unruhig zu machen, doch sie wurden schnell umschlossen, zugedeckt und erstickt von der Masse der Chinesen. Nachts noch waren diese in ihren Werkstätten produktiv, Hunderte Verkaufsbuden noch geöffnet und hell erleuchtet und die Papageien, Kolibris, Affen in den Käfigen der Tierläden müder als sie.
Hesse und die Sturzeneggers besuchten Landsleute in ihren wohnlichen Bungalows drauβen in herrlicher Garten- und Parklandschaft, man traf sich zum Lunch oder Dinner in den Hotels der Stadt, man kegelte im deutschen Klub Teutonia und trank Whisky, man speiste fein und scheuβlich teuer im Singapore Club und trank Rheinweinbowle, im Chinesischen Klub Tee bei monotoner und zugleich leidenschaftlicher Musik, man ging in die Town Hall, saβ im Smoking unter lauter Chinesen und applaudierte den Akrobaten, in der Star Opera war man wieder vom malaiischen Theater enttäuscht, man unternahm nächtliche Rikschafahrten in tollem Galopp und trieb sich in den Hurengassen herum. Die chinesischen Bordelle sahen sehr hübsch aus, schienen aber nur für Gelbe da zu sein. Für Weiβe waren offenbar Japanerinnen vorgesehen, auch gab es viele russische Dirnen. Die Mehrzahl der Freudenhäuser, die hohen Profit abwarfen, gehörten dem Hörensagen nach portugiesischen und französischen Missionspatres. Am Sonntag dann fuhr man mit Bahn und Boot zu den Spielhöllen von Johore, ganze Züge voll Chinesen trieb es zum Glücksspiel hinaus, darunter eine Menge Freudenmädchen und Hurenmütter. Die schweizerdeutsch-deutsche Truppe nahm erst einmal einen Cocktail im Hotel Johore zu sich, dann stürmte sie eine der Höllen, wo Chinesen und ihre Weiber sich still und gespannt um die Spieltische drängten. Die weiβen Herren verloren die Schlacht um das Glück, versuchten es am Nachmittag in drei weiteren Höllen, in denen es wie in Bienenkörben summte. Fast hätten sie das letzte Boot verpasst, und auf dem letzten Wagen des überfüllten Zuges kamen sie als Trittbrettfahrer nach Singapur zurück.
Fahrt nach Colombo via Penang, Hesse hat eine groβe, aber heiβe Innenkabine und das wohlige Gefühl, wieder auf der vertrauten »Prinz Eitel Friedrich« zu sein, der Schiffsarzt zeigt ihm seine Einkäufe aus Japan, dann knobelt Hesse mit dem Arzt und dessen Tafelrunde, sie würfeln um Bier und Wein, Schnaps und Zigarren und sind fidel wie die Studenten, die vier oder fünf jungen Doktoren erzählen Medizinerwitze, was für den Augenblick ganz lustig ist, doch auf Dauer fad. Unter den Mitreisenden befindet sich ein Herr mittleren Alters aus reicher Berliner Familie, der in jungen Jahren all sein Vermögen in Monte Carlo verlor und nun Sprachlehrer in Japan ist, auch den Prinzen unterrichtet, viele Sprachen spricht, von feinstem Schliff ist und stark trinkt. Nach Tagen auf hoher See, ohne Blick auf Küsten und bergige Inseln, fühlt sich Hesse müde und leer, Schwermut umfängt ihn wie das endlose Meer. Doch Ceylon empfängt ihn mit offenen Armen, auch mit aufgehaltener Hand. Das Hotel Bristol ist anständig, doch teuer – zehn Rupien pro Nacht –, abends geht er mit Sturzeneggers in ein Freudenhaus, um singhalesische Mädchen zu sehen, erst in ein europäisches, das sie sofort wieder verlassen, dann in ein primitives, echtes. Die Sahibs wünschen einen singhalesischen Tanz zu sehen – fünfzehn Rupien –, sechs Mädchen von 16, 17 Jahren erscheinen nackt, können aber nicht allzu viel. Die Herren besuchen ein singhalesisches Theater, das wie die malaiischen ist, nur noch übler. Am nächsten Morgen fährt Hesse allein nach Kandy – zwischen ihm und den Sturzeneggers ging es nicht immer reibungslos zu –, auf dem Bahnhof in Colombo spricht ihn alle naselang irgendjemand an, der ihm irgendetwas erzählt und am Ende Geld haben will, doch dann ist er im Coupé erster Klasse fast allein, der Schaffner erscheint und fragt, ob alles all right sei, und sagt, er erscheine kein weiteres Mal, also bitte Trinkgeld, das sagt er nicht, aber Hesse versteht es.
Flaches Sumpf- und Reisland, Täler voll überquellender Fruchtbarkeit, dunkelbraune Männer durchqueren mit Ochsen einen rotbraunen Fluss, an den Hängen liegen sorgfältig gestufte Reisterrassen, darüber bewaldete Höhen und kühne Felsen. Vom Hotel Florence Villa in Kandy ist Hesse auf Anhieb enttäuscht, er bekommt ein schäbiges Zimmer, nebenan schreit ein Baby. Kaum installiert geht er auf die Suche nach einer besseren Bleibe und findet ein Zimmer im noblen Queen’s Hotel, das er hatte vermeiden wollen. Die erste Nacht bleibt er aber noch im Florence Villa, isst dort auch zu Mittag und zu Abend, die Boys reden ihn mit Master an, man speist schweigsam an englischen Familientischen, die Küche ist überraschend gut, fast bereut er seinen Entschluss umzuziehen, doch nach Tisch spielen lärmende Kinder vor seiner Tür, die Sanitäranlagen sind nicht sauber, es ist doch nichts. Mitten in der Nacht wacht er fröstelnd auf und wird von Übelkeit und Bauchkrämpfen befallen, den Rest der Nacht wandert er zwischen Zimmer und Lokus hin und her. Mit Sack und Pack übersiedelt er ins Queen’s, legt sich ins Bett und wird immer wieder von Diarrhöe heimgesucht. Er hat seine groβe Reiseapotheke durch die halbe Welt geschleppt und nichts weiter als Schlafmittel und Chinin benutzt, und nun, da er Opium braucht, liegt sie in Colombo. Im Nebenzimmer hört er Schweizerdeutsch sprechen, der Schweizer Chemiker aus Ostafrika hat zwar kein Opium, ist aber nett, und sein Freund gibt Hesse Bismuth. Tags darauf kommen die Brüder Sturzenegger nach Kandy, Hesse bekommt sein Opiat, und statt zu essen befolgt er den Rat Roberts, der selbst an Ruhr erkrankt, und trinkt halb und halb Brandy und Port. Erst zwei Wochen später, nach sechstägiger strenger Diät nebst Arznei auf dem Dampfer, der ihn nach Europa bringt, geht es Hesse wieder besser.
Zwischen den Darmexplosionen, geschwächt vom Liegen und Fasten und den Koliken, benebelt vom Wein und betäubt von Opiaten macht Hesse Spaziergänge durch Kandy, um den künstlichen See herum, durch den Botanischen Garten, er jagt sogar Schmetterlinge im Hotelgarten und in der nächsten Umgebung. Die Vegetation ist wunderbar: herrliche groβe Bäume mit riesigen roten Blüten, mächtige Talipotpalmen mit weiβen Kronen von Blütenzweigen, 20 Meter hoher Bambus, und überall blühen die weiβen, kelchförmigen temple flowers. Das Menschengeschlecht blüht dunkelbraunschwarz, glänzt bronzefarben und leuchtet rot aus dem Betelmund, viele Mädchen und junge Frauen sind wunderschön, groβe schöne Augen haben sie alle ohne Ausnahme, die Singhalesen besitzen von Natur aus eine liebenswürdige Sanftmut und einen geräuschlosen, rehartigen Anstand, wie man sie im Westen nicht findet. Kandy, dieser Rest einer alten Königs- und Tempelstadt, ist lieblich-schön, gilt als der hübscheste Ort der Insel, dem englischen Geld ist es gelungen, ein bequemes, sauberes Fremdenstädtchen à la Interlaken daraus zu machen und es systematisch zu verderben. Von der kriechenden und schamlosen Aufdringlichkeit der Kutscher, Rikschakulis, Händler und Bettler fühlen sich die englischen Spaziergänger nicht belästigt, sondern belustigt, denn den Briten, diesen genialen Kolonisatoren, bereitet es ein Vergnügen, dem Untergang der von ihnen erdrückten Völker zuzuschauen, der überaus human, freundlich und fröhlich vor sich geht, denn die britische Herrschaft ist kein Morden, nicht einmal Ausbeutung, sondern stilles, mildes Korrumpieren und moralisches Unterminieren. Dieser englische Betrieb hat immerhin Stil, Deutsche und Franzosen würden es viel schlimmer und dümmer machen. Wer aber ein Herz, ein zartes Gemüt und offene Ohren hat, für den ist das Spazierengehen eine Qual, ein anstrengender Spieβrutenlauf zwischen den Hyänen der Fremdenindustrie, alle drei Meter steht ein Bettler, ein kleines Mädchen mit den traurigsten schwarzen Augen, ein weiβhaariger Greis mit Heiligenschein, doch sein suchender Beterblick ist keineswegs ein Ruf nach Göttern und Erlösung, sondern nach money. Grinsende Eltern schicken ihre zahlreiche Nachkommenschaft hinter Hesse her, just for money, ein Rudel Jungen schlieβt sich ihm an, die ihm gute Schmetterlingsplätze zeigen wollen, ihn auf jede Fliege aufmerksam machen und dabei jedesmal die Hand um einen Penny ausstrecken, ein raffinierter, hartnäckiger Falterhändler heftet sich an Hesses Fersen, lauert ihm ständig und überall auf und nimmt ihn aus. Hesse bleibt nie allein, kommt keinen Augenblick zur Ruhe, die Natives sind höchst lästig, obendrein beschämt es ihn, dass die meisten von ihnen besser Englisch sprechen als er.
Morgens wieder Durchfall. Am späten Nachmittag geht Hesse in den Regen und die schon schwarze Nacht hinaus und biegt in den Tempelweg ein. Am Eingang des alten Heiligtums schallt ihm eine traumhaft dumpfe Musik entgegen, durchs Tempeltor sieht er in düstere Räume, in denen dünne Kerzen brennen, hier und da hocken Betende und murmeln, der heftig süβe Duft der temple flowers erfüllt die Luft. Sofort bemächtigt sich Hesses ein Führer und schiebt ihn vorwärts, zwei sanftäugige Jünglinge eilen mit Kerzen in den Händen herbei und gehen voran, beleuchten jede kleine Stufe und jeden Säulenvorsprung, und Hesse steigt wie in eine Schatzhöhle aus einem arabischen Märchen. Man hält ihm eine Schale vor und fordert eine Eintrittsgabe, man bietet ihm Tempelblumen dar, er bezahlt und opfert die Blüten verschiedenen Bildnissen. Bei dem bisschen Flimmerlicht ist nicht viel zu sehen, aber das Ganze macht einen geheimnisvollen, mystischen Eindruck. Vorbei an steinernen Löwen und Lotosblütenbildern gelangt Hesse zu einem gläsernen Schrein voller Schmutz und Buddhafiguren aus Gold, Messing, Silber, Elfenbein, Granit, Holz, Alabaster, in einem Silberschrein sitzt still und fein ein alter, aus einem einzigen groβen Kristall geschnittener Buddha, Silber- und Messingschalen und blanke Hände werden Hesse vorgehalten. Priester zeigen ihm die alten, in Silber gebundenen, in Sanskrit und Pali verfassten heiligen Bücher des Tempels, was sie selber auf Palmblätter schreiben, ist eine prosaische Quittung für das Trinkgeld. Man führt ihn zum Altarschrein und zum heiligen Zahn Buddhas, und Hesse entrichtet seinen Obolus. Ihn beschleicht keinerlei Achtung vor den lächerlichen Bildnissen und Schreinen, den miserablen Priestern und ihren unterwürfigen Helfern und dem ganzen Heiligtum, in dem der schöne, lichte Buddhismus zu einer wahren Rarität von Götzendienst verkommen ist, gegen den auch der spanischste Katholizismus noch durchgeistigt wirkt. Er hat nur Mitleid mit den sanften indischen Völkern, die eine herrlich reine Lehre hier zur Fratze entstellt haben. Man zieht und schiebt Hesse über Treppenstufen in die Nacht hinaus, zerrt ihn über nasses Gras zu einem zweiten, kleineren Tempel, dort opfert er Blumen und Rupien und sieht plötzlich einen groβen, grellrot und gelb bemalten Buddha aus Granit vor sich in der Wand liegen. Nun ist er fertig, steht drauβen im Regen, bemerkt mit Befremden, dass der ganze nächtliche Tempelspuk nicht mehr als 20 Minuten gedauert hat, und stellt fest, dass er pleite ist. Er hat etwa 25 Trinkgelder ausgeteilt, aber er muss noch den Führer, die Kerzenträger und den Priester des zweiten Tempels entlohnen. Ein Tempeldiener begleitet ihn im Auftrag seiner Gläubiger zum Hotel, Hesse holt Geld und kauft sich von allem Buddhismus frei.
Ceylon war ziemlich verunglückt. Alle drei Morgenlandfahrer fühlten sich erschöpft und krank, die Opiumkur blieb ohne die erwünschte Wirkung, zudem regnete es unaufhörlich, Kandy lag grau unter triefenden Wolken oder im Nebelbrei, in Colombo hatten sie noch unter der grausamen Hitze gestöhnt. Hesse war reisemüde, auβerdem knapp bei Kasse, diese Art Leben und Reisen ging über seine Verhältnisse. Die indische Malabar-Küste wurde aus dem Programm gestrichen, doch bis zur Abfahrt des Schiffes nach Europa musste noch eine volle Woche hingebracht werden. Sie fuhren nach Nurelia (Nuwara Eliya), sechseinhalb Stunden mit der Bahn durch grüne Täler ins Gebirge hinauf, an Teeplantagen, Schluchten, Wildbächen vorbei, die letzte Stunde in einer wackeligen Schmalspurbahn. In Nurelia war es kühl, im Hotel gab es Tee und Kaminfeuer und ein schlechtes Zimmer, der Manager war ein Deutscher, sprach aber nur noch mühsam Deutsch. Am nächsten Tag bestieg Hesse allein den Pedrotallagalla (Pidurutalagala), dessen Höhe in englischen Fuβ beachtenswert und noch in Metern nicht allzu unbedeutend klang, immerhin handelte es sich um den höchsten Berg der Insel, doch seine Besteigung war ein Spaziergang. Fröstelnd lieβ Hesse das kühle Hochland mit dem See, den Hotels, den groβzügig angelegten Golf- und Tennisplätzen und den Singhalesen, die sich vor ihren Hütten lausten, hinter sich, wanderte durch dichten Wald, dürres Buschdickicht und lästige Mückenschwärme, über Moor, Bergbäche und Heideland auf den kahlen Gipfel zu. Da fegte der Wind Wolken und Nebel aus dem Tal von Nurelia und legte auch die anderen Täler frei, das ganze Hochgebirge von Sri Lanka lag nah vor Hesses Augen, er konnte die gesamte Insel überblicken, die auf dem blauen, glatten Meer lag und tatsächlich das Paradies der alten Sagen zu sein schien. Diese Urlandschaft berührte ihn mehr als alles, was er auf dieser Reise gesehen hatte, mehr als alle Palmen und Paradiesvögel, Tempel, Reisfelder und selbst der Urwald. Erst hier oben in der kalten Luft wurde ihm vollkommen klar, wie stark der westliche Mensch in raueren, nördlichen Ländern verwurzelt war. »Wir kommen voll Sehnsucht nach dem Süden und Osten (…), und wir finden hier das Paradies, die Fülle und die reiche Üppigkeit aller natürlichen Gaben, wir finden die schlichten, einfachen, kindlichen Menschen des Paradieses. Aber wir selbst sind anders, wir sind hier fremd und ohne Bürgerrecht, wir haben längst das Paradies verloren, und das neue, das wir haben und bauen wollen, ist nicht am Äquator und an den warmen Meeren des Ostens zu finden, das liegt in uns und unsrer eigenen nordländischen Zukunft.«
Hesse hatte diese Reise getan, nicht um den Urwald zu besichtigen, Krokodile zu streicheln und Schmetterlinge zu fangen, wie er drollig Ludwig Thoma schrieb, sondern um zu lernen, ruhig, geduldig, gleichmütig, heiter durchs Leben zu ziehen. Er lernte es nicht, fand nur sich selbst und seine Unruhe, auch wenn er hundertmal um Weisheit flehte und nach Frieden rang. Diese Reise war ein »Traumbesuch bei fernen Vorfahren«, eine erhoffte »Heimkehr zu märchenhaften Kindheitszuständen der Menschheit«. Aber die indische und malaiische Welt war nur ein bunter ethnischer Maskenball, auf dem die Reste einer Paradiesmenschheit tanzten, gutmütige, unbekümmerte Naturvölker, die vom Westen gefressen wurden. Inder und Malaien waren schwach und ohne Zukunft, doch anstatt sie wie jüngere Geschwister zu behandeln, führte sich der Europäer ihnen gegenüber als Eroberer, Dieb und Ausbeuter auf. Hesse wunderte und verletzte die Selbstverständlichkeit, mit der selbst nette und redliche Weiβe wie Hasenfratz die Natives als Unterworfene und weit niedrigere Wesen ansahen. Das war ein Zeichen von Schwäche, die sich als Stärke ausgab und sich zum Beispiel in der holländischen Version rühmte, die Eingeborenen besser in Zucht zu halten als die Briten, die ihre Natives angeblich verwöhnten. Was die Engländer »da drauβen im Pfefferland treiben und (…) als europäische Kultur servieren«, so Hesse, war bei aller Einseitigkeit doch recht schön. Am meisten imponierten ihm jedoch die Chinesen. Im Unterschied zu den Japanern, die allgemein unbeliebt und als Gauner verhasst waren, sprachen die europäischen Kaufleute von den Chinesen mit Achtung, trotz oder aufgrund einer Ahnung von Rivalität und Furcht vor ernsthafter Konkurrenz. Für Hesse waren die Chinesen das erste wirkliche Kulturvolk, das er sah, dem Westen zwar unterlegen in äuβeren Vervollkommnungen der Zivilisation, doch überlegen als Volk, als Einheit von Rasse und Kultur, in der das Individuum mit dem Ganzen verschmolz, als Gemeinschaft, die in langer Geschichte ihre Eigenart herausgebildet und gepflegt hatte, eine allgemein geteilte und zugleich spezifische Lebensart, wovon in Europa nur die Engländer eine Vorstellung hatten. Starken Eindruck auf Hesse machte die religiöse Ordnung und Gebundenheit all der Millionen Seelen Asiens, der Osten atmete Religion, wie der Westen von Vernunft und Technik lebte. Was Europa brauchte, wenn es überleben und seine Kultur bewahren wollte, war eine Art seelischer Lebenskunst oder seelischen Gemeinbesitzes, aber nicht über den Weg eines Religionsimports aus dem Osten, auch nicht durch Rückkehr zu Kirchenchristentum, schon gar nicht zu Urmenschentum und Paradiesunschuld, »zur Urwelt führt kein Weg zurück«. Es gab in Europa genauso wie in Asien eine zeitlose, gleichsam unterirdische Schicht von Gemeinsamkeit, eine Welt der Werte und des Geistes, und es war gut und richtig, im Frieden einer solchen geistigen Welt leben zu wollen, an der die Veden und die Bibel, Buddha und Goethe gleichermaβen Anteil hatten, dann endeten auch Europaflucht und Indiensucht. Dann konnte es auch eine Gemeinschaft über die Völkergrenzen und Erdteile hinweg, Zusammengehörigkeitsgefühl, Brüderlichkeit, Einigkeit, die Menschheit als Einheit, eine Weltgemeinschaft geben.
Bald darauf begann der Erste Weltkrieg.
Hesse fror elendiglich, als sie in Nebel und Regen von Nurelia aufbrachen. Nach neun Stunden Bahnfahrt erreichten sie das heiβe Colombo. Die »York« brauchte 16 Tage und 17 Nächte bis Genua. Äuβerlich war alles gleich, in Hesses Innerem alles anders als bei der Hinfahrt. Am Golf von Aden brannten die kahlen Felsen und weiβen Sandwüsten. Am Roten Meer ging die Sonne hinter Abessinien unter, über den ganzen Himmel spannte sich ein Fächer nordlichtartiger Strahlung, auf der anderen Seite färbten sich die Berge Arabiens rosa. Fünf Sonnenuntergänge später glühten am Suezkanal tausend winzige Wolken über Afrika, über der arabischen Wüste zog der groβe Vollmond herauf. Port Said schlief bereits, doch bei Einlaufen des Schiffs öffneten die Läden und Cafés wieder. Hesse schloss sich ein paar Lebemännern von Passagieren an und besuchte drei Bordelle, interessant war es nicht. Im Hafen von Neapel lag eine Menge Soldaten, die auf ihre Verschiffung in den Krieg warteten, nach Libyen, wo sie die Türken aus ihren letzten nordafrikanischen Besitzungen vertreiben sollten; die meisten sahen ernst und beklommen aus. Hesse ging ins Teatro Bellini, man gab Verdis La forza del destino.