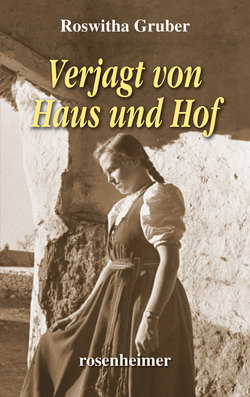Читать книгу Verjagt von Haus und Hof - Roswitha Gruber - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMein Papa
Soweit ich zurückdenken kann, wanderte ich mit Rosina, meiner Mama, in schöner Regelmäßigkeit zum Friedhof. Dabei nahm sie immer eine alte abgewetzte Einkaufstasche mit, in der sich allerlei Utensilien zur Grabpflege befanden. Manchmal trug sie darin auch ein Blumenstöckchen. Ich freute mich immer, wenn es auf den Friedhof ging. Die vielen Beete mit den bunten Blumen, die schmiedeeisernen Kreuze und die pompösen Grabsteine gefielen mir. Bald erfuhr ich, dass man diese Beete Gräber nennt, es gab schmale und breite. Während Mama sich immer an einem sogenannten Doppelgrab zu schaffen machte, sauste ich zwischen den anderen Gräbern herum, um zu schauen, welches den schönsten Blumenschmuck hatte. Vorne an jedem Grab befand sich ein kleiner runder Behälter mit Weihwasser und einem Buchsbaumzweigerl. Wie ich das bei anderen Friedhofsbesuchern beobachtet hatte, »segnete« ich damit die Gräber, was mir viel Spaß machte.
Einmal aber, als mir das zu langweilig wurde, ich mochte viereinhalb gewesen sein, ging ich zur Mutter und beschwerte mich: »Warum machst du dich immer an diesem Grab zu schaffen? Es gibt doch Gräber, die viel schöner sind als dieses hier.«
Wehmütig lächelte sie: »Das hast du richtig beobachtet, Lisi. Es gibt prächtigere Gräber als das unsere. Wir haben aber nicht viel Geld. Ich muss schon froh sein, dass die Tante Bärbel die Kosten für den Marmorstein übernommen hat. Mein Geld hätte nur für ein einfaches Holzkreuz gereicht, und ich kann gerade mal ein paar bescheidene Blumen kaufen.«
Den Widerspruch, den ich schon auf den Lippen hatte, wischte sie weg: »Weißt, Lisi, dass ich genau dieses Grab pflege, liegt daran, dass dein Papa hier begraben ist.«
»Mein Papa?«, fragte ich interessiert. Unter »Papa« konnte ich mir nichts vorstellen. Das merkte die Mama wohl, deshalb erklärte sie: »Jetzt wird es doch langsam Zeit, dass du etwas über deinen Papa erfährst. Daheim werde ich dir Fotos zeigen.«
Im Esszimmer nahm sie eine Pralinenschachtel aus der Kommode und setzte sich mit mir an den Tisch. Während sie einige kleine Schwarz-Weiß-Bilder vor mich hinlegte, erklärte sie: »Das ist Kaspar, dein Papa, als Bub. Das ist dein Papa als Lehrling. Das ist dein Papa beim Fasching. Das ist dein Papa bei der Hochzeit.«
Der Mann, der mich von diesen Bildern her anlächelte, gefiel mir. Er sah gut aus und wirkte freundlich. Zum Schluss nahm die Mama ein Foto aus der Schachtel, das wesentlich größer war als die anderen, und farbig. Es zeigte einen riesigen Lastwagen mit einer Getränkewerbung auf der Seitenwand und daneben einen jungen Mann. Dieser stand stolz und selbstbewusst mit einem Fuß auf dem Trittbrett, als wäre es sein eigener Wagen. Von seinem Gesicht war leider nicht viel zu erkennen. »Ist das auch mein Papa?«, wollte ich mich vergewissern.
»Freilich ist er das. Ein ganzes Jahr lang hat er mit diesem Auto Getränke ausgefahren.«
»Warum ist der Papa nicht bei uns?«, wollte ich nun wissen.
»Er ist tot. Er liegt doch in dem Grab, das ich immer pflege.«
»Warum ist er tot?«
»Er starb durch einen Autounfall.« Bei diesen Worten liefen der Mama Tränen aus den Augen. Darüber war ich sehr bestürzt. Bis dahin hatte ich sie noch nie weinen gesehen.
»Nicht weinen«, tätschelte ich ihre Hand. Da nahm sie mich in die Arme und drückte mich fest an sich. »Du bist das Einzige, was mir von ihm geblieben ist.«
»Hatte er mit dem großen Auto den Unfall?«, erkundigte ich mich nun.
»Nein, damit nicht. Es war mit seinem eigenen kleinen Auto.«
Diese Informationen genügten mir für den Moment. Die Mama packte wieder alles sorgfältig in die Schachtel und stellte sie zurück in die Kommode. Beim nächsten Friedhofsbesuch aber blieb ich an ihrer Seite und half ihr bei der Grabpflege. Dies tat ich in dem Bewusstsein, meinem Papa etwas Gutes zu tun. Ich zupfte Unkraut und harkte ein bisschen herum. Gerne hätte ich auch das Grab gegossen, aber die großen Zinkgießkannen, die neben dem Brunnentrog hingen, waren für mich zu schwer und zu unhandlich. Deshalb versprach mir die Mama, sie werde mir eine kleine leichte Plastikgießkanne kaufen. Das tat sie auch, von da an goss ich fleißig Papas Grab.
In der Folgezeit ließ ich mir immer wieder mal von der Mama die Schachtel geben, um die Fotos vom Papa anzuschauen. Auf diese Weise baute ich eine Beziehung zu ihm auf. Mit zunehmendem Alter erfuhr ich noch mehr über ihn, durch meine Mama, durch ihre Schwester Klara, durch ihren Bruder Ludwig und vor allem durch Korbinian, meinen Opa.
Demnach muss mein Papa eine traurige Kindheit gehabt haben. Im Jahre 1938 starb Gretl, seine Mutter, im Alter von zweiunddreißig Jahren an Krebs. Das war für ihn, seinen Bruder Hans und seinen Vater Hans ein Schock. Zu der Zeit war mein Vater erst sieben Jahre alt, sein Bruder neun und sein Papa fünfunddreißig. Da dieser von Beruf Lehrer war, hätte er sich eigentlich gut um seine mutterlosen Kinder kümmern können. Sie wären morgens mit ihm zur Schule und mittags wieder mit ihm heimgegangen. Dort hätte er für sich und seine Söhne kochen können. Andere Männer kochen ja auch. Wenn er seine Hefte korrigierte oder seine Unterrichtsvorbereitungen machte, hätte er leicht ein Auge auf die Buben haben können, während diese an ihren Hausaufgaben saßen. Offensichtlich war der Herr Lehrer zu faul dazu, denn er schickte die Buben zu seiner Schwägerin Bärbel, damit die sich um die Kinder kümmere. Bärbel war die Schwester seiner Frau, zwei Jahre älter als diese und ledig. Sie wohnte in einem Nachbardorf, wo sie sich ihren Lebensunterhalt als Gemeindesekretärin verdiente. Im Gegensatz zu ihrem Schwager war sie sogar ganztags berufstätig. In ihrer knapp bemessenen Mittagspause hastete sie heim, bereitete das Essen für sich und die Neffen und lief wieder ins Büro. Daher waren die beiden Brüder sich selbst überlassen, wenn sie ihre Hausaufgaben machten. Am Abend aber schaute die Tante nach, ob alles ordentlich erledigt war.
So verging ein Monat nach dem anderen, und die Gemeindesekretärin empfand ihr Leben als zusehends anstrengender. Das lag nicht zuletzt daran, dass nicht alles so lief, wie sie sich das ausgemalt hatte. Sie hatte erwartet, der besorgte Vater werde regelmäßig nach seinen Söhnen schauen und sich dabei in sie verlieben, oder zumindest erkennen, dass sie für ihn und seine Kinder unentbehrlich sei und ihr einen Heiratsantrag machen. Aber nichts dergleichen geschah. Im Gegenteil, bald musste sie erfahren, dass der Schwager eine Freundin hatte. Zu ihrer maßlosen Enttäuschung kam hinzu, dass sie sich selbst die Schuld für diese Entwicklung zuschrieb. Denn hätte sie ihrem Schwager Hans nicht den Rücken freigehalten, indem sie sich um seine Söhne kümmerte, hätte er keine Zeit für eine neue Liebschaft gehabt.
Nachdem sich die Geschichte nicht in die erwartete Richtung entwickelt hatte, blieb ihr nur noch die Hoffnung, der Schwager werde bald heiraten und seine Kinder wieder zu sich nehmen. Doch auch in diesem Punkt enttäuschte er sie. Er heiratete zwar nach dem schicklichen Trauerjahr, unternahm aber zunächst eine Hochzeitsreise. Als er von dieser zurück war, sprach Bärbel ihn darauf an, wann er seine Söhne abzuholen gedenke. Nun erklärte er ihr, er wolle seine Kinder nicht schon wieder aus ihrem gewohnten Umfeld reißen. Sie hätten sich doch so gut bei ihr, in der Schule und im Dorf eingelebt. Außerdem wolle er seiner Frau keine so großen Stiefkinder und seinen Söhnen keine Stiefmutter zumuten. Bei ihr, der leiblichen Tante, seien sie viel besser aufgehoben. Sie könne ihnen doch wesentlich besser das Gefühl von Geborgenheit geben, als das eine Stiefmutter könne.
Trotz seiner säuselnden Worte war Bärbel klar, dass ihr Schwager in Wirklichkeit frei von jeder Verantwortung sein wollte, um das Leben mit seiner neuen Frau genießen zu können.
Das gepriesene Gefühl von Geborgenheit hatten die beiden mutterlosen Buben bei ihrer Tante leider nicht. Sie brachte ihnen kaum Wärme entgegen, erst recht nicht, nachdem sie von der Wiederheirat ihres Vaters erfahren hatte. Sie versorgte die Halbwaisen jedoch gewissenhaft, sie gab ihnen gut und ausreichend zu essen, hielt die Kleidung in Ordnung und hatte ein Auge darauf, dass sie bei der Körperpflege nicht mit Wasser und Seife sparten.
Nachdem sich Bärbel von ihrem Schwager so getäuscht sah, war sie nicht länger gewillt, die Verantwortung für Kaspar und Hans allein zu tragen und sich um deren leibliches Wohl zu kümmern. Deshalb schrieb sie um die Osterzeit ihren Eltern Paula und Konrad, die in München lebten, einen Brandbrief.
N.-Dorf, den 5. April 1939
Liebe Eltern!
Wie Ihr wisst, habe ich vor einem guten Jahr Hans und Kaspar, Eure Enkel, zu mir genommen, um ihren Vater der Sorge um sie zu entheben. Dies tat ich in der Annahme, dass es nur für kurze Zeit sei, bis er sich erneut vereheliche. Gewiss habt Ihr erfahren, dass er vor Kurzem wieder geheiratet hat. Nun weigert er sich, seine Kinder zurückzunehmen. Ich bringe es aber nicht fertig, sie ihm einfach vor die Tür stellen.
Wie Euch bekannt ist, habe ich als Gemeindesekretärin einen sehr verantwortungsvollen Posten und bin den ganzen Tag gefordert. Daher wird es mir zu viel, mich weiterhin alleine um meine Neffen zu kümmern.
Hiermit möchte ich an Euer Großelterngefühl appellieren und Euch um Unterstützung bitten. Nun, da Papa pensioniert ist, müsst Ihr doch nicht mehr in München wohnen bleiben. Was hieltet Ihr davon, wenn Ihr in mein Dorf übersiedelt? Ich würde für Euch eine nette kleine Wohnung suchen, dann könnten wir uns gemeinsam um die Buben kümmern. Sie könnten weiterhin in meiner Wohnung schlafen, aber es wäre gut, wenn sie sich tagsüber bei Euch aufhielten.
Der Ältere wird ab Sommer die Oberschule besuchen. Dann könntest Du, lieber Vater, als ehemaliger Rektor doch besser seine Hausaufgaben beaufsichtigen als ich das kann. Gegebenenfalls könntest Du ihm sogar Nachhilfeunterricht geben. Auch Kaspar macht einen sehr intelligenten Eindruck und wird seinem Bruder vermutlich in zwei Jahren auf die Oberschule folgen.
In der Hoffnung, bald einen positiven Bescheid von Euch zu bekommen, wünsche ich Euch ein schönes Osterfest und verbleibe mit ergebensten Grüßen
Eure Tochter Bärbel
Mit diesem Brief rannte Bärbel bei ihren Eltern offene Türen ein. Dem Vater, der seit 1936 im Ruhestand war, gefiel es längst nicht mehr in der Großstadt. Deshalb hatte er mit seiner Frau schon erwogen, aufs Land zu ziehen. Sie hatten nur noch nicht den geeigneten Ort gefunden. Auch hatten sie sich bereits Sorgen um ihre einzigen Enkel gemacht und überlegt, wie sie sich in die Fürsorge um sie einbringen könnten. Aus diesem Grunde kam ihnen Bärbels Brief wie gerufen und löste all ihre Probleme mit einem Schlag. Dies teilten sie ihrer Tochter mit und fingen sofort an, ihre Zelte in München abzubrechen. Bärbel ihrerseits bemühte sich sogleich um eine geeignete Wohnung für die Eltern. Als Gemeindesekretärin saß sie ja an der Quelle und wusste immer, wo etwas frei war oder frei wurde.
Schon nach kurzer Zeit konnte sie ihren Eltern die erfreuliche Mitteilung machen, dass sie eine passende Wohnung gefunden habe, die noch dazu ganz in ihrer Nähe liege.
Der Umzug ging schnell vonstatten, und es dauerte nicht lange, da hatten sich die Großstädter in dem kleinen Dorf eingelebt. Mit der Betreuung der Enkel klappte es vorzüglich. Sie frühstückten gemeinsam mit ihrer Tante, verließen mit ihr das Haus und begaben sich nach Schulschluss an den Tisch der Großeltern. Bei den Hausaufgaben hatte »Opa Rektor« ein wachsames Auge auf sie, brauchte aber nie helfend einzugreifen, denn die beiden Burschen, hochintelligent, verinnerlichten schnell alles, was sie im Unterricht gehört hatten.
Nach dem Abendessen bei den Großeltern kehrten sie regelmäßig zu ihrer Tante zurück.
Wenige Monate, nachdem das alte Ehepaar aufs Land gezogen war, brach der Zweite Weltkrieg aus. Nun waren sie noch glücklicher, nicht mehr in München zu wohnen. Hier auf dem Lande, unweit des Starnberger Sees, lebten sie nicht nur in einer zauberhaften Landschaft, sie fühlten sich auch wesentlich sicherer. Als sie nach dem Bombardement auf München am 9. September 1942 erfuhren, dass ihr ehemaliges Wohnhaus dem Erdboden gleichgemacht worden war und dass zahlreiche Tote und Verletzte zu beklagen waren, dankten sie dem Himmel, dass er ihnen rechtzeitig den Wink gegeben hatte, aufs Land zu ziehen.
Was ihre Enkel betraf, so brachten auch die Großeltern ihnen nicht in dem Maß Liebe und Güte entgegen, wie es die beiden gebraucht hätten. Stattdessen meinten sie, mit strenger Hand vorgehen zu müssen, um aus ihnen ordentliche und lebenstüchtige Menschen zu machen.
Als der Krieg im Mai 1945 zu Ende war, kamen in unserem Lande endlich wieder die jungen Leute zu ihrem Recht. Während des Krieges hatte es für sie ja keinerlei Vergnügungen gegeben. Schon wenige Monate nach Kriegsende wurden hier und da erste bescheidene Tanzveranstaltungen angeboten. So lud der wiedererstandene Trachtenverein bereits Ende September 1945 zu einem »Oktoberfest« ein. Statt Bier gab es allerdings nur Leitungswasser. Aber man konnte tanzen und miteinander fröhlich sein. Einer der Dorfwirte veranstaltete 1946 zum ersten Mal einen »Tanz in den Mai«. Im Jahr darauf fanden im Januar und Februar rundum in allen Dörfern Kostümbälle statt, zu denen die Jugend begeistert strömte.
Hans, ihrem älteren Enkel, mittlerweile sechzehn Jahre alt, hätten die Großeltern zumindest erlaubt, an dem Ball in ihrem Wohnort teilzunehmen. Ihm lag aber nichts an dem Gehopse, wie er sich auszudrücken beliebte. Umso mehr fieberte Kaspar, der Jüngere, der Zeit entgegen, bis er endlich Tanzveranstaltungen besuchen durfte.
Am 18. November 1947 wurde er sechzehn. Daher durfte er im folgenden Februar zu seinem ersten Faschingsball am Ort. Das war sogar einer mit Maskierung und Kostümprämierung. Die Großeltern bestanden allerdings darauf, dass der ältere Bruder ihn begleite. Ihn hielten sie nämlich für den Vernünftigeren und Gewissenhafteren. Im Wirtshaus saß Hans dann still in einer Ecke und zuzelte an seinem Bier. Kaspar dagegen stürzte sich ins Gewühl. Nicht einen Tanz ließ er aus. Er liebte das bunte Treiben und fand es herrlich, immer wieder ein anderes Mädchen im Arm zu halten. Um Mitternacht spielte die Musik einen Tusch zur Demaskierung. Bei Kaspar gab es nicht viel zu demaskieren. Zu seiner normalen Kleidung, einem karierten Hemd und einer schwarzen Manchesterhose, hatte er nur ein rot-weiß kariertes Kopftuch schräg um den Kopf gebunden, das ihm die Oma großzügigerweise geliehen hatte. Der Opa hatte ihm eine schwarze Augenklappe zur Verfügung gestellt, die er einmal anlässlich einer Augenentzündung bekommen hatte. In dieser »Verkleidung« als Pirat kam sich Kaspar sehr verwegenen vor. Er war jedoch froh, als er endlich die lästige Augenklappe abnehmen und das Dirndl, das vor ihm stand, mit beiden Augen sehen konnte. Als sie ihre Hexenmaske und den grauen Haarschopf abnahm, kam zu seiner Freude ein bildhübsches Mädchen zum Vorschein. Es stellte sich als Rosina vor, und auch er nannte seinen Vornamen. Bis zum Kehraus tanzte er nur noch mit ihr.
Beim Maitanz sahen sie sich wieder. Und da sie sich auf dem »Oktoberfest« des Trachtenvereins ebenfalls wiedertrafen, beschlossen sie, »miteinander zu gehen«. Natürlich musste er sich mit ihr heimlich treffen, denn eine offizielle Liebschaft hätten die Großeltern nicht geduldet. Es kam wieder ein Februar und mit ihm ein erster Faschingsball. Mittlerweile waren die beiden so ineinander verliebt, dass eines glaubte, nicht ohne das andere leben zu können. Deshalb beschlossen sie, so bald wie möglich zu heiraten. Kaspar war aber noch Oberschüler der elften Klasse. Bis zum Abitur würde er noch zweieinhalb Jahre brauchen. Dann würde ein mehrjähriges Studium folgen, und erst danach wäre er in der Lage, seine Liebste zu ernähren. So lange wollte der ungeduldige junge Mann aber nicht warten. Ihm kam die Idee, ein Handwerk zu erlernen, dann sei er in drei Jahren fertig und verdiene genug, um eine Familie zu gründen. Eine Lehrstelle war schnell gefunden, nämlich bei einem Sattler und Polsterer. Nun war Kaspar der Ansicht, es genüge, wenn er sich von der Schule abmelde und als Lehrling bei dem Sattler beginne. Doch da tauchten Probleme auf, die der Jüngling nicht vorhergesehen hatte. Da er noch nicht volljährig war – das wurde man damals erst mit einundzwanzig –, verlangte man an der Schule und auch bei seinem künftigen Lehrherrn die Unterschrift seines Erziehungsberechtigten. Das war zu seinem Glück immer noch sein Vater. Die Großeltern hätten ihm diese Unterschriften nie und nimmer gegeben. Der Vater aber, der sich bisher äußerst wenig um seine Kinder gekümmert hatte, unterschrieb ohne lästiges Nachfragen.
Um die Zeit, als der jüngere Bruder seine Lehre begann, legte der ältere gerade die Abiturprüfungen ab. Wenige Wochen später hatte er den Abschluss in der Tasche und ging nach München, um Jura zu studieren.
Kaspar stellte sich in dem erwählten Handwerk sehr geschickt an, sodass sein Meister des Lobes voll war. In dieser Zeit machte sich der Enkel bei seinen Großeltern rar. Erstens war er viele Stunden des Tages beruflich eingespannt, zumal so manche Überstunde anfiel, und zweitens hatte er keine Lust, sich wieder und wieder die Vorwürfe anzuhören, weil er die Schule abgebrochen hatte. Wenn er am Abend erschöpft von der Arbeit kam, ging er gleich in die Wohnung der Tante, wo er mit ihr das Nachtessen einnahm. Sie war zwar auch nicht gerade erbaut darüber gewesen, dass der Neffe den vorgeplanten Lebensweg verlassen hatte, aber sie schmierte es ihm nicht jeden Tag aufs Butterbrot.
Die Sonntage verbrachte das verliebte Paar meist gemeinsam. Unter der Woche hatte Rosina ebenfalls keine Zeit, weil sie ihrem Vater den Haushalt führte.
Am 1. April 1951 legte Kaspar mit Bestnote seine Gesellenprüfung als Sattler und Polsterer ab und wurde von seinem Chef übernommen.
Anfang Juli gestand Rosina ihrem Verehrer zaghaft, sie sei schwanger. »Aber weshalb so verzagt, meine Liebe? Das ist doch kein Grund, Trübsal zu blasen«, reagierte er strahlend und nahm sie in die Arme. »Wir bekommen ein Kind! Na prima! Dann werden wir halt so bald wie möglich heiraten.«
Über diese Reaktion wunderte sich die Braut und war gleichzeitig erfreut. Der Jungmann nahm sich einen Vormittag Urlaub und marschierte mit seiner Liebsten zum Standesamt, um das Aufgebot zu bestellen. Gewissenhaft hatten beide ihre Personalausweise mitgebracht und legten sie dem Standesbeamten vor.
Nach einem kurzen Blick in Kaspars Ausweis erklärte er: »Du kannst nicht heiraten, du bist ja noch minderjährig.«
»Ich schon«, gab Kaspar zu. »Aber meine Braut ist volljährig. Soviel ich weiß, genügt es, wenn einer der beiden Brautleute erwachsen ist.«
»Junger Mann«, belehrte ihn der Beamte, »du verwechselst da etwas. Wenn der Bräutigam volljährig ist, das genügt, dann darf die Braut minderjährig sein. Nicht aber in umgekehrtem Falle.«
Noch gab sich der Heiratswillige nicht geschlagen. »Kann man da keine Ausnahme machen? Schauen Sie, meine Braut erwartet ein Kind, und ich möchte nicht, dass ihm später der Makel anhaftet, ein uneheliches Kind zu sein.«
»Das ist kein Problem. Wenn du das Kind nach seiner Geburt offiziell anerkennst, wird es später, wenn du die Kindsmutter heiratest, automatisch als ehelich gelten.«
Doch der junge Bräutigam bohrte weiter: »Gibt es wirklich keine Möglichkeit, dass ich jetzt schon heiraten darf?«
»Da gäbe es schon eine Möglichkeit«, zeigte der Mann hinter dem Schreibtisch Verständnis für seine Lage. »Du müsstest dich halt für volljährig erklären lassen.«
Kaspar horchte auf: »Und wie macht man das?«
»Dazu brauchst du die Unterschrift deines Erziehungsberechtigten, dass er mit der Volljährigkeitserklärung einverstanden ist.«
»Kein Problem«, gab sich der junge Mann optimistisch, eingedenk dessen, dass sein Vater keine Schwierigkeiten gemacht hatte, als es galt, das Abmeldeformular von der Schule und den Lehrvertrag zu unterschreiben.
Bald musste der zur Heirat Entschlossene aber einsehen, dass er die Situation zu blauäugig eingeschätzt hatte. Als er seinem Vater das Formular zur Unterschrift vorlegte, auf dem es um die Volljährigkeitserklärung ging, stutzte der Vater: »Hoppla, mein Sohn, so schnell geht das nicht. Da muss ich erst Rücksprache mit deiner Tante und deinen Großeltern halten. Um beurteilen zu können, ob du schon die nötige Reife besitzt, um die Verantwortung für eine Familie zu übernehmen, kenne ich dich einfach zu wenig.«
Dem Sohn lag schon auf der Zunge: Das ist doch nicht meine Schuld, dass du dich so wenig um mich gekümmert hast. Aber er schluckte diese Bemerkung hinunter, weil er den Vater nicht zusätzlich verärgern wollte.
»Außerdem«, fügte der Vater nach einigem Nachdenken hinzu, »müssen wir erst Erkundigungen über das Mädchen einziehen, damit wir wissen, wen du in unsere Familie einzuführen gedenkst.«
Dem heiratsfreudigen Paar wurde eine Menge Geduld abverlangt. Der »große Familienrat« tagte erst vierzehn Tage später. Diesem gehörten außer dem Vater und den Großeltern auch Tante Bärbel und Kaspars Bruder Hans an. Kaspar wurde in dem Raum nur als stummer »Angeklagter« geduldet, als über sein Schicksal entschieden wurde. Schon nach wenigen Sätzen erkannte er, dass es seinen lieben Angehörigen weniger darum ging, ob er schon ehemündig sei, als vielmehr darum, welche Qualitäten die Braut mitbringe. Sie sei nichts und sie habe nichts, war der Tenor der ganzen »Verhandlung«. Schließlich wurde das dem Bräutigam zu bunt. Er sah sich genötigt, etwas zur Ehrenrettung seiner Liebsten einzuwerfen: »Dass sie nichts hat, stimmt. Dass sie aber nichts ist, stimmt nicht ganz. Immerhin hat sie die Mittlere Reife, was auf eine gewisse Intelligenz schließen lässt. Nach ihrer Schulzeit hat sie sogar eine Lehre auf dem Landratsamt in Starnberg begonnen. Anderthalb Jahre später aber starb ihre Mutter, und sie musste ihre Ausbildung abbrechen, um ihrem Vater den Haushalt zu führen. Dadurch hat sie keine abgeschlossene Berufsausbildung und konnte auch kein Geld verdienen, um Ersparnisse zu machen. Meiner Meinung nach ist sie ein sehr wertvoller Mensch, und es ist ihr hoch anzurechnen, dass sie sich in selbstloser Weise um den Vater und die minderjährigen Geschwister gekümmert hat. Ich liebe sie also nicht wegen einer guten Position oder irgendwelcher materiellen Güter, sondern wegen ihrer inneren Werte. Sie ist ein liebenswürdiger warmherziger Mensch.«
Nun fiel die Tante über ihn her: »Was verstehst du schon von Liebe? In deinem Alter ist das ein Strohfeuer, das bald erlischt. Außerdem ist sie mit ihren dreiundzwanzig Jahren viel zu alt für dich.«
»Vielleicht liebe ich sie gerade deshalb. Weil sie älter ist als ich, gibt sie mir die Liebe und Wärme, die ich seit dem Tod meiner Mutter vermisst habe.«
»Gewiss, im Moment mag die ältere Frau für dich interessant sein«, räumte der Vater ein. »Aber lass erst mal ein paar Jahre ins Land gehen, dann wirst du dich nach einer jüngeren und attraktiveren umschauen, weil dir deine Frau zu alt und zu hausbacken ist.«
Da dem Sohn darauf keine passende Antwort einfiel, erklärte er, er wolle Rosina auch deshalb heiraten, weil er sich für sie und das Kind, das sie von ihm erwarte, verantwortlich fühle.
»Das ist doch kein Grund, zu heiraten, noch dazu in so jugendlichem Alter, wo man die Konsequenzen noch gar nicht abwägen kann«, tat der Großvater seine Lebensweisheit kund.
»Ja«, pflichtete ihm sein Schwiegersohn bei. »Versaue dir deine Zukunft nicht durch einen so übereilten Schritt. Wenn du dich auf dem Standesamt als Vater dieses Kindes eintragen lässt und pünktlich deine Alimente zahlst, zeigst du genügend Verantwortungsbewusstsein.«
»Und du bleibst ein freier Mann«, setzte sein Bruder noch eins drauf. »Bei deiner Intelligenz wäre es schade, wenn du als Sattler versauerst. Schlimm genug, dass du für dieses Weibsstück die Schule geschmissen hast. Aber es ist noch nicht zu spät. Über den zweiten Bildungsweg kannst du dir immer noch eine Zukunft aufbauen. Du kannst dein Abitur nachmachen und ein Studium aufnehmen.«
Obwohl ihn die Formulierung »Weibsstück« innerlich in Rage versetzte, erklärte der werdende Vater in ruhigem Ton, er fände es »gschert« (unehrenhaft), seine Freundin mit dem Kind sitzen zu lassen. Abgesehen davon wolle er mit ihr zusammenleben und sein Kind aufwachsen sehen.
Nun brachte die Großmutter noch einen neuen Aspekt ein: »Und wovon wollt ihr leben, da sie nichts hat und du nichts hast?«
»Inzwischen bin ich Geselle und habe eine feste Anstellung. Das, was ich dort verdiene, reicht für meine kleine Familie, zumal wir kostenlos im Haus von Rosinas Vater wohnen können. Diese Familie ist nicht so engstirnig wie ihr.«
So kühne Worte wagte er nur, weil er nichts mehr zu verlieren hatte. Dann ergänzte er noch: »In wenigen Jahren lege ich die Meisterprüfung ab, wodurch meine Einkünfte entsprechend steigen werden.«
Es half alles nichts. Da sein alter Herr ihm die benötigte Unterschrift verweigerte, blieb Kaspar nichts anderes übrig, als mit der Heirat zu warten, bis er einundzwanzig war.
Er blieb weiterhin bei der Tante wohnen und ging treu und brav seiner Arbeit nach.
Am 19. Februar des folgenden Jahres erblickte ich in Großvaters Haus das Licht der Welt unter Mithilfe einer tüchtigen Hebamme. Kaspar, mein Vater, freute sich riesig und überreichte meiner Mutter einen Strauß roter Rosen. Um diese Jahreszeit müssen die einen Haufen Geld gekostet haben.
Exakt neun Monate später wurde mein Vater einundzwanzig. Er nahm sich zwei Stunden frei, marschierte mit meiner Mutter siegesbewusst zum Standesamt und legte dem Beamten seinen Personalausweis vor.
»Was soll ich damit?«, fragte dieser irritiert. Mein Vater erklärte: »Wie Sie sehen, bin ich jetzt volljährig. Also steht einer Heirat nichts mehr im Wege.«
»Im Prinzip nicht. Sie und die Braut müssen mir aber noch Ihre Familienbücher vorlegen.«
Der Bräutigam schluckte: »Und wo nehmen wir die her?«
»Die müssten im Besitz Ihrer beider Eltern sein.«
Bei Rosina war das kein Problem, aber Kaspars Vater wollte das bewusste Buch nicht herausrücken. »Bub, sei vernünftig«, redete er ihm zu. »Ich meine es mit dir doch nur gut. Ich will verhindern, dass du in dein Unglück rennst.«
Alles Bitten, Betteln und Flehen half nichts. Der Vater blieb stur. Also wanderte Kaspar erneut zum Standesamt, um sich zu erkundigen, ob es denn keine andere Möglichkeit gebe, da sein Vater das Stammbuch partout nicht herausrücken wolle. Der Beamte empfahl ihm, sich von der Gemeinde, in der er geboren worden war, eine Geburtsurkunde geben zu lassen.
Bis er diese bekam, verging wieder einige Zeit. Mittlerweile war es kurz vor Weihnachten, und in der Polsterei gab es einiges zu tun. Viele Leute wollten bis zum Fest noch ihre durchgesessenen Sessel und Sofas aufgepolstert haben.
Am 3. Januar 1953 kamen meine Eltern endlich dazu, sich auf dem Standesamt trauen zu lassen. Anschließend erfolgte die kirchliche Trauung in ganz kleinem Rahmen. Mein Opa und der Chef meines Vaters fungierten in beiden Fällen als Trauzeuge. Noch am selben Tag zog mein Vater in Opas Haus ein. Dieser stellte dem jungen Paar die schönste und größte Kammer zur Verfügung, die er eigens mit neuen Schlafzimmermöbeln eingerichtet hatte. Außerdem gab es noch genug Platz für das Kinderbett.
Mama genoss es, endlich verheiratet zu sein. Als Ehefrau brauchte sie nicht mehr die hämischen Blicke der Nachbarn zu fürchten, wenn sie sich mit ihrem Kind, das den Makel »unehelich« getragen hatte, auf der Straße blicken ließ. Außerdem war sie glücklich, endlich mit dem Mann zusammenleben zu dürfen, den sie liebte.
Da meine Eltern in aller Stille und Heimlichkeit geheiratet hatten, war mein Vater sehr verwundert, als er einige Tage nach der Hochzeit von seinem Vater einen Brief erhielt, der ihn sehr erschütterte.
N.-Dorf, den 5. Januar 1953
Da Du Dich erdreistet hast, ohne meine Erlaubnis und trotz aller Warnungen vonseiten Deiner Verwandten, die es alle gut mit Dir meinten, eine Frau zu ehelichen, die nicht in unsere Familie passt, verstoßen wir Dich hiermit. Wir wollen Dich nie wieder bei uns sehen.
Es folgten die Unterschriften seines Vaters, seiner Großeltern, seiner Tante Bärbel und seines Bruders.
Mein Vater konnte sich zunächst nicht erklären, woher seine Verwandten Kenntnis von seiner Heirat erhalten hatten. Schließlich fand meine Mutter des Rätsels Lösung: »Deine Tante Bärbel arbeitet doch als Sekretärin beim Bürgermeister. Als solche geht sie täglich im Rathaus ein und aus. Dabei schaut sie gewiss immer wieder mal, wer im Kasten hängt.«
Wie es seinerzeit Vorschrift war, musste jedes Paar, das die Absicht hatte, die Ehe zu schließen, drei Wochen im »Kasten« des Standesamtes »hängen«. Damit sollte jedem in der Gemeinde die Möglichkeit gegeben werden, eine eventuell schon bestehende Ehe anzuzeigen, weil man Bigamie verhindern wollte.
Mit Sicherheit hat dieser Brief meinen Vater schwer getroffen. Seiner Frau gegenüber ließ er sich das aber nicht anmerken, wie sie mir verraten hat.
Von seinen Verwandten hörte mein Papa nur noch einziges Mal etwas in seinem Leben. Das war Anfang Juli 1953, also nur sechs Monate nach seiner Heirat, als seine Großeltern ihre Goldene Hochzeit feierten. In schriftlicher Form lud ihn seine Tante Bärbel ausdrücklich zu diesem Fest ein, mit dem Hinweis, durch seinen Besuch würde er seinen Großeltern eine große Freude machen. Seine Frau und sein Kind waren aber nicht miteingeladen, deshalb verzichtete Papa auf die Teilnahme.
Mamas Freude darüber, mit dem geliebten Mann zusammenzuleben, sollte nur von kurzer Dauer sein. Denn schon bald stellte sich heraus, dass sein Lohn als Sattlergeselle doch zu gering war, um seine Familie davon ordentlich unterhalten zu können. In dieser Situation kam ihm ein Zufall zu Hilfe. Ein Freund von ihm vermittelte ihn nach Ulm zu einer Firma als Getränkefahrer. Die Firma stellte ihm ein Zimmer zur Verfügung, was ihm auf den Lohn angerechnet wurde. Dennoch brachte er doppelt so viel nach Hause wie zuvor. Dafür mussten die jungen Leute in Kauf nehmen, dass er nur an den Wochenenden heimkam. Dazu benutzte er einen VW-Käfer, den er gebraucht erstanden hatte. Als er merkte, dass die Fahrten ganz schön ins Geld gingen, fuhr er nur noch alle zwei bis drei Wochen nach Hause. Da wir kein Telefon hatten, wusste die Mama also nie genau, wann er kommen würde.
Am 27. Juli 1954, es war ein Samstag, nachdem mein Vater zwei Wochen nicht zu Hause gewesen war, hörte die Mama gegen 20 Uhr ein Auto in den Hof einfahren. Komisch, dachte sie, das hört sich nicht wie ein VW an. Kriegen wir etwa Besuch? Sie trat vor die Haustür und erblickte ein grünes Polizeiauto, aus dem gerade zwei Uniformierte stiegen. Vor Schreck ließ sie sich auf die Hausbank nieder.
»Sind Sie Frau Poldinger?«, fragte der Jüngere. Kraftlos nickte sie.
»Wir haben keine gute Nachricht für Sie«, erklärte der Ältere.
»Das hab ich mir schon gedacht, als ich Ihr Auto sah. Ist etwas mit meinem Mann?«
»Leider ja. Er hatte einen Autounfall«, erklärte der Erste zögerlich.
»Ist er schwer verletzt?«, fragte Rosina mit ängstlichem Blick.
»Bedauerlicherweise ist Ihr Mann noch an der Unfallstelle verstorben.«
Die Polizisten, die gewiss schon öfter solche Schreckensnachrichten überbracht hatten, wunderten sich, dass die junge Witwe nicht hysterisch in Weinen und Wehklagen ausbrach. Deshalb wagten sie es, ihr zu erklären, wie es vermutlich zu dem Unfall gekommen war. Bei der Heimfahrt muss er auf der Autobahn wegen Übermüdung kurz eingenickt sein. Jedenfalls geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stürzte eine Böschung hinunter. Ein hinter ihm fahrender Verkehrsteilnehmer hatte das beobachtet und von der nächsten Notrufsäule aus die Polizei alarmiert. Diese hatte vorsorglich einen Krankenwagen angefordert. Doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.
Nachdem meine Mutter den ersten Schock überwunden hatte, war es für sie selbstverständlich, die nächsten Verwandten ihres Mannes zu verständigen. Sie erschienen auch alle am Grab, sein Vater, seine Großeltern, Tante Bärbel und Bruder Hans. Sie spielten die erschütterten Angehörigen, obwohl sie ihn ein Jahr zuvor verstoßen hatten. Seine Witwe würdigten sie keines Blickes. Sie gingen auch nicht mit zum anschließenden Mahl. Ein paar Wochen später tauchte Bärbel aber bei meiner Mutter auf und erbot sich, für den Grabstein aufzukommen. Dieses Angebot nahm die Mama gerne an, denn sie hätte nicht gewusst, woher sie das Geld für einen Stein nehmen sollte.
Das war alles, was ich von meiner Mutter über diese Seite der Verwandtschaft erfahren konnte. Allerdings zu Ostern im Jahr darauf knatterte der Gemeindediener mit seinem Moped in unseren Hof. Er hatte ein Osternestchen dabei, in dem sich echte Eier und ein Schokoladenhase befanden, außerdem noch ein Fünf-Mark-Stück. Dieses überreichte er mir im Auftrag der Tante. Verständlicherweise kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ich war ja kurz zuvor erst drei geworden. Mit schöner Regelmäßigkeit überbrachte der Gemeindediener mir in den folgenden Jahren zu Ostern ein Nest. Daran erinnere ich mich noch gut. Die Eier und den Osterhasen verspeiste ich, und das Geld, das ich gerne für Naschwerk ausgegeben hätte, ließ meine Mutter in mein Sparschwein wandern. »Irgendwann wirst du froh sein, wenn du auf dieses Geld zurückgreifen kannst«, war ihre Erklärung.
Nach nur anderthalb Ehejahren stand meine Mutter schon als Witwe da, mit einem zweijährigen Kind. Da der Vater nur wenige Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hatte, fiel ihre Rente äußerst bescheiden aus. Selbst die zusätzliche kleine Halbwaisenrente für mich und das Kindergeld reichten hinten und vorne nicht zum Leben. Deshalb war sie froh, weiterhin ihrem Vater den Haushalt führen zu können. Dafür unterstützte er sie von seiner Kriegsversehrtenrente. Wenn sie ihm dafür danken wollte, wehrte er ab: »Du brauchst mir nicht zu danken. Da du mir nach dem Tod meiner Frau den Haushalt geführt hast, ist es das Mindeste, dass ich jetzt für dich und dein Kind sorge.«