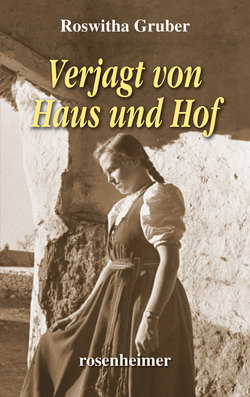Читать книгу Verjagt von Haus und Hof - Roswitha Gruber - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMein Opa Korbinian
Für mich war es erfreulich, dass meine Mutter versucht hat, eine mentale Beziehung zwischen mir und meinem Vater herzustellen, aber ich vermisste ihn nicht wirklich. Mein Opa Korbinian, ihr Vater, war für mich ein voller Vaterersatz. Meine Kindheit verbrachte ich in seinem schönen großen Haus, das am Ortsrand eines kleinen Dorfes lag, unweit des Starnberger Sees. Außer ihm und meiner Mutter wohnten hier auch noch meine Tante Klara und mein Onkel Ludwig.
Meine weitest zurückliegende Erinnerung stammt aus der Zeit, als ich etwas über drei Jahre alt war. Meine Mutter nahm mich an die Hand und spazierte mit mir zum Kindergarten, der nur wenige Minuten von unserem Haus entfernt lag, um mich anzumelden. Noch habe ich die Stimme von Schwester Gertrudis im Ohr: »Lassen Sie Lisi erst mal probeweise da. Wenn es ihr bei uns gefällt, ist es noch früh genug, sie anzumelden.«
Mit großen Augen bestaunte ich alles, was ich sah: die vielen Kinder, die vielen Spielsachen, die kleinen Stühle, die kleinen Tische. Die beiden Ordensschwestern waren wirklich sehr nett, aber sie konnten mir den Opa nicht ersetzen. Auch das lange Stillsitzen behagte mir nicht. Unruhig rutschte ich auf meinem Stühlchen hin und her. Deshalb stand bei mir schon nach kurzer Zeit fest: Hierher gehe ich nicht mehr!
Diesen Entschluss teilte ich meiner Mutter brühwarm mit, als sie mich am Nachmittag wieder abholte. »Du brauchst mich gar nicht anzumelden. Ich will lieber beim Opa bleiben.«
Die Mutter akzeptierte meinen Wunsch erstaunlicherweise ohne jegliche Diskussion. Etwa ein Jahr später, als ich mal nach Kindergartenschluss mit ihr dort vorbeikam, war eine der Schwestern gerade dabei, Förmchen und Schüppchen aus dem Sandkasten zu sammeln. »Na, kleines Fräulein«, sprach sie mich freundlich an. »Hast du nicht Lust, zu uns zu kommen?«
»Ja«, antwortete ich, sehr zum Erstaunen meiner Mutter. Noch mehr staunte sie, als ich erklärte: »Ich komme aber erst, wenn der Kindergarten aus ist. Dann helfe ich beim Aufräumen.« Das tat ich tatsächlich immer wieder, bis ich in die Schule kam.
Der Opa war viele Jahre lang der wichtigste Mensch in meinem Leben. Er rangierte sogar vor meiner Mama. Wo er ging und stand, lief ich ihm nach.
Das Haus stand auf einem weitläufigen Grundstück, das mit Maschendraht eingezäunt war, damit Opas Federvieh nicht entweichen konnte. Opa hielt sich nämlich immer einige Hühner, Gänse und Enten. Einen Teil des Grundstücks nutzte meine Mutter als Gemüsegarten. Darin standen auch mehrere Johannisbeer-, Stachelbeer- und Himbeersträucher, die ich sehr zu schätzen wusste. Damit das Federvieh keinen Schaden im Nutzgarten anrichten konnte, hatte Opa diesen mit einem Lattenzaun umgeben. Auf einem weiteren Teil des Grundstücks befand sich der Obstgarten mit einem Zwetschgenbaum, einem Walnussbaum und verschiedenen Apfelbäumen. Etwas abseits vom Wohnhaus hatte der Opa für sein Geflügel ein eigenes Häuschen errichtet.
Bei jedem Besuch auf seinem Geflügelhof folgte ich ihm wie ein Schatten. Ich schaute zu, wie er den Napf mit Wasser füllte, und konnte das bald schon selbst tun. Ich half ihm, Körner ausstreuen, ich sah zu, wie er die Ställe ausmistete. Am meisten aber beeindruckte es mich, wenn er die Eier aus dem Nest sammelte und behutsam in seinen Henkelkorb legte.
Eines Tages nun, als der Opa sein Mittagsschläfchen hielt, ich muss bereits fünf gewesen sein, schlich ich allein in den Hühnerstall mit dem Eierkorb am Arm. In der löblichen Absicht, dem Opa Arbeit abzunehmen, wollte ich die Eier aus dem Nest sammeln. Ich musste mich schon arg recken und auf die Zehenspitzen stellen, um überhaupt in das Nest hineinschauen zu können. Zu meiner großen Enttäuschung fand ich nur ein einziges Ei darin vor. Vorsichtig, wie ich das beim Opa beobachtet hatte, bettete ich es in meinen Korb. Diesen trug ich in die Speisekammer und legte das einsame Ei zu den anderen, die sich auf einer Stellage aus Pappmaché befanden.
Gegen siebzehn Uhr nahm der Opa seinen Korb und begab sich in den Hühnerstall. Wie immer folgte ich ihm auf dem Fuß. »Nanu!«, rief er erstaunt aus. »Kein einziges Ei im Nest. Noch nicht mal das Nestei. So was gibt’s doch nicht!«
»Was meinst du mit Nestei?«, erkundigte ich mich vorsichtig.
»Ja, das Gipsei, das immer im Nest liegen muss.«
»Das habe ich genommen«, gestand ich kleinlaut.
»Ja, bist du narrisch wor’n?«, fauchte mich der sonst so gütige Opa an. »Du kannst doch nicht einfach das Nestei wegnehmen! Wo hast du es denn hingetan?«
»In die Speis hab ich’s gelegt, zu den anderen Eiern, weil ich dachte, es wäre ein echtes Ei.«
Schnell hatte der Großvater es unter den anderen Eiern gefunden und zurück ins Nest gelegt. Als er sich wieder beruhigt hatte, wollte ich wissen: »Warum muss denn das Gipsei im Nest liegen?«
»Damit die Hühner wissen, wohin sie ihre Eier legen sollen.«
»Wissen die das sonst nicht?«
»Nein, Hühner haben ein sehr kurzes Gedächtnis«, klärte der Opa mich auf. »Wenn ein Huhn das Gipsei sieht, denkt es: ›Aha, das hab ich gestern gelegt‹, und legt noch eins dazu. Und die anderen Hühner legen das ihre auch dazu. Wenn aber das erste Huhn das leere Nest sieht, denkt es, sein Ei vom Vortag sei gestohlen worden, und versteckt das neue irgendwo. Und die anderen Hühner machen das genauso. Nun müssen wir uns also auf die Suche begeben und schauen, wo sie die Eier versteckt haben.«
Bei der Eiersuche war der Opa nicht gerade fröhlich, mir aber machte es Spaß. Wir entdeckten tatsächlich drei Eier an drei unterschiedlichen Plätzen. Da mein Großvater zu der Zeit fünf Hühner hatte, war er nicht sicher, ob er alle Eier gefunden hatte. So lernte ich gleich noch eine Lektion über Hühnerhaltung: »Ein Huhn legt nicht jeden Tag ein Ei, es lässt immer mal einen Tag aus. Daher liegen an manchen Tagen vier Eier, an anderen Tagen nur drei Eier im Nest. Deshalb weiß ich nicht, ob noch ein Ei fehlt.«
Von diesem Tag an war das Nestei für mich tabu, überhaupt versuchte ich erst gar nicht mehr, die Eier aus dem Nest zu nehmen. Und die Hühner legten wieder treu und brav ihre Eier dahin, wo sie hin sollten. Doch ich suchte noch einige Tage weiter nach dem eventuell fehlenden Ei, fand aber nichts.
Es muss im Oktober desselben Jahres gewesen sein, als ich wieder einmal mit meiner Mutter ins Dorf zum Einkaufen ging. Ich begleitete sie gerne zum Kramladen, denn es fiel immer etwas für mich ab. Meist war es eine kleine Spitztüte mit einigen Guatln (Bonbons) darin, manchmal war es auch ein Lutscher. Diesmal begegnete uns auf dem Heimweg ein kleines Mädchen, das stolz einen Puppenwagen vor sich herschob, einen Korbwagen! Davon war ich so entzückt, dass ich sofort bettelte: »Mama, so einen will ich auch haben.«
»Da musst dir halt einen beim Christkind bestellen«, lautete ihr Rat.
»Und wie macht man das? Ich weiß ja gar nicht, wo das Christkind wohnt.«
»Schreibst ihm halt einen Wunschzettel.«
»Aber Mama, wie denn? Ich kann doch noch gar nicht schreiben.«
»Dann malst halt einen Puppenwagen auf den Zettel und legst ihn am Abend außen auf die Küchenfensterbank. Dort holt ihn sich das Christkind schon ab.«
Den Rat meiner Mutter befolgend, malte ich mit ungelenken Fingern das Objekt meiner Begierde auf ein Blatt. Es sah einem Puppenwagen wirklich etwas ähnlich. Diesen Zettel legte ich auf die Fensterbank und beschwerte ihn mit einem Stein, damit der Wind ihn nicht wegblasen konnte. Am nächsten Morgen war er tatsächlich verschwunden. Vor Aufregung klopfte mein Herz wie toll. Dann aber zog es sich hin, bis endlich Weihnachten war. Im Advent durfte ich am Adventskalender jeden Morgen ein Türchen aufmachen. Da kam aber nichts Süßes zum Vorschein, wie das heutzutage ist, sondern nur ein buntes Bildchen. Ich hatte trotzdem meine Freude daran, vor allem aber sah ich, dass ich dem großen Tag, an dem mein Herzenswunsch in Erfüllung gehen sollte, immer näher kam.
Endlich war es so weit. Mit dem Opa wartete ich im Esszimmer geduldig, bis das feine Läuten eines Glöckchens ertönte. Wie elektrisiert sprang ich auf und wollte gleich ins Wohnzimmer stürmen. Doch Opa kriegte mich gerade noch an der Tür des Esszimmers zu fassen. »Langsam, langsam, Dirndl, ins Weihnachtszimmer muss man gesittet gehen. Da darf man nicht einfach hineinstürzen.«
Als wir »gesittet« auf den Gang hinaustraten, kamen aus der Küche gerade die Mutter, die Tante und der Onkel. »Habt ihr auch das Glöckerl gehört?«, fragte ich aufgeregt.
»Freilich haben wir es gehört«, antwortete die Mama. »Drum haben wir alles liegen und stehen lassen, um nachzuschauen, was das Christkindl gebracht hat.«
Die Tür ging auf. Den strahlenden Lichterbaum erfasste ich mit dem ersten Blick und gleichzeitig erkannte ich, dass kein Puppenwagen darunter stand. Stattdessen sah ich eine kleine Holzkiste, in die meine Puppen gebettet waren. Sie hatten alle darin Platz, weil es kleine Puppen waren. Während ich auf die Kiste zusteuerte, schaute ich suchend nach allen Seiten. »Wo … wo … ist mein Puppenwagerl?«, stotterte ich, und Tränen kullerten über meine Wangen. Die Erwachsenen sahen sich fragend an. Schließlich bewegte sich meine Mutter beherzt auf die Kiste zu, fischte einen Zettel daraus und las:
Liebe Lisi,
sei nicht traurig, dass dein Puppenwagen noch nicht gekommen ist. Aber so viele kleine Mädchen haben sich zu Weihnachten einen gewünscht, dass die Englein in der Himmelswerkstatt nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Nach Weihnachten arbeiten sie fleißig weiter. Sobald dein Korbwagen fertig ist, wirst du ihn bekommen.
Liebe Grüße vom Christkind
Nachdem ich diese Botschaft vernommen hatte, zog ich mein Schneiztiachl (Taschentuch) hervor und trocknete meine Tränen. Diesen »echten Brief« vom Christkind, obwohl ich ihn nicht lesen konnte, hob ich mir lange auf als ein kostbares Gut. Bis der versprochene Wagen kam, spielte ich mit der Kiste, legte meine Puppen hinein und nahm sie wieder heraus. Einige Tage nach dem Christfest, der Baum stand noch, fand ich ein großes Paket darunter. Mit glühenden Wangen und vor Aufregung zitternden Händen packte ich es aus. Tatsächlich, der ersehnte Korbwagen kam zum Vorschein. Ohne dass es mir einer erklären musste, war mir klar, dass das Christkind mein verspätetes Geschenk mit der Post geschickt hatte, weil es sich ja nach den Feiertagen nicht mehr auf den Weg zur Erde machte. Wie war ich selig! Sogleich steckte ich meine ganze Puppensammlung ins Wagerl und schob es im Erdgeschoss munter durch alle Räume. Nach draußen durfte ich damit nicht. Es lag ja Schnee, darin wären die Räder stecken geblieben. Außerdem hätte mein geliebtes Wagerl dadurch Schaden nehmen können.
Sobald die Märzensonne aber den letzten Schnee von unseren Gartenwegen weggeleckt hatte, war ich draußen. Ich fuhr alle Wege auf und ab, bis ich erschöpft ins Haus zurückkehrte, denn es war noch zu kalt, um auf der Gartenbank Rast zu machen. Ab Mitte April aber, als die Sonne schon warm genug schien, konnte ich mich immer wieder mal auf der Bank vorm Haus ausruhen. Ich nahm meine kleinen Lieblinge aus ihrem Gefährt und legte sie auf die Bank, damit sie ein Sonnenbad nehmen konnten. Manchmal wechselte ich dort auch ihre Kleider, ehe ich sie zurück ins Wagerl bettete und erneut mit ihm auf den Wegen herumdüste. Einmal, meine Puppen lagen mal wieder auf der Bank zum Sonnenbaden, entdeckte Miezi, unsere Katze, den leeren Wagen, sprang hinein und wühlte sich unter der Decke ein. Das gefiel mir. Sofort waren meine Puppenkinder vergessen. Sie ihrem Schicksal überlassend, schob ich die Miezi durch den Garten. Das war doch etwas ganz anderes! Sie bewegte sich ab und zu, sie reckte und streckte sich, während die blöden Puppen nur starr und dumm im Wagen herumgelegen hatten. Von dem Tag an fuhr ich nur noch unsere Katze spazieren, aber immer erst, wenn sie freiwillig in den Wagen geklettert war. Ich habe sie nie hineingesetzt. Auch hielt ich immer rechtzeitig an, damit sie aussteigen konnte, wenn sie den Eindruck machte, dass sie genug vom Herumfahren hatte.
Mittlerweile war es Hochsommer geworden, und ich war schon fünfeinhalb, deshalb durfte ich das eingezäunte Grundstück verlassen und meinen Puppenwagen auf dem öffentlichen Weg schieben, der zu unserem Haus führte. Dieser Weg wurde nur von wenigen Menschen genutzt, weil es eine Sackgasse war, die an unserem Gartentor endete. Eines Tages, als ich dort wieder mal quietschvergnügt unsere Katze im Wagen schob, begegnete mir eine Spaziergängerin. »Na, fährst dein Pupperl aus?«, sprach sie mich leutselig an. Dabei warf sie einen Blick in mein Wagerl, um sich meine Puppe anzuschauen. Dann fauchte sie mich an: »Ja, Kind! Bist du narrisch? Das darfst doch net machen! Das ist ja Tierquälerei.«
Diese Aussage traf mich bis ins Mark. Nein, ein Tierquäler wollte ich nicht sein. Dafür hatte ich Tiere viel zu gern. Sofort kehrte ich um, ohne der Fremden zu erklären, dass die Katze immer freiwillig in den Wagen sprang. An der Hausbank ließ ich die Miezi aussteigen, verbannte den Puppenwagen in die Schlafkammer und rührte ihn für lange Zeit nicht mehr an.
In meiner Kindheit gab es bei uns im Haus noch keine Toilette. Stattdessen stand neben dem Hühnerstall ein Plumpsklo. In dem kleinen Häuschen befand sich ein Brett mit einem Loch. Das war ziemlich groß, und ich musste höllisch aufpassen, dass ich nicht in die Grube fiel, wenn ich mein Geschäft verrichtete. War die Grube voll, musste Opa sie leeren. Dazu benutzte er ein eimerartiges Gefäß, bei dem an einer Seite ein langer Stiel angebracht war. Damit schöpfte er den stinkenden Inhalt der Grube in eine Blechschubkarre. Sobald diese voll war, schob er sie in den Obstgarten und kippte sie aus. Anfangs rümpfte ich die Nase über sein Tun. Opa aber erklärte mir, dass wir nur deshalb so saftiges Obst und so dicke Nüsse hatten, weil er diesen Naturdünger in den Obstgarten ausbrachte.
Eines Morgens im April, als ich an den Frühstückstisch kam, herrschte große Aufregung: Opas Zähne waren verschwunden. Obwohl man das ganze Haus absuchte, blieben sie unauffindbar. »Du warst doch in der Nacht mal raus«, erinnerte ihn meine Mutter.
»Das stimmt«, sinnierte er. »Irgendwie muss das Nachtessen verdorben gewesen sein. Mir war nämlich sauschlecht.«
»Jetzt soll’s am Essen gelegen haben«, lachte die Mama. »Nein, das Essen war in Ordnung. Uns anderen ist ja auch nicht schlecht geworden. Dein Fehler war halt, dass du gestern Abend zu tief ins Glas geschaut hast.«
Wieso wird einem davon schlecht, wenn man zu tief ins Glas schaut?, dachte ich, sagte aber nichts. Doch ich nahm mir vor, in Zukunft niemals tief in Gläser zu schauen.
»Ja, mei«, dämmerte es dem Großvater nun. »Weil mir so schlecht war, hab ich ins Klo gspiebn (erbrochen). Dabei sind meine Zähne wohl mit in der Grube gelandet.«
Über dieses Missgeschick musste ich laut lachen. Das war doch wirklich lustig, dass so etwas hatte passieren können. Doch sogleich wurde ich wieder ernst, und nicht nur, weil ich Opas trauriges Gesicht sah. Mit Daumen und Zeigefinger prüfte ich, ob meine Zähne fest genug saßen.
Um wieder an sein Gebiss zu kommen, begann der Opa gleich nach dem Frühstück damit, die Grube in gewohnter Manier auszuschöpfen. Als er den ersten Eimer aus der Tiefe hochgezogen hatte, rührte er mit einem Stock drin herum, bevor er ihn in die Schubkarre ausleerte. Um sicherzugehen, stocherte er mit seinem Stock auch noch in der Schubkarre herum. Ohne Ergebnis! Sobald er die Brühe in den Obstgarten gekippt hatte, suchte er zusätzlich den Boden ab. Nichts! So arbeitete er sich Eimer für Eimer durch.
Anfangs stand ich untätig dabei und beobachtete staunend Opas Tun. Je länger sich seine »schöpferische« Tätigkeit aber hinzog, desto mehr litt ich mit ihm. Deshalb half ich ihm nach einiger Zeit dabei, im Gras unter den Obstbäumen zu suchen. Zwei Tage lang schöpfte er unermüdlich die übelriechende braune Brühe aus der Grube. Der Obstgarten war nachher bestens gedüngt, nur sein Gebiss hatte Großvater nicht gefunden. Vermutlich hatte es sich in einer Ecke der Grube versteckt, so mutmaßte der Opa, in die man mit dem runden Eimer nicht hinkam. Noch oft wurde diese Geschichte in geselliger Runde zum Besten gegeben. Dem Opa war das zwar immer furchtbar peinlich, die Gäste aber lachten sich kaputt.
Da der Opa ohne Zähne nur noch Brei essen konnte, entschloss er sich nach einiger Zeit, einen Zahnarzt aufzusuchen, um sich ein neues Gebiss anfertigen zu lassen. Dort musste er immer wieder hingehen, bis der Zahnarzt es so zurechtgefeilt hatte, dass es wirklich schmerzfrei saß.
Immer wenn der Opa seinen wohlverdienten Mittagsschlaf hielt, spielte ich bei schönem Wetter allein im Garten, entweder in dem großen Sandkasten, den er für mich angelegt hatte, oder ich zog auf der Hausbank meine Puppen an und aus. Bis ich fünf Lenze zählte, hatte ich schon eine ansehnliche Sammlung beisammen. Denn jedes Jahr zu Weihnachten schickte mir meine Patin, die in Nürnberg lebte, eine weitere Puppe, und meine Mama fertigte hin und wieder neue Kleider für sie an.
In einer Ecke des Grundstücks befand sich ein kleiner Teich. Den hatte der Opa aber nicht für mich angelegt, sondern für seine Schwimmvögel. Sie tummelten sich wirklich begeistert darin, paddelten aber ebenso gerne in dem kleinen Bach, der auf einer Seite das Grundstück begrenzte. Die Böschung, die zum Bach hinunterführte, war ziemlich steil, nur an einer Stelle ging es sanfter hinab. Diese Stelle hatte Opa so abgegraben, dass meine Mutter ohne Mühe mit ihrem Waschkorb hinuntergehen konnte, um die Wäsche zu schwenken. Denn eine Waschmaschine besaß sie damals noch nicht. Damit sie es bei ihrer Arbeit leichter habe, hatte Opa eine Art halben Holzkasten gezimmert und am Bachufer angebracht. In diesem konnte sie beim Wäscheschwenken bequem knien.
Nicht weit davon entfernt führte ein schmaler Steg über den Bach, der an einer Seite ein Geländer hatte. Auch diesen hatte Opa eigenhändig gezimmert, obwohl er kein gelernter Schreiner war, aber er konnte einfach alles. Das hölzerne Brücklein hatte ich zwar schon oft gesehen, aber ich war nie auf die Idee gekommen, es zu betreten, geschweige denn hinüberzuwandern. Eines schönen Sommertages, ich saß auf der Gartenbank, sah ich, wie ein Mädchen, das in meinem Alter sein mochte, über diesen Steg getrippelt kam.
»Ich bin die Nanni«, stellte sie sich vor. Deshalb nannte auch ich meinen Namen: »Ich bin die Lisi. Eigentlich heiße ich Elisabeth, doch alle sagen Lisi zu mir.«
Darauf erklärte das fremde Mädchen: »Ja, weißt, eigentlich heiße ich Marianne. Aber alle rufen mich Nanni.« Dies war der Beginn einer intensiven Freundschaft, die viele Jahre halten sollte. Nachdem wir eine Weile mit meinen Puppen gespielt hatten, verabschiedete sich Nanni: »Jetzt muss ich aber heim, sonst schimpft die Mama. Kommst du mich auch mal besuchen?«
»Freilich. Wo wohnst du denn?«
Sie fasste mich bei der Hand und zog mich bis zum Steg mit. Mit der freien Hand deutete sie hinüber auf die andere Seite, wo sich, so weit ich sehen konnte, Wiesen ausbreiteten. »Siehst du den Bauernhof da hinten? Da wohne ich.«
Ihre Einladung brauchte sie nicht zu wiederholen. Am folgenden Tag schon wanderte ich auf die andere Seite. Natürlich hatte ich vorher meine Mama um Erlaubnis gefragt. Sie wollte immer wissen, wo ich war, damit sie sich keine Sorgen machen musste. Das Wasser des Baches war ziemlich tief, und sie hatte mich streng ermahnt, niemals an den Bach zu gehen. Als ich bei Nanni eintraf, kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was ich da alles zu sehen bekam! Zunächst führte sie mich durch den Stadl, den Geräteschuppen und durch die Ställe. Ich kam mir vor wie im Paradies. Der Opa hatte mir nämlich erzählt, dass im Paradies viele Tiere lebten. Hier gab es Tiere, wohin man schaute: Pferde mit Fohlen, Kühe mit Kälbchen, große Schweine mit Ferkeln, Ziegen mit Zicklein, Enten, Gänse und Hühner mit Küken. Natürlich gab es auch Katzen und sogar einen Hund.
Erschlagen von so vielen neuen Eindrücken, kam ich nach Hause und stürmte gleich auf meinen Großvater zu: »Warum haben wir keine Pferde, keine Kühe und keine Schweine?«
»Weil wir keinen Bauernhof haben.«
»Warum haben wir keinen Bauernhof?«
»Weil ich kein Bauer bin.«
»Warum bist du kein Bauer?«
»Weil ich Postbote bin.«
»Du hast aber doch Hühner, Gänse und Enten.«
»Das sind Kleintiere. Die machen noch keinen Bauern aus. Für die brauche ich nur einen kleinen Stall.«
Doch ich ließ nicht locker: »Du könntest doch einen großen Stall bauen. Hinter dem Haus ist Platz genug.«
Er erklärte: »Für einen Stall würde der Platz reichen. Aber uns fehlen die Wiesen und Felder, auf denen Futter für die Tiere wachsen kann.«
Das leuchtete mir ein. Meine kleine Freundin hatte mir nämlich voller Stolz mit einer weit ausladenden Handbewegung gezeigt: »Alle Felder und Wiesen, die du sehen kannst, gehören uns.«
Da mir die enttäuschende Erkenntnis kam, dass wir nie einen Bauernhof haben würden, huschte ich so oft wie möglich über den Steg zu Nanni. Staunend schaute ich zu, wie ihre Mutter aus den Kühen Milch »zapfte« und wie sie die Kälbchen mit der Flasche fütterte. Mächtig stolz war ich, als ich auch mal die Flasche halten durfte. Wenn sie den Schweinen einen Eimer Futter in den Trog kippte, machte es mir Spaß, zu sehen und zu hören, wie diese in verschiedenen Tonarten grunzten und schmatzten. Das Schönste aber war, wenn die Sau ausgestreckt in ihrem Koben lag und die winzigen Marzipanferkelchen an ihr saugten. Wenn es im Stall nichts zu sehen gab, tollten wir mit dem Hofhund Bello auf dem weiten Gelände herum. Er liebte es besonders, wenn wir Stöckchen warfen. Nun stand bei mir fest, dass ich auch einen Hund haben wollte. Sogleich umschmeichelte ich meinen Großvater, dass er einen Hund anschaffen sollte. Um es ihm schmackhaft zu machen, erklärte ich ihm: »Für den brauchst du nur eine kleine Hütte, du brauchst keine Wiesen und keine Äcker, der frisst kein Heu und keine Rüben. Der begnügt sich mit Knochen und Fleischabfällen aus der Küche. Und vom Metzger bekommt man solche Abfälle sogar kostenlos.«
Opa kratzte sich am Kopf und strich ein paar Mal über seinen Bart hinab, ehe er zu einer Rede ansetzte: »Das hast du dir ja recht gut überlegt, Dirndl. Ein Hund für uns wäre gar nicht so verkehrt. Schreibst dem Christkind halt deinen Wunsch auf.«
Vom vergangenen Jahr her wusste ich noch gut, wie man das macht. Auf meinen Zettel, den ich mir von der Mama erbeten hatte, malte ich etwas Vierbeiniges, das man mit gutem Willen für einen Hund halten konnte. Zur Sicherheit legte ich mein »Gemälde« aber noch meiner Mutter vor: »Meinst, das Christkind kann erkennen, dass ich mir einen Hund wünsche?«
»Freilich wird es das erkennen. Du weißt ja, wo du den Zettel hinlegen musst.«
In der Adventszeit durfte ich am Kalender wieder jeden Tag ein Türl öffnen und fieberte dem Weihnachtsfest entgegen. Unsicher fragte ich häufig bei den gemeinsamen Mahlzeiten, ob das Christkind wohl meinen Herzenswunsch erfüllen werde. Genervt von meiner ewigen Fragerei antwortete mein Onkel, zu der Zeit neunzehn Jahre alt: »Ja, Dirndl, woher sollen wir das wissen? Aber mir hat heut Nacht geträumt, dass du Weihnachten etwas bekommst, das Töne von sich gibt.«
»Juhu!«, jubelte ich in kindlicher Begeisterung. »Das bedeutet, ich kriege den Hund.«
Wie groß war meine Enttäuschung aber, als ich das Weihnachtszimmer betrat. Kein Hund sprang mir fröhlich entgegen. Am Tisch lehnte stattdessen ein Kinderfahrrad, ein funkelnagelneues. So manches Kind hätte bei seinem Anblick einen Luftsprung gemacht. Ich aber nicht. Ich war so fixiert auf den Hund gewesen, dass ich das Radl keines weiteren Blickes würdigte. »Warum hat mir das Christkind keinen Hund gebracht?«, fragte ich enttäuscht in die Runde.
»Vielleicht war dein Hund so schlecht gemalt, dass das Christkind ihn für ein Fahrrad gehalten hat«, spottete der Onkel.
Verbittert warf ich ihm vor: »Was hast denn du für einen Schmarrn geträumt?«
»Es stimmt doch, was ich dir erzählt habe«, verteidigte er sich. »Von einem Hund war nie die Rede. Ich habe nur behauptet, du kriegst etwas, das Töne von sich gibt. Hier, schau doch«, dabei betätigte er die Klingel. »Sind das Töne, oder nicht?«
Gewiss, ich musste ihm recht geben. Dennoch blieb meine Enttäuschung tagelang bestehen. Um mich abzulenken, beschäftigte ich mich mit meinen Puppenkindern. Von meiner Patin aus Nürnberg war wieder die obligatorische Puppe angekommen, und für jede Puppe hatte ein neues Kleid auf dem Gabentisch gelegen.
Erst im Frühjahr, als die Wege wieder schnee- und eisfrei waren, wusste ich mein Radl zu schätzen. Denn auch Freundin Nanni hatte ein neues Rad bekommen und es vorsichtig über den hölzernen Steg geschoben. Dann gab es noch einen Dritten im Bunde, den Dieter. Er war in unserem Alter, wohnte in einem der nahe gelegenen Reihenhäuser und war seit Weihnachten ebenfalls stolzer Besitzer eines Fahrrades. Nachdem der Opa mir geduldig das Radfahren beigebracht hatte, radelten wir um die Wette auf wenig befahrenen öffentlichen Wegen.
Einen Hund habe ich leider nie bekommen, bald war ich auch nicht mehr interessiert daran. Wenn ich einen Hund knuddeln wollte, konnte ich ja hinüber zum Bauernhof gehen.
Die Abende mit Opa liebte ich besonders. Bei schönem Wetter setzten wir uns auf die Gartenbank, ich lehnte meinen Kopf an seine Schulter, und er erzählte. Regnete es aber oder es war im Freien zu kalt, zogen wir uns zurück ins Wohnzimmer und machten es uns auf dem Kanapee gemütlich. Im Winter allerdings, wenn es wirklich kalt war, ging das nicht. Dort wurde nämlich nur zu Weihnachten, zu Neujahr und zu Ostern eingeheizt. Es hieß ja: Holz und Kohlen sparen. Nur der Ofen im Esszimmer wurde im Winter jeden Tag angezündet, und der Küchenherd wurde täglich angemacht, weil ja darauf gekocht wurde. Zwischen Küche und Esszimmer befand sich eine Tür, was das Auftragen des Essens erleichterte. Oft machten wir am Abend alle zusammen Karten- oder Brettspiele.
In der Zeit vor meiner Einschulung erzählte der Opa mir Märchen. »Rotkäppchen«, »Hänsel und Gretel« und »Der Wolf und die sieben Geißlein« konnte ich nicht oft genug hören. Er musste sie wieder und wieder erzählen. Mit der Zeit wurde ihm das aber zu langweilig. Deshalb versuchte er, kleine Änderungen einzubauen. Doch ich ertappte ihn jedes Mal und korrigierte ihn. »Du lässt dir aber nichts vormachen«, schmunzelte er und erzählte die Originalversion.
Nachdem ich Lesen und Schreiben gelernt hatte und meine Märchen selbst lesen konnte, erwartete ich andere Geschichten von ihm. Für mich war es unheimlich spannend, wenn er von seinen Kriegserlebnissen erzählte. Wie ich mich erinnere, wurde er im Alter von einundzwanzig Jahren einberufen. Gleich nach der Grundausbildung setzte man ihn in Frankreich in der Schlacht um Verdun ein. Diese zog sich von Februar 1916 über viele Monate hin. Bereits im September erwischte es meinen Großvater. Nach einem Lungenschuss dachte er schon, es sei aus mit ihm. Er fühlte sich mehr tot als lebendig, als man ihn nach Koblenz ins Lazarett brachte. Auf einer Röntgenaufnahme konnte man erkennen, dass die Kugel noch in der Lunge steckte. Es bestand aber keine Möglichkeit, sie herauszuoperieren. Die Ärzte konnten nur abwarten, was geschehen würde. Der Opa hatte Glück, die Kugel verkapselte sich, und er konnte nach vielen Monaten Lazarettaufenthalt entlassen werden. Wörtlich sagte er zu mir: »Nicht der Kunst der Ärzte habe ich es zu verdanken, dass ich überlebt habe, sondern meinem Schutzengel und dem lieben Gott. Der wollte mich noch nicht haben. Er wollte, dass ich ein so süßes Enkelkind haben würde wie dich.«
Nach dem Lungensteckschuss, war mein Großvater nicht mehr kriegstauglich, und man schickte ihn heim. Selbst den kleinen Kolonialwarenladen, den er von seinem Vater übernommen hatte, konnte er nicht mehr betreiben. Schon lange vor Kriegsausbruch war sein Vater aus Unterfranken »eingewandert«. Da der aufgeweckte junge Mann keine andere Verdienstmöglichkeit finden konnte, erkannte er bald, dass sich mit einem Geschäft etwas verdienen lasse. Er gründete den Kolonialwarenladen, der ihn und seine Familie gut ernährte.
Zu gerne hätte Korbinian diesen Laden weiter betrieben, doch durch seine Kriegsverletzung war er dazu nicht mehr in der Lage. Er konnte ja keine Mehl- und Zuckersäcke oder Heringsfässer schleppen.
In meiner Kindheit befanden sich aus diesem Geschäft auf unserem Speicher immer noch einige Maisstrohbesen, Bürsten und Kehrschaufeln, die er mir eines Tages zeigte. »Warum hast du das Zeug aufgehoben?«, wollte ich wissen. »Zum Wegwerfen sind die Sachen zu schade, und manchmal kommt noch jemand, der mir etwas davon abkauft.«
Als Kriegsversehrter hatte Opa ein Anrecht darauf, vom Staat in einer Stelle untergebracht zu werden, die ihm zumutbar war. Also schickte man ihn zur Post. Nach einer kurzen Anlernzeit wurde er Postbote. Als solcher hatte er keine schwere Arbeit zu verrichten. Außerdem tat die Bewegung in frischer Luft seiner Lunge gut.
Lange Zeit, nachdem Opa mir diese Geschichte erzählt hatte, interessierte mich eine ganz andere Geschichte von ihm. Mir war aufgefallen, dass wir in einem vergleichsweise feudalen Haus wohnten. Dieses Gebäude, freistehend, hatte nicht nur eine große Grundfläche, es war auch zweistöckig gebaut mit hohen Räumen. Darüber befand sich der geräumige Speicher. Unsere Nachbarn dagegen, deren Häuser in etwa hundertfünfzig Metern Entfernung begannen, lebten in kleinen, schmalen Reihenhäusern mit niedrigen Zimmern. Bei diesen lag über dem Erdgeschoss gleich das Dachgeschoss, in dem sich die Schlafkammern befanden. Diese hatten teilweise schräge Wände, sodass man keinen richtigen Kleiderschrank aufstellen konnte. Wir hatten ein eigenes Esszimmer, während in allen Häusern, zu denen ich Zugang hatte, in der Küche gegessen wurde.
»Wieso?«, fragte ich eines Tages meinen Großvater, obwohl ich erst zehn Lenze zählte, »kannst du es dir als einfacher Postbote leisten, in einem so großen Haus zu leben?«
Er lachte: »Das ist ganz einfach erklärt: Ich habe eingeheiratet.«
»Wie das? Wie kann man denn in ein Haus einheiraten?«
»Interessiert dich das wirklich, meine kleine Prinzessin?«
»Natürlich interessiert mich das. Du weißt doch, dass ich Geschichten liebe, besonders wenn sie wahr sind.«
Also begann er: »Es war einmal …«
»Halt! Stopp!«, unterbrach ich ihn. »So fangen immer die Märchen an. Du sollst mir aber kein Märchen erzählen, sondern eine wahre Geschichte.«
»Aber Lisi, das ist doch eine wahre Geschichte«, versicherte er mir. »Doch wenn du meinst, fange ich halt anders an: Einer deiner Vorfahren hieß Max, er war Arzt und hatte in München eine gut gehende Praxis. Seine Frau Notburga brachte 1862 einen Sohn zur Welt. Sie gaben ihm den Namen Ludwig, weil der damalige bayerische Kronprinz ebenso hieß. Dieser folgte zwei Jahre später seinem Vater als König Ludwig II. auf den Thron.
Der Ludwig aber, der Sohn von dem Arzt Max, sollte nach dem Wunsch seines Vaters ebenfalls Arzt werden und einst seine Praxis übernehmen. An Medizin lag dem jungen Ludwig aber nichts. Er zeigte mehr Interesse für Jura. Darüber war sein Vater nicht allzu enttäuscht, denn sein zweiter Sohn, der Martin, studierte Medizin und wurde sein Nachfolger. Aus seinem Erstgeborenen aber wurde ein tüchtiger Rechtsanwalt. Deshalb nahm ihn König Ludwig II. in seine Dienste. Leider verstarb dieser König schon sehr bald auf tragische Weise.«
»Ich weiß, er ertrank im Starnberger See. Dort wäre ich auch beinahe ertrunken.«
»Ja, wie denn das, Dirndl?«, reagierte der Opa bestürzt. »Wie bist du denn an den See gekommen? Davon weiß ich ja gar nichts.«
»Daheim habe ich nichts davon erzählt, um dich und die Mama nicht aufzuregen.«
Nun war also ich an der Reihe, eine Geschichte zu erzählen:
»Weißt Opa, die Schulzes, die Sommerfrischler aus Hamburg, die jedes Jahr bei uns Urlaub machen, haben doch eine Tochter, die Claudia, die ist zwei Jahre älter als ich. Vor drei Jahren nun langweilte sie sich furchtbar und bettelte so lange, bis mich ihre Eltern mit an den See nahmen. Vorher hatten sie natürlich meine Mama um Erlaubnis gefragt. Als wir an den See kamen, hüpfte die Claudia gleich ins Wasser, sie konnte ja schon schwimmen. Ich aber traute mich nur bis zu den Knien hinein.
›Komm, Lisi, wir bringen dir das Schwimmen bei‹, rief Frau Schulze. Vertrauensvoll ließ ich mich von den beiden rechts und links an die Hand nehmen. So wateten wir gemeinsam in den See hinein. Bald reichte mir das Wasser bis zum Kinn, obwohl ich schon auf Zehenspitzen ging. Das merkten die Schulzes aber nicht und machten den nächsten Schritt. In meiner Not wollte ich schreien. Doch als ich den Mund aufmachte, schwappte ein gehöriger Schwall Wasser hinein, der meinen Schrei erstickte. Da geriet ich in Panik und konnte mich nur dadurch bemerkbar machen, dass ich an den Händen der beiden zerrte. In dem Moment begriffen sie, dass ich bereits am Ertrinken war. Sie drehten sofort um, und ich ließ mich halbtot in den Sand fallen. Selbst als ich mich von dem Schrecken erholt hatte, war ich nicht mehr dazu zu bewegen, noch mal einen Fuß in den See zu setzen. Für den Rest des Tages baute ich an einer Sandburg. Die Mama wunderte sich, dass ich nach diesem Ausflug nie wieder mit den Schulzes zum Baden wollte.«
Nachdem ich mein aufregendes Erlebnis erzählt hatte, fuhr Opa mit der Geschichte über den königlichen Rechtsanwalt fort: »Auch der Prinzregent wusste den tüchtigen Anwalt zu schätzen und behielt ihn in seinen Diensten. Als königlicher Beamter verdiente dieser nicht schlecht. Doch damit nicht genug, durch seinen Beruf lernte er bald Mathilde kennen, die nicht nur liebreizend war, sondern auch einen wohlhabenden Vater besaß. Die jungen Leute verliebten sich heftig ineinander, und ihr Vater hatte nichts gegen eine Verbindung. Als sie im Jahre 1890 heirateten, brachte sie eine ordentliche Mitgift mit in die Ehe. Von dieser und von Ludwigs Ersparnissen ließen sie 1891 von einem namhaften Architekten dieses Haus errichten. Die Bauweise dieser Häuser wurde später als Jugendstil bezeichnet.
Zu ihrem großen Bedauern blieb das Paar lange Zeit kinderlos. Die junge Frau muss wohl die eine oder andere Fehlgeburt gehabt haben. Endlich aber, 1903, brachte Mathilde ein gesundes Töchterchen zur Welt, dem sie den Namen Gertraud gaben, es aber liebevoll nur Traudl riefen. Leider starb Traudls Mutter 1909 im Kindbett, nachdem sie ein weiteres Kind geboren hatte, einen Buben. Dieser starb gleich mit und wurde mit ihr im selben Grab beigesetzt. Also musste die kleine Traudl, erst sechs Jahre alt, ohne Mutter aufwachsen.«
Bei dieser Erzählung kamen mir die Tränen: »Das kleine Mädchen tut mir so leid. Wer hat sich denn um es gekümmert? Hat ihr Papa wieder geheiratet?«
»Nein, das hat er nicht. Er hatte seine Frau so sehr geliebt, dass er ihr keine Nachfolgerin geben wollte. Damit er und das kleine Mädchen versorgt waren, nahm er Hilde, seine älteste Schwester, die ledig war, ins Haus. Diese war sehr gut zu dem Kind.«
Wieder legte der Großvater eine Pause ein. Doch ich drängte: »Wie ging die Geschichte weiter?«
»Ludwig, Traudls Vater, war noch gar nicht sehr alt, da fühlte er sein Ende nahen. Deshalb bat er seinen Freund Adalbert, der ebenfalls im Dienste des Königshauses stand, er möge die Vormundschaft für seine Tochter übernehmen, für den Fall, dass er vorzeitig aus dieser Welt abberufen werden würde. Ludwig war sehr beruhigt, nachdem ihm der Freund zugesichert hatte, er werde sich um Traudl kümmern. Dieses Amt übernahm Adalbert tatsächlich, als Ludwig 1917 im Alter von nur fünfundfünfzig Jahren starb. Während die Waise Traudl weiterhin mit ihrer Tante in diesem Haus wohnte, schaute der Vormund gelegentlich vorbei und regelte die geschäftlichen Dinge. Als die junge Dame sechzehn war, hielt die Tante es für angebracht, sie mit Zustimmung des Vormunds in die Schweiz in ein Internat zu geben, damit sie die für ihren Stand angemessene Bildung bekomme. Drei Jahre später kehrte Traudl wieder nach Hause zurück. Inzwischen war sie zu einer Schönheit erblüht. Da kam dem Vormund die Idee, zumal sein Mündel nicht unvermögend war, sie sei eine gute Partie für seinen Sohn, den damals dreißigjährigen Ignaz. Diesen brachte er einmal ganz ›zufällig‹ mit, damit er sich die künftige ›Braut‹ unverbindlich anschaue. Spontan verliebte sich der junge Mann, stieß aber nicht auf Gegenliebe. Traudl fand keinen Gefallen an ihm, erstens sah er nicht besonders gut aus und zweitens machte er einen etwas einfältigen Eindruck, es kam nämlich keine vernünftige Unterhaltung mit ihm zustande. Das war vermutlich auch der Grund, warum er mit seinen dreißig Jahren noch unbeweibt war. Der Vormund unterdessen ermunterte seinen Sohn, ihr fleißig glühende Liebesbriefe zu schreiben, in der Hoffnung, dadurch könne er ihr Herz gewinnen. Wahrscheinlich hat der Vater seinem Sohn beim Verfassen der Briefe eingesagt. Nun kam ich ins Spiel. Als Postbote war es meine Aufgabe, ihr diese Briefe zu bringen. Die schöne Traudl stand schon jedes Mal am Gartentor, wenn ich – mit meiner schweren Posttasche beladen – kam. Sie stand da aber nicht, weil sie den Liebesbriefen entgegenfieberte, sondern weil sie ein Auge auf den Postboten geworfen hatte. Es gefiel mir, dass sie sich am Zaun immer auffallend ausgiebig mit mir unterhielt. Dennoch dauerte es ziemlich lange, bis bei mir endlich das Zehnerl fiel.
Noch wesentlich länger dauerte es, bis ich es wagte, bei der Frau Tante um die Hand des gnädigen Fräuleins anzuhalten. Den Vormund brauchte ich zum Glück nicht mehr zu fragen, weil Traudl mittlerweile volljährig war. Noch bevor ich meiner Angebeteten den Heiratsantrag machte, muss sie ihrem glühenden Verehrer eine schriftliche Absage erteilt haben. Denn seine Briefe blieben – wie abgeschnitten – aus. Daher hätte es für mich eigentlich keinen Grund mehr gegeben, zu ihr an den Zaun zu eilen. Zum Glück war aber noch der eine oder andere Geschäftsbrief abzugeben. Auf deren Zustellung allein wollte ich mich aber nicht verlassen, deshalb fand ich nach Beendigung meines Dienstes immer wieder einen Grund, mich mit ihr zu treffen. Im April 1925 feierten wir Verlobung, und ein Jahr später führte ich sie zum Altar. Die Tante hatte nichts dagegen, im Gegenteil, sie fand mich sympathisch und war froh, dass sie die Verantwortung für das Dirndl in meine Hände legen konnte.
Nach unserer Hochzeit zog sich Tante Hilde in ein Stift für wohlhabende Damen zurück.«
»Dann war die Traudl also meine Großmutter«, platzte ich in plötzlichem Erkennen dazwischen.
»Ganz recht, meine Prinzessin. Deine Großmutter und ich waren sehr glücklich miteinander. Nach einem Jahr bekamen wir eine Tochter, die Rosina.«
»Ja«, wusste ich zu ergänzen, »sie wurde meine Mama.«
»Auch das stimmt. Drei Jahre nach deiner Mutter kam deine Tante Klara zur Welt. Danach hatte meine Frau leider zwei Fehlgeburten. Daher gibt es einen so großen Abstand zu unserem dritten Kind. Als unser Sohn 1938 zu unserer großen Freude gesund zur Welt kam, gaben wir ihm zum Andenken an seinen Großvater den Namen Ludwig. Nun schien unser Glück vollkommen. Wie du weißt, fing ein Jahr später der Zweite Weltkrieg an. In unserer abgeschiedenen Region hatten wir zwar nicht direkt etwas von den Bomben zu befürchten. Aber wie überall in der Bevölkerung wurden die Lebensmittel knapp. Man bekam alles auf Karten zugeteilt. Wie froh waren wir in dieser Zeit über unseren großen Garten. Den Rasen wandelten wir um in Gemüsebeete und brachten daraus so manches zusätzlich auf den Tisch. In dieser Zeit fing ich auch an, Hühner zu halten, so hatten wir unsere Eier und ab und zu ein Huhn im Topf. Anfang 1944 begann deine Großmutter zu kränkeln. Es war ihr immer wieder schlecht, und sie klagte über Leibschmerzen. Die junge Ärztin, die wir schließlich kommen ließen – die erfahrenen Doktoren waren ja alle eingezogen –, behandelte Traudl einige Tage auf Magenverstimmung. Bis sie endlich erkannte, dass meine Frau einen eingeklemmten Leistenbruch hatte, war es bereits zu spät. Man sagte, der Brand sei hineingekommen. Wenige Stunden später war meine geliebte Frau tot. Sie wurde nur einundvierzig Jahre alt. Rosina, deine Mutter, war erst siebzehn, als das Unglück über uns hereinbrach. Nach der mittleren Reife hatte sie eine Lehre beim Landratsamt in Starnberg begonnen. Auf meine schriftliche Bitte hin entließ man sie aus dem Lehrverhältnis, damit sie für mich und ihre beiden jüngeren Geschwister sorgen konnte. Es war ganz erstaunlich, wie schnell Rosina den Haushalt im Griff hatte. Sie ermöglichte es Klara sogar, nach der Mittleren Reife eine Ausbildung bei der Post zu machen. Auch erkannte sie sehr bald die künstlerische Begabung ihres Bruders und setzte sich dafür ein, dass er in der Zweigstelle eines namhaften Porzellanherstellers unterkam. Dort machte er eine Lehre als Porzellanmaler. Aufgrund seiner Tüchtigkeit wurde er nach der Gesellenprüfung von dem Betrieb übernommen und verdient dort gutes Geld.«
Opas Bericht hatte mich stark beeindruckt, nicht nur wegen seiner romantischen Liebesgeschichte. Vor allem das Wort »Einheiraten« war es, das auf mich einen nachhaltigen Eindruck machte. Wenn der Opa in das feine Haus des königlichen Rechtsanwalts hatte einheiraten können, dann konnte ich vielleicht eines Tages in einen Bauernhof einheiraten. Als Erstes fiel mir natürlich der Hof jenseits des Baches ein, wo meine Freundin Nanni zu Hause war. Der würde mir schon gefallen. Doch dieser erwies sich als aussichtsloser Fall. Nanni hatte zwar einen Bruder, aber der war sechseinhalb Jahre jünger als ich, der würde noch ein Kind sein, wenn ich ins heiratsfähige Alter kam. Ich musste also Augen und Ohren offen halten, um einen Bauernsohn in passendem Alter zu finden, der mir eine Einheirat bieten konnte.