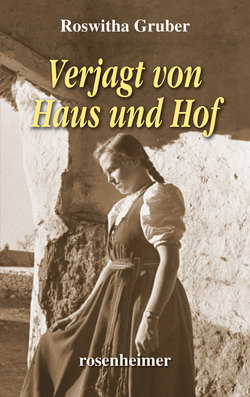Читать книгу Verjagt von Haus und Hof - Roswitha Gruber - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMamas Fehltritt
Im April 1957 war meine Mutter vom Einkaufen mit einer Neuigkeit nach Hause gekommen, von der sie beim Nachtessen ganz aufgeregt berichtete: »Stellt euch vor, die Gemeinde sucht Quartiere für Sommerfrischler.«
»Woher weißt du das?«, erkundigte sich ihr Vater.
»An der Gemeindetafel hängt ein entsprechender Anschlag.«
»Und was geht das uns an?«, fragte ihr Bruder.
»Wir könnten doch Zimmer vermieten, dann hätten wir eine schöne zusätzliche Einnahme.«
»Und welche Zimmer?«, wollte ihre Schwester wissen. »So viel ich weiß, steht in unserem Haus kein einziges Zimmer leer.«
»Wir müssten halt zusammenrücken, dann ließe sich das eine oder andere Zimmer vermieten.«
»Für wie lange soll denn das sein?«, mischte sich ihr Bruder wieder ins Gespräch.
»Auf dem Anschlag steht, man könne die Zimmer von Anfang Mai bis Ende Oktober vermieten.«
»Ui, das wäre fast ein halbes Jahr«, konstatierte Onkel Ludwig. »Und wie viel Geld gibt’s dafür?«
»Da stand etwas von sieben Mark pro Person und Nacht.«
Sogleich suchte sich der Onkel Zettel und Bleistift und begann zu rechnen, dann verkündete er: »Vorausgesetzt, wir könnten ein Bett durchgehend vermieten, dann wären das hundertachtzig Tage. Das macht mal sieben 1.260 Mark aus. Wenn wir vier Betten vermieten könnten, rechnen wir das Ganze mal vier, das wären 5.040 Mark. Eine stolze Summe! Damit ließe sich was anfangen. Also ich bin dabei. Wenn ich von den Einnahmen etwas abbekomme, stelle ich meine Kammer zur Verfügung.«
»Und wo willst du schlafen?«, sorgte sich Klara.
»Auf dem Dachboden«, kam die prompte Antwort. »Da ist doch Platz genug. Und ein paar alte Matratzen und Decken liegen da auch noch rum.«
Nun war auch Klara bereit, für ein bisschen Beteiligung an den Einkünften ihr Zimmer für ein halbes Jahr zu opfern. Die Mama hatte eh schon in Gedanken ihr Doppelzimmer, in dem sie mit mir schlief, für die Gäste geräumt. Noch ehe ich einen Einwand erheben konnte, versprach sie mir von den Einnahmen eine Tafel Schokolade.
Nun wollte Opa nicht nachstehen. Um ebenfalls etwas zur Erweiterung des Familieneinkommens beizutragen, erklärte er sich bereit, sein Doppelzimmer den Sommerfrischlern zur Verfügung zu stellen und für diese Zeit ins Einzelzimmer seines Sohnes zu ziehen. Da begann Ludwig wieder zu rechnen: »Wenn wir zwei Doppelzimmer und ein Einzelzimmer vermieten, sind das insgesamt fünf Betten, also können wir zu der Summe noch mal 1.260 Mark hinzuzählen. Somit kämen wir auf 6.300 Mark im halben Jahr.«
Doch Mama bremste seinen Optimismus etwas: »So viel nehmen wir nicht wirklich ein. Du darfst nicht vergessen, davon geht einiges fürs Frühstück drauf und einiges für die Wäsche. Hinzu kommt, bevor wir mit Verdienen loslegen, müssen wir erst mal einiges investieren. Wir brauchen zusätzliche Bettwäsche. Denn die unsere reicht gerade mal für uns, zudem weist sie schon leichte Verschleißerscheinungen auf. So etwas kann man den Gästen nicht anbieten. Neue Frotteehandtücher brauchen wir ebenfalls und natürlich eine Waschmaschine. So viel Wäsche kann ich nämlich nicht von Hand waschen.«
Nun ja, nachdem sich alle einig waren, meldete meine Mutter bei der Gemeindeverwaltung zwei Doppelzimmer und ein Einzelzimmer an. Schon nach wenigen Tagen bekamen wir Anmeldungen für alle Betten, zunächst für drei Wochen. Das bedeutete, dass wir Anfang Mai auf den Dachboden zogen und Opa in Ludwigs Kammer umzog. Das Schlafen auf dem Dachboden fand ich ganz lustig.
In den ersten Wochen machten nur ältere Herrschaften bei uns Urlaub, solche, die nicht auf die Schulferien angewiesen waren. Das einzig Unangenehme an der »Hausbesetzung« war, dass sie allmorgendlich unseren Frühstückstisch belagerten und die besten Sachen vorgesetzt bekamen, wie Wurst, Käse und Schinken. Ich dagegen musste warten bis sie fertig waren, und bekam noch nicht mal die Reste vorgesetzt. Diese hob Mama im Kühlschrank auf, den sie auch eigens für die Sommerfrischler angeschafft hatte, um sie ihnen anderntags wieder vorzusetzen. Im Übrigen störten die Gäste nicht. Sie unternahmen jeden Tag lange Wanderungen, von denen sie am Abend schwärmten.
Nach drei Wochen war Bettenwechsel. Ab da wurde es interessant für mich. In den ersten Bundesländern hatten nämlich die Sommerferien begonnen. Nun kamen also Leute mit Schulkindern. Die waren zwar etwas älter als ich, trotzdem konnte ich mit ihnen spielen. Holländer kamen auch zu uns. Obwohl sie so komisch sprachen, konnten wir Kinder uns bald verständigen. Alle zwei oder drei Wochen wechselten unsere Gäste. Ab September waren es dann wieder ältere Personen, die bei uns Erholung suchten. Das waren alles Leute aus dem Flachland. Sie waren nicht nur von unseren Bergen entzückt, sondern auch vom Starnberger See, an dem sie mit Begeisterung auf den Spuren des unglückseligen Königs wandelten.
Ende Oktober durften wir wieder zurück in unsere Betten. Im Jahr darauf ging es im Mai wieder los mit Vermieten. Wieder hieß es für uns: umziehen auf den Dachboden.
Im Juli herrschte zusätzlich große Hektik bei uns im Haus. Obwohl es voller Urlaubsgäste war, galt es, eine Hochzeit auszurichten. Meine Tante Klara, Mamas Schwester, hatte doch noch einen Hochzeiter gefunden, womit schon niemand mehr gerechnet hatte, weil sie bereits siebenundzwanzig war. Ihr Bräutigam war der um fünf Jahre jüngere Erich, ein Kollege von Onkel Ludwig.
Aus Anlass dieser Hochzeit sollte ich ein Gedichtchen vortragen. Tagelang hatte die Mama es mir wieder und wieder vorgelesen, und ich hatte es nachgeplappert, bis ich es fehlerfrei aufsagen konnte. Als Sechsjährige hatte ich keine Ahnung, was ich da herunterleierte:
»Ich will dir einen Glückwunsch sagen,
Dir unsrer lieben jungen Braut.
Es hat ihn mir mit ernsten Augen
Die liebe Mutter anvertraut.
Ich wünsch dir allen Glückes Rosen,
und wachsen Leides Dornen dran,
So bleibe stark und blick nach oben,
Was Gott tut, das ist wohlgetan.«
Nach der kirchlichen Trauung sollte in einem Gasthaus gefeiert werden. Nach der Brautmesse begab sich die ganze Verwandtschaft dorthin. Das war ein Erlebnis für mich. Was es zu essen gab, weiß ich nicht mehr, aber es war reichlich und gut. Satt und zufrieden lehnten sich alle zurück. Dann kam mein großer Auftritt. Die Mama hatte mich extra fein gemacht. Ich trug ein duftiges hellblaues Kleidchen, das die Mama eigens für mich genäht hatte. Es brachte meine rotgoldenen Locken voll zur Wirkung. So stand ich nun vor den vielen Leuten, die ihre Augen erwartungsvoll auf mich richteten. Ich machte den Mund auf und begann mit klarer Stimme:
»Ich will dir einen Glückwunsch sagen,
Dir unsrer lieben jungen Braut.«
Doch weiter kam ich nicht. Verzweifelt wiederholte ich den ersten Vers, aber auch dann fand ich den Anschluss nicht. Mein Kopf war völlig leer, mir fiel kein weiteres Wort mehr ein. Leider konnte die Mama mir nicht einsagen, sie hatte den Zettel zu Hause gelassen. Die Situation war mir furchtbar peinlich. Alle Gäste und das Brautpaar saßen da mit erwartungsvollen Gesichtern, aber es kam nichts mehr. Als sie auch noch anfingen, mich zu trösten, war es mit meiner Fassung vorbei. Auf ihre Trostworte »Das macht doch nichts.«, »Das kann jedem passieren.«, »Hast es halt gut gemeint.«, kullerten mir dicke Tränen über die Wangen. Während meine Mutter mich aus der Gefahrenzone zog, hörte ich noch, wie sie der Festgesellschaft erklärte: »Gestern hat sie es einwandfrei gekonnt. Glaubt mir, das ist nur die Aufregung.«
Im Nebenzimmer schluchzte ich: »Ich hab’s doch so gut gekonnt.«
»Freilich hast du das«, bemühte sich Mama, mich wieder aufzubauen. »Lisi, das ist kein Grund zum Weinen. Schau, ein vergessenes Gedicht ist doch kein Beinbruch.«
Dieser Satz gab mir nicht nur in diesem Moment mein Selbstbewusstsein zurück, er wurde mir auch in meinem späteren Leben zum Trostspruch, wenn mir etwas nicht so glückte, wie es sollte. Ich trocknete meine Tränen und wanderte mit der ganzen Gesellschaft zum Haus des Bräutigams, wo wir uns fröhlich an der Kaffeetafel niederließen. Nach der Hochzeitsfeier zog Tante Klara bei uns aus, damit wurde ihre Kammer endgültig frei für Sommergäste.
Wenige Wochen später begann für mich der Ernst des Lebens; ich wurde eingeschult. Die obligatorische Schultüte schenkte mir Onkel Ludwig. Nanni, meine Freundin vom Bauernhof, und Dieter, der Junge aus der Nachbarschaft, kamen mit mir in die Schule. Zunächst saßen Nanni und ich zusammen in einer Bank. Bald schon aber setzte uns die Lehrerin auseinander mit der Bemerkung: »Das tut nicht gut, wenn ihr nebeneinander sitzt. Ihr ratscht zu viel.«
Das tat unserer Freundschaft keinen Abbruch. Am Nachmittag waren wir viel beisammen, manchmal bei uns, viel öfter aber auf dem Bauernhof. Eines Tages, als ich sie besuchte, herrschte freudige Aufregung im Haus. Nannis Mutter hatte ein Baby bekommen, einen kleinen Benno. Ach, war der niedlich! Die rosigen Pausbäckchen, die winzigen Fingerchen, die zu Fäustchen geballt neben seinem Gesicht lagen. Er war eine lebendige Puppe zum Liebhaben. Nun wollte ich auch unbedingt ein Geschwisterchen haben. Mit diesem Wunsch zur Mama zu gehen, wagte ich allerdings nicht. Ihre Antwort kannte ich schon. Sie würde sagen, ich soll dem Christkind einen Zettel schreiben und ihn auf die Fensterbank legen. Dieser Sache traute ich aber nicht mehr. Erstens hatte ich statt eines Hundes ein Fahrrad bekommen, und zweitens behaupteten meine Mitschüler, nicht das Christkind würde die gewünschten Sachen bringen, sondern die Eltern würden diese im Geschäft oder aus einem Katalog kaufen. Wie aber hätte mir meine Mutter diesen Wunsch erfüllen können? Babys gab es ja nirgends zu kaufen, weder im Laden noch in einem Katalog, so viel wusste ich schon. Bei meinem nächsten Besuch auf dem Bauernhof erkundigte ich mich bei meiner Freundin, wie man zu kleinen Kindern käme.
»Die bringt der Klapperstorch«, antwortete sie im Brustton der Überzeugung.
»Wirklich? Bist du da ganz sicher?«
»Freilich, schau doch, auf dem Schuldach nistet ein Storch. Der fliegt immer zu einem großen Weiher, um Frösche zu fangen. Manchmal fischt er aber auch ein Baby heraus und bringt es zu Leuten, die sich eines wünschen.«
»Woher weiß der Storch, wer sich ein Baby wünscht?«
»Das ist ganz einfach. Man legt Zucker auf die Fensterbank. Im Vorbeifliegen sieht der Storch ihn, packt ihn mit seinem großen Schnabel und weg ist er.«
»Woher weißt du das alles?«, fragte ich, immer noch zweifelnd.
»Meine Oma hat es mir erzählt.« Diese Oma kannte ich, sie schien mir eine vertrauenswürdige Person zu sein. Dennoch blieb ich skeptisch: »Und du meinst, dass das wirklich hilft?«
»Gewiss hilft das. Ich hab’s doch selbst ausprobiert. Wie du siehst, habe ich ein Brüderl gekriegt. Darüber sind wir alle glücklich, besonders aber der Papa. Er braucht ja einen Erben für den Hof.«
Sie klärte mich noch darüber auf, dass es Würfelzucker sein müsse. Davon solle ich am Abend einige Stücke auf die Fensterbank legen. »Sei nicht traurig, wenn es nicht beim ersten Mal klappt. Du musst Geduld haben und es nach ein paar Wochen wieder versuchen.«
Ihre Empfehlungen befolgte ich genau. Die Mama stellte den Feriengästen immer Würfelzucker auf den Frühstücktisch. Davon entwendete ich jeden Morgen nur zwei Stücke, damit es nicht auffallen würde. Als ich sechs Stücke beisammen hatte, legte ich sie am Abend hinaus auf die Fensterbank des Esszimmers. Dort musste der Storch sie im Vorbeifliegen ganz sicher sehen. Tatsächlich, am anderen Morgen waren sie verschwunden. ›Der Storch hat den Zucker gefunden‹, jubilierte ich innerlich. Aber von einem Baby war in den folgenden Tagen nichts zu sehen. Also wiederholte ich das Experiment nach einigen Wochen. Ohne Erfolg. Nachdem ich das Ganze noch zwei- oder dreimal durchgeführt hatte, gab ich auf. Inzwischen war es nämlich Herbst geworden, und die Störche waren nach Süden gezogen. Da wäre es reine Verschwendung gewesen, weiterhin Zucker auf die Fensterbank zu legen.
Im Dezember kam der erste Schnee, da hatten wir Kinder nur noch Schlittenfahren im Sinn. Nicht allzu weit von unserem Haus entfernt erhob sich ein ansehnlicher Hügel. Dort trafen sich die Kinder aus der näheren Umgebung, vor allem auch Nanni und Dieter. Gleich nach dem Mittagessen zogen wir los, um die Tageshelligkeit auszunutzen. Die Hausaufgaben ließen sich später auch bei Lampenschein erledigen. Schlittenfahren konnte man bis in den März hinein. Dann wurde der Schnee zu wässrig. Zu meiner Freundin jenseits des Baches konnte ich dann nicht mehr. Zur Zeit der Schneeschmelze wurde unser harmloser Bach nämlich zu einem reißenden Ungeheuer. Dann trat er mit schöner Regelmäßigkeit über die Ufer und machte die kleine Brücke unpassierbar. An solchen Tagen war ich auf Dieter als Spielkamerad angewiesen. War ich bei ihm, musste ich immer mit seiner Dampfmaschine, seiner Eisenbahn und seinen Autos spielen. Das fand ich fad. Deshalb war es mir lieber, er kam zu mir. Wenn wir dann mit den Puppen »Vater, Mutter, Kind« spielten, fand er das fad. Er fing an, mit mir zu streiten, und zog wutentbrannt von dannen. So ein Streit hielt manchmal mehrere Tage an. Wenn ich es wagte, mich auch nur in Richtung seines Hauses zu bewegen, warf er mit Schneebällen. Stritten wir im Herbst, benutzte er heruntergefallene Äpfel als Wurfgeschosse. Nicht nur im Ausweichen entwickelte ich eine erstaunliche Geschicklichkeit, bald hatte ich auch genug Kraft in den Armen, um das Feuer erwidern zu können. Dann lenkte er schnell ein.
Als im Mai mit den ersten Gästen auch wieder Würfelzucker auf dem Tisch stand, wollte ich es doch noch mal mit dem Storch probieren. Wieder stibitzte ich einige Stückchen und platzierte sie an der bewussten Stelle. Wieder verschwand der Zucker, aber von einem Baby keine Spur. In den folgenden Monaten versuchte ich es noch einige Male. Statt aber bei uns ein Baby abzuliefern, brachte der Storch es zu Tante Klara, zu deren Hochzeit ich im Juni das Gedicht verpatzt hatte und die ein paar Straßen weiter wohnte. Was mich dabei wunderte; der Storch brachte ihr das Baby im November, wo doch längst alle Störche in Afrika sein sollten. Dieser Storch kannte sich anscheinend mit dem Kalender nicht aus und hatte deshalb eine verspätete Lieferung gebracht. ›So ein blöder Storch‹, ärgerte ich mich. ›Von mir nimmt er den Zucker, und das Baby bringt er zur Tante.‹
Nun hatte ich die Nase voll von dem undankbaren Vogel. Im Frühjahr würde ich ihm meine erbeuteten Zuckerstücke nicht mehr hinlegen, sondern sie selbst vernaschen.
Den Gedanken an ein Brüderchen oder Schwesterchen hatte ich längst aufgegeben, als Tante Klara Ende Januar 1961 mal wieder ihren Vater besuchte. Er hatte gerade seinen Mittagsschlaf beendet. Während sie und Mama mit Opa im Esszimmer bei einer Tasse Kaffee saßen, spielte ich in der Küche mit meiner kleinen Cousine Klara, die etwas über zwei Jahre alt war. Sie konnte schon recht nett plappern und war vor allem flink auf den Beinen, sodass ich ihr immer wieder nachsausen musste. Die Tür zum Esszimmer war nur angelehnt, daher schnappte ich auf, wie Tante Klara meiner Mutter zuraunte: »Jetzt musst du es ihr aber bald mal sagen.«
Mutter antwortete darauf: »Nein, Klara, das bring ich nicht fertig. Sag du es ihr.«
Dieser Wortwechsel klang für mich höchst interessant, weil ich vermutete, dass es um mich ging. Deshalb war ich sofort bereit und voller Erwartung, als die Tante mir vorschlug, ich solle sie nach Hause begleiten. Sie hätte gar nicht zu versprechen brauchen, dass ich Klaras Schlitten ziehen durfte.
Im Haus der Tante angekommen, setzte sie ihr Kind in der Küche in den Laufstall, wo es friedlich spielte. Mit mir aber nahm sie auf der Eckbank Platz, legte vertraulich einen Arm um mich und verriet mir ein großes Geheimnis: »Du kriegst demnächst ein Geschwisterchen.«
Diese Mitteilung verschlug mir für einen Moment die Sprache. Dann aber sprudelte ich heraus: »Wirklich? Wann? Woher weißt du das? Hat sich der Storch das endlich überlegt?«
Sie lächelte: »So viele Fragen kann ich nicht auf einmal beantworten. Also, schön der Reihe nach. Und der Storch hat damit gar nichts zu tun.«
»Nicht?«, reagierte ich mehr enttäuscht als verwundert. »Er hat aber doch immer den Zucker geholt, den ich ihm auf die Fensterbank gelegt habe.«
»Schau, Lisi, das mit dem Storch ist ein Ammenmärchen, das man kleinen Kindern erzählt. Du bist aber schon ein großes Mädchen, drum kannst du ruhig die Wahrheit erfahren.«
Diese Bemerkung erfüllte mich mit Stolz, dennoch blieb die Frage: »Wo ist denn dann der Zucker geblieben?«
»Den hat deine Mutter eingesammelt und wieder in die Zuckerdose getan.«
Mir brannte eine weitere Frage auf der Seele: »Woher weißt du, dass ich ein Geschwisterl kriege?«
»Deine Mama hat es mir verraten.«
»Und woher weiß sie das?«
»Sie sollte es wohl wissen, es wächst ja in ihrem Bauch.«
Diese Antwort fand ich so ungeheuerlich, dass ich erst mal nach Luft schnappte. »Ist das gewiss wahr? Bindest du mir auch keinen Bären auf?«
»Das stimmt«, versicherte sie mir. »Darauf kannst du dich verlassen.«
Nun interessierte mich natürlich noch, wann es endlich so weit sei und wie das Baby aus dem Bauch herauskomme. Sie meinte, im April werde es kommen, und sie erklärte mir, wie eine Geburt in etwa ablaufe. Auf die Idee zu fragen, wie das Baby in den Bauch hineingekommen sei, kam ich gar nicht.
Tante Klara entließ mich mit der Ermahnung, die Mama in der nächsten Zeit nicht zu ärgern und ihr in jeder Weise behilflich zu sein. Vor allem solle ich darauf achten, dass sie keine schweren Sachen trage. Das würde ihr und dem Baby schaden.
Mit strahlendem Gesicht eilte ich nach Hause, streichelte der Mama zärtlich den Bauch und versicherte ihr: »Ich bin ja so glücklich. Ich werde dir nun helfen, wo ich kann.«
In der Folgezeit ließ mich die Mama an ihrer Schwangerschaft teilhaben, indem sie immer wieder meine Hand auf ihren Bauch legte mit der Bemerkung: »Schau, da ist ein Füßchen. Das hat sich gerade bewegt.«
Tatsächlich konnte ich hin und wieder eine Kindsbewegung ertasten. Mama war viel schneller erschöpft als sonst und musste sich öfters hinsetzen. Mit Interesse beobachtete ich, dass ihr Bauch zusehends dicker wurde. Das muss auch Onkel Ludwig aufgefallen sein, denn von ihm schnappte ich Folgendes auf: »Wenn du dich so im Dorf sehen lässt, werden sich alle das Maul zerreißen.« Diese Bemerkung verstand ich zwar nicht, aber sie gab mir zu denken. Doch ich wagte nicht, nachzufragen.
Ich konnte es kaum erwarten, bis die Osterferien begannen. Denn dann würde ich daheim sein und das freudige Ereignis miterleben können. Doch die Ferien gingen herum, ohne dass sich etwas tat. Zu blöd, dass ich am 11. April wieder in die Schule musste. Da würde ich ja das Wichtigste verpassen. Tatsächlich, als ich am 14. April nach Hause kam, war die Mama nicht da. Der Opa setzte mir das Essen vor, wobei er erklärte: »Bei deiner Mama haben heute in der Früh die Wehen eingesetzt. Deshalb ist sie zur Hebamme gegangen.«
Am liebsten wäre ich sofort losgestürmt. »Nein, halt, Dirndl, erst wird gegessen. Bei der Entbindung können sie keine kleinen Mädchen brauchen. Wir müssen warten, bis wir benachrichtigt werden.«