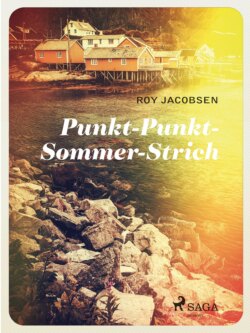Читать книгу Punkt - Punkt - Sommer - Strich - Roy Jacobsen - Страница 5
3
ОглавлениеUnd in Drøbak regnet es tatsächlich auch einmal, einen weichen und anhaltenden Juniregen. Die Familie muß im Haus bleiben, und das ist gut, so durchgegrillt, wie wir schon sind, die drei von uns jedenfalls, die sich hier unter der brennenden Sonne dieser südlichen Breitengrade nackt am Strand aufgehalten haben. Der Verfasser dieser Zeilen hat sich dem nicht ausgesetzt, nicht nur, weil das, was seine rötliche Haut einst an Pigmenten hatte, von neun langen Jahren unter dem Polarstern zerstört worden ist, sondern auch, weil er Felsen, Strände und müßige Tagedieberei in weißem Sand noch nie ausstehen konnte. Aber jetzt regnet es also, und wir sind im Haus. Die Kleine hört zusammen mit der ältesten Tochter des Spielgerätemannes auf ihrem Zimmer Platten. Thomas sitzt mit Mutter und den zwei Söhnen des Nachbarn, einer elf, einer dreizehn, sowie fünf Yatziwürfeln im Wohnzimmer. Katrine ist fabelhaft in dieser Hinsicht, sie kann Stunde um Stunde beim idiotischsten Spiel sitzen, für sie ist nur wichtig, daß die Kinder erhalten, was ihnen zusteht, und zwar an Erziehung, Beschäftigung und befriedigten Wünschen, obwohl in letzter Zeit wohl auch ein Kontrollmotiv mit ins Bild gekommen ist – schließlich nähert sich das gefährliche Alter. Während Vater im ersten Stock sitzt und Schriftsteller mit einem Glas Whisky ist, während er aus dem sommerregennassen Fenster sieht, auf einen hellen Moosflecken im Garten, und an den Mord denkt, der ihn nicht interessiert. Wir haben den Kindern natürlich nichts gesagt. Das wurde an einem Abend recht peinlich, als mein Sohn mich überraschte, als ich – oben auf einer Trittleiter – den einen Deckenbalken im Wohnzimmer nach Seilspuren absuchte. Ich glaubte auch, die richtige Stelle gefunden zu haben.
»Was machst du denn da, Paps?«
»Sehe nach, ob es tropft«, antwortete Paps, stehenden Fußes.
»Aus dem ersten Stock?«
»Aus dem Badezimmer.«
Der Vater kann es mit dem Sohn durchaus noch aufnehmen. »Mutter hat da oben eine Wanne umgeworfen.«
»Aber gibt’s denn ein Loch in der Decke?«
»Sieht nicht so aus.«
»Können Petter und Gunnar nachher zum Yatzispielen kommen?«
»Aber klar.«
Dieses Gespräch wurde indessen von der Mutter mitgehört, und als die Trittleiter entfernt worden und der Sohn losgelaufen war, um seine neuen Freunde zu informieren, murmelte sie etwas davon, daß sie sich ab und zu frage, ob sie mich wirklich kennt.
»Wie konntest du ihn so belügen?«
»Ich bin Schriftsteller, meine Liebe, nimm das nicht zu wichtig.«
»Aber man kann dir ja unmöglich ansehen, ob du die Wahrheit sagst. Es wäre irgendwie ...«
»... beruhigender, wenn mir das mit dem Badezimmer nicht so elegant eingefallen wäre?«
»Ja.«
»Dann meinst du vielleicht, daß ich dich genauso lässig belüge? Daß ich in all den fünfzehn Jahren unserer Ehe eine Geliebte gehabt habe und ...«
»Jetzt übertreib nicht!«
Ich habe meine Aversion gegen Lügen bereits erwähnt, aber das muß ich etwas genauer erklären. Sie ist nämlich für Katrine reserviert. Nur sie mag ich nicht betrügen. Bei allen anderen habe ich keine Skrupel. Und das hat nicht nur mit Hemmungslosigkeit zu tun, es liegt eher an der Tatsache, daß ich nicht viel habe, worüber ich lügen könnte, und daß es mir nie besonders viel einbringt. Meine Lügen sind nämlich ganz sinnlos. Man kann wohl sagen, daß ich mit meinem kleinen Spruch über das Wasser im Badezimmer meinen Sohn mit der Mordgeschichte und mich selbst mit dem Problem verschonen wollte, ihn danach beruhigen zu müssen – mit dieser Art Lügen schmieren vermutlich die meisten ihr Leben. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Dasselbe Resultat hätte sich nämlich erreichen lassen, wenn ich einfach etwas Unverständliches gemurmelt und so getan hätte, als ob gar nichts wäre. Mein Sohn hätte keine Szene gemacht, um herauszufinden, was sein Vater auf einer Trittleiter im Wohnzimmer treibt, und es wäre auch ehrlicher gewesen, wie Katrine angemerkt hat, vertrauenerweckender. Aber dann verspürte ich die Versuchung, es stilvoll zu machen, ich fühlte mich verführt von dem Anspruch, eine glaubwürdige Erklärung zu finden, denn Glaubwürdigkeit hat oft etwas mit Stil zu tun. »Es tropft aus dem Badezimmer«, das ist dieses winzige Verlangen nach einer eleganten Erklärung. Diesem beklagenswerten Leben fehlt so etwas ja in höchstem Maße, und es wäre doch unerträglich, wenn man nicht von Zeit zu Zeit das wenige hinzufügen würde, was an einem Motivkomplex fehlt, an einer Beschreibung, einem Geständnis, einer Geschichte ... Eigentlich arbeite ich so ja auch in meinen Büchern. Es hat einige Jahre (und einige Romane) gedauert, bis ich entdeckt hatte, daß ich, ein Sozialrealist, bis an die Zähne bewaffnet mit Begriffen wie »wahrhaftig«, »wirklichkeitsgetreu« oder »echt«, an der Wirklichkeit herumbastelte. Und so versuche ich jetzt weiterzumachen, während ich mich über meine Schreibmaschine beuge und einen hellen Moosflecken unten im Garten anstarre, während in der Ferne Michael Jackson singt, meine Frau einen Stock tiefer mit drei Knaben Yatzi spielt, und im Haus ein Sommerfriede herrscht, wie man ihn sich nur wünschen kann.
Das war übrigens auch einer meiner Gründe, aus denen ich Schriftsteller geworden bin; der Traum, im ersten Stock in einem großen alten Holzhaus auf dem Lande irgendwo im verschlafenen Norwegen zu sitzen, auf einen üppigen Garten hinauszublicken, mit dem Meer im Hintergrund, und gleichzeitig meine Familie in der Nähe zu haben, nicht so nah, daß sie meine Kunst direkt beeinflußt, aber auch nicht so weit weg, daß der Autor sich nicht erheben kann, wenn er das Bedürfnis dazu verspürt, und nach unten gehen und in tiefen Zügen diese mittelmäßige und gerade deshalb wunderbare Trivialität einatmen kann, denn die ist trotz allem sein fester Halt. Sie ist Hintergrund, Motiv, Treibkraft von allem und auch der Sinn von allem, was er tut, er liebt seine familiäre Umgebung ... Ja, genau diese mythische und im norwegischen Geistesleben sehr verbreitete Rolle war mein Grund, Schriftsteller zu werden, weitaus mehr als das Bedürfnis, mich mitzuteilen, berühmt zu werden ... obwohl sicher auch das eine Rolle spielte. Also besorgte ich erst alles, was zu dieser Rolle gehörte, eine Schreibstube zum Beispiel, ich besorgte mir eine Schreibstube, als ich noch längst nicht wußte, ob ich überhaupt in der Lage wäre, ein Wort zu Papier zu bringen. Ich kaufte die beste Ausrüstung, Graphik für die Wände, ich abonnierte Zeitschriften in mindestens drei verschiedenen Sprachen, und ich kleidete mich sogar so, wie ich es für einen Autor von der Sorte, die ich werden wollte, für richtig hielt. Und als alles für eine perfekte Karriere vorbereitet war, versank ich in einem beschwerlichen, zähen Brei. Ich wußte ja, daß alles, was ich um mich herum geschaffen hatte, Pfuschwerk war, und wer kann mir die Freude verdenken, die ich empfand, als ich entdeckte, daß ich wirklich schreiben konnte, daß ich nicht nur schreiben konnte, sondern daß ich schon bei meiner ersten Veröffentlichung in der norwegischen Öffentlichkeit wie eine Granate detonierte; umstritten, überschätzt, verrissen, verkauft, gelesen, bewundert und verachtet, alles, wovon ein Schriftsteller meiner Generation damals, zu Beginn der siebziger Jahre, nur träumen konnte. Als ich nicht gleich einen Preis bekam, schrieben die Zeitungen, die meinem Herzen am nächsten standen, daß mir ein blutiges Unrecht widerfahren sei; der Parnaß und das Establishment wollten mich totschweigen, weil ich gefährlich war! Ich weiß noch heute, wie mich das mit einem Gefühl der Allmacht und einer Befriedigung erfüllte, wie sie wohl nur wenigen Dreiundzwanzigjährigen zuteil wurde. Ich war nicht nur Schriftsteller in einer perfekten Schreibstube, sondern ich war auch alles andere, wovon ein junger Mann träumt: Soldat, Kreuzritter, Verkünder und eben – gefährlich!, das schönste aller Adjektive in der oppositionellen Traumwelt des real-existierenden Norwegens. Und ich verdiente vom ersten Moment an mein Brot; und das war nichts weniger als ein Wunder!
Seither ist mit dieser knabenhaften Begeisterung jedoch etwas passiert, und ich weiß noch genau, wie und wann: Ich hatte meinen vierten Roman beendet, ich war mir bei den beiden letzten Kapiteln nicht sicher und schickte sie mit der Bitte um einen fachlich qualifizierten Kommentar an meinen Verlag – und als Antwort gab es nur Lob! Zuerst war ich erleichtert, dann verwirrt, dann wütend, schließlich paranoid. Ich war damals dreißig. Ich hatte drei »umstrittene« Romane geliefert, wie die Zeit es verlangte, und ich arbeitete am vierten. Und dann versagt mein Selbstbewußtsein, ich bitte um Hilfe und bekomme zu hören, daß das, von dem ich weiß, daß es schwach ist, als perfekt gilt, da es dem, was ich früher geschrieben habe, zum Verwechseln ähnelt. Das Ergebnis ist, daß ich natürlich anfange, auch an diesem »Früheren« und »Perfekten« zu zweifeln, und meine alten Werke noch einmal lese und schon nach zwei oder drei Seiten merke, daß ich dies und jenes entschuldige, daß ich es meiner Unreife, den Ansprüchen der Zeit, einem heftigen Mißverständnis in meiner Beziehung zu Katrine und allen möglichen anderen Kuriositäten zuschreibe. Und in dem Moment, in dem ich diese entschuldigende Haltung entdecke, geschieht in mir etwas. Ich verließ meine unsichere Ideologie zwar nicht, das werde ich wohl nie tun, aber ich entwickelte ein besonders feinfühliges Gehör für das, was aus meinen eigenen Reihen im politischen System kam. Mit immer tiefer werdender Schamröte sah ich das öffentliche Auftreten meiner Parteigenossen. Es bringt vielleicht Standhaftigkeit und Ehrlichkeit zum Ausdruck, Jahr für Jahr die eigenen Meinungen vorzubringen. Aber zu etwas zu stehen, das man die ganze Zeit damit entschuldigen muß, daß die Zeit es lächerlich gemacht hat, daß man reifer geworden ist – das ist äußerst anstrengend. Andererseits: Kann man immer reifer werden, es sich mit der Auffassung gemütlich machen, daß das, was im einen Moment wahr und richtig ist, es im nächsten nicht unbedingt auch sein muß, kann man sich mit der wissenschaftlichen Selbstverständlichkeit zur Ruhe setzen, daß alle Wahrheiten nur vorläufig sind, während man doch gern ein Verkünder großer Thesen wäre? Wohl kaum.
Am Rande dieser tiefen existentiellen Schnörkel kräuselt sich nun mein Gehirn, und das so intensiv, daß ich die Schreibmaschine verlassen und ins Wohnzimmer hinuntergehen und fragen muß, ob ich beim Yatzi mitspielen kann. Was sie gestatten. Meine Frau sieht mich leicht mißtrauisch an: »Was soll das bedeuten, du haßt doch Yatzi!«
Ganz richtig, aber jetzt möchte ich lieber hier sitzen, als mich von einer Vergangenheit ablenken zu lassen, die nicht mir gehört, sondern dem Haus, in dem ich wohne – und ein Haus ist ein Haus, es ist einfach nur ein Haus, eine Schale, es ist nichts. Aber ich trete zu einem Zeitpunkt in das Spiel ein, als der älteste Sohn des Spielgerätemannes, Petter, gerade dreimal hintereinander gewonnen hat, weshalb die anderen alles satt und untereinander signalisiert haben: Jetzt ist Schluß.
»Ach?« sage ich.
»Tja, wir könnten vielleicht noch eine Runde machen.«
Eine Wohltätigkeit, von der ich natürlich nichts wissen will, und deshalb erhebe ich mich von dem Stuhl, den ich eben so keß eingenommen habe, gehe in die Küche, reiße die Kühlschranktür auf und schnappe mir wütend ein Bier, als ob ich irgendwem im Kühlschrank Vorwürfe machen könnte, öffne das Bier und trinke, noch immer stocksauer. Und als Katrine kommt und fragt, was das Theater denn bedeuten soll, sage ich wie aus der Pistole geschossen:
»Wenn es morgen auch wieder regnet, fahre ich in die Stadt, ich muß im Verlag etwas erledigen.«
»Ja?«
Meine Frau weiß natürlich genug vom Verlagsleben, um sich darüber im klaren zu sein, daß ein Schriftsteller erst etwas in seinem Verlag zu suchen hat, wenn er sein Werk vorgelegt hat; mit anderen Worten, sie begreift, daß ich ihr einen Vorwand geliefert habe, nur nicht, warum.
»Was ist eigentlich los mit dir, John?«
»Ich brauche einen Tag in der Stadt. Willst du mir das verbieten?«
»Was ist das denn für eine Ausdrucksweise? Ich verbiete dir doch nichts, solange du nicht die Geliebte treffen willst, von der du geredet hast.«
Und als sie das sagt, geht mir auf, daß ich Katrines große Stärke unterschlagen habe, nämlich ihre Erotik. Sie ist die wunderbarste Eva, die der Herr erschaffen hat. Wenn sie einen Mann liebt – und zwar hoffentlich mich –, dann bringt sie zum Ausdruck, daß diese Episode einzigartig ist, ein pures Wunder in ihrem ehrlich gesagt recht farblosen Leben. Und sie macht es auf eine Weise, die mich daran glauben läßt, jedesmal. Ja, ich habe in keiner einzigen Minute in unserer Zeit als Ehepaar, bis daß der Tod uns scheide, auch nur den geringsten Verdacht gehabt, sie könnte mich mit einem gespielten Orgasmus betrügen oder Phantasien zu Hilfe nehmen, die, nach allem, was ich mir angelesen habe, oft das Geheimnis hinter den geschrienen Vorstellungen zu sein scheinen, die Frauen zwischen den Laken hinlegen. Und der Grund, aus dem ich das hier anbringe, wo es nicht hingehört, ist, daß ich genau das denke, als Katrine diese kleine Ironie über meine potentielle Geliebte serviert, meine Frau, die die Kunst beherrscht, drei Wochen lang erotisch tot zu sein, um dann plötzlich zum reinen Johannisfeuer aufzulodern, und das, wie alle verstehen werden, stellt den Verfasser dieser Zeilen, der nur den Einkauf der Zeitung und seiner Tüte Gummibärchen als physische Aktivitäten vorweisen kann, auf eine wahre Mannestumsprobe, denn sie sagt ihren kleinen Satz mit dem neckenden doppelten Boden und dem seligen Blick, die gerne solchen märchenhaften Nächten vorausgehen.
Ich:
»Ich muß nur kurz in die Stadt, Katrine, einfach so ...«
»Das verstehe ich doch. Fahr du nur.«
»Ist das dein Ernst?«
»Natürlich ist das mein Ernst.«
Der Schriftsteller setzt sich, er setzt sich an den Küchentisch, hört, wie sich die Yatzispieler unter dem Balken verabschieden, an dem vor fünfundzwanzig Jahren Kapitän Schou-Nilsen hing, und wie sie das Haus verlassen, das derselbe Schriftsteller in seinem Tran gemietet hat.