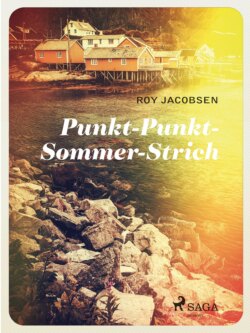Читать книгу Punkt - Punkt - Sommer - Strich - Roy Jacobsen - Страница 6
4
ОглавлениеIn diesem vierten Kapitel sitzt zu Anfang derselbe Schreiberling hinter dem Lenkrad seines sieben Jahre alten Volvo Kombiwagens und schämt sich über den Auftritt von gestern abend. Ich hätte doch einfach sagen können, daß ich in die Stadt fahre, punktum – man ist doch nirgendwo gefangen, weder in der Ehe noch in einem Mietshaus. Aber es ist eben so mit mir, daß ich die geringste Lust, mein Daheim zu verlassen, als Verrat empfinde, auch wenn ich gar nicht vor habe, irgendwen zu betrügen, sondern nur einige Stunden lang durch die Straßen schlendern, Gesichter sehen, in einem Buchladen herumstöbern, in einem Straßencafé ein Mineralwasser trinken möchte ... Ich muß mich gewissermaßen durch irgendeinen krankhaften Zustand retten, mich nahezu zum Genesenden ernennen, der auf eine Weise diese unschuldigen Ausflüge verdient. Und um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, um mich noch mehr zu quälen als unbedingt nötig, hat der Herr diesen Tag mit idiotisch funkelndem Sonnenschein ausgestattet – ja, die Sonne scheint, aber ich fahre trotzdem!
»Natürlich fährst du«, sagt Katrine. Sie hält also mein Gerede vom Regen für puren Quatsch. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste ist, daß ich sie natürlich betrügen werde, nicht so, wie der Leser vermutlich hofft, sondern, indem ich vorhabe, ganz unschuldig in die Universitätsbibliothek zu gehen und Zeitungen vom September 1967 zu lesen. Und warum will ich meine Frau nicht in diese Pläne einweihen? Nun, egal, wie offen wir in diesem Mordfall miteinander umzugehen beschlossen haben, und ungeachtet der Tatsache, daß wir gleich viel oder gleich wenig wissen, so muß jeder neue Schritt in der Entwicklung auf die Goldwaage gelegt werden. Ich kann Katrine einfach keiner Information aussetzen, die sie, wie ich meine, beunruhigen wird. Meine Pflicht, sie zu beschützen, ist natürlich viel grundlegender als schwebende ideologische Begriffe wie »Ehrlichkeit« und »Aufrichtigkeit«. Und deshalb ruht, als Kapitel vier sich dahinschleppt, der Fuß des Schriftstellers fest auf dem Gaspedal, der Tacho liegt bei achtzig, wie es sich hierzulande gehört, und der Arm des Schriftstellers ruht im Fenster. Friede herrscht in dem Zipfel des Königreichs Norwegen, durch das er gleitet, es ist Sommer, und es ist üppig, heiß und bürgerlich. Ich sause über Mosseveien, vorbei an Ulvøya, wo ich als Kind kurzfristig gewohnt habe, vorbei an Malmøya und Bekkelaget, und ich entdecke das große Lagerhaus, das schönste Bauwerk Norwegens, und beschließe noch einmal, an der Sabotage des weiteren Lebens im Norden weiterzuarbeiten.
Dann muß ich einer Menge von neuen Ausfahrten und Tunnels ausweichen und erreiche über einige kleine Umwege die Universitätsbibliothek auf dem Solli Plass. Mineralwasser, Straßencafés, Freunde und Buchläden sind also in den Hintergrund gedrängt worden, denn hier betrete ich das tiefste Gedächtnis der Nation, in dem alle Idiotien, die Norweger im Laufe der Zeit zu Papier gebracht haben, griffbereit versammelt sind. Aber jetzt, wo die Sonne scheint, interessiert die Gegenwart sich nicht für Erinnerungen, zum Glück, denn auf diese Weise bin ich fast allein in der Zeitungsabteilung, nur eine junge Frau, eine Studentin mit Rattenschwänzchen und einer Rockmode, die ich seit satten zwanzig Jahren für ausgestorben hielt, leistet mir Gesellschaft. Sie liest Zeitungen aus den Kriegstagen, während ich mich auf die verschiedenen Lokalzeitungen des Distrikts konzentriere, auf Ausgaben von prähistorischen und längst ausgestorbenen Arten, sowie einige Nummern von Aftenposten.
Sämtliche Publikationen können erzählen, daß in Schweden nunmehr rechts gefahren wird, daß der Schah im Iran vorhat, seine Fahra Diba in allernächster Zukunft krönen zu lassen, daß mein alter Kollege Arthur Omre kürzlich verschieden ist, daß der Vietnamkrieg aufs ärgste wütet. Und fast als kleine Ironie der Geschichte gerade für mich, für den Schriftsteller persönlich, gibt Morgenposten am 2. September 1967 auf der Seite »Vermischtes« eine kleine kommunistische Anekdote zum besten: Der ehemalige russische Fürst Felix Jussulow gibt in Paris auf seinem Sterbebett konspiratorische Interviews, der Mann, der seinerzeit, das heißt, 1916, am russischen Zarenhof den Ränkeschmied Rasputin ermordete und damit einen der größten Betrüger der Geschichte unschädlich machte, ohne selber ebenso berühmt zu werden. Eine Köpenickiade, über die der Verfasser dieser Zeilen in seiner Jugend einst seine Diplomarbeit schreiben wollte, damals, als er noch den Ehrgeiz hatte, Historiker zu werden, was er bald wieder aufgab, als ihm aufging, daß es in diesem Fach darum geht, mangelhafte Bilder von etwas Vergangenem zu rekonstruieren, statt etwas Neues zu schaffen. Außerdem verläßt der, der einmal im Rampenlicht gestanden hat und sich dort behaupten konnte, dieses Rampenlicht nie mehr wieder – freiwillig. So aber sieht der Hintergrund aus, vor dem unser Mann Karsten Schou-Nilsen sich aufhängt. Nun tritt er nämlich in der Fiktion der Zeitungen hervor, am 4. September 1967, kein Selbstmord, kein Name, nur eine unbekannte Leiche in einem Garten in Drøbak, eine mißhandelte Leiche, steht hier – die Zeitungen waren damals zurückhaltender, und die Polizei auch. Sie »rechnen damit, diesen makabren Fund mit einer kriminellen Handlung in Verbindung bringen zu können« (dem Mord?). In den folgenden Tagen, dem 7., 8. und 9. September, werden dieselben spärlichen Informationen wiederholt, nun aber mit dem Namen der Toten (Erna Keilhau), und am Samstag, dem neunten, endet der Artikel mit einigen vagen Formulierungen, man habe es vermutlich mit einer »persönlichen Tragödie« zu tun, was damals bedeutete, daß der Fall bald aus den Zeitungsspalten verschwinden würde. In einer Lokalzeitung finde ich allerdings am zwölften ein großes Bild des Hauses, in dem ich zur Zeit wohne, vor der Restaurierung, begleitet jedoch nur von einer mageren Bildunterschrift und einem dürren, fünf Zentimeter langen Einspalter mit der Prophezeiung, daß wir auf ewig im ungewissen darüber schweben werden, welche Rätsel »sich hier wirklich verbergen. Sie haben ihr Geheimnis mit ins Grab genommen.«
Ich blicke zur Studentin in dem altmodischen Rock hinüber und frage mich, ob sie wohl mehr Glück hat als ich. Es sieht so aus. Sie merkt, daß ich sie ansehe, und hebt den Blick von Aftenposten, senkt ihn dann rasch wieder, und alles, was ich auf den ersten Blick von ihr geglaubt habe, wird durch diese abrupte und abweisende Bewegung bestätigt: Eine einsame Seele, die an einem Tag wie heute in der Bibliothek sitzt, die zur Unzeit fleißig ist, die irgendwo auf dem Land eine Familie und in der Stadt keine gleichaltrigen Bekannten hat ... alle Mängel einer Studentin, die im Jahre 1967 gut meine Freundin hätte sein können, als unsere glühende politische Bewegung Sonderlinge wie sie anzog und ihnen eine Art Zugehörigkeit und einen Sinn des Lebens gab. Was mich wieder nach Drøbak zurückführt, wo die Wahrheit kurz und gut folgende ist: Samstag, 13. Juni 1992. Wir sitzen am Frühstückstisch, auf den uns in unserem Familiensystem zugewiesenen Plätzen, essen und führen unser normales Gespräch:
»Heute springe ich vom Fünfer.«
»Das traust du dich nicht.«
»Tu ich wohl.«
»Nie im Leben.«
Vor fünfundzwanzig Jahren, 1967, als der Verfasser dieser Zeilen jung war, konnte man diesem Dialog ablesen, welches Geschlecht was sagt. Das ist heute auch noch so. Mein Sohn hat nämlich große Probleme mit dem Sprungturm unten im Drøbaksund, er traut sich nicht, ihn so eifrig zu benutzen wie die anderen in seinem Alter, Jungen, die nicht neun lange Jahre hinter dem Polarkreis verschwunden sind. Meine Tochter benutzt den Sprungturm auch nicht, aber für sie ist das kein Problem. Für sie ist ein Problem, daß ihr Badeanzug nicht genauso ist wie die, in die die anderen Fünfzehnjährigen sich einhüllen. Nun hat sie aber doch einen bekommen, der genau ist wie die der anderen, und das macht sie zufrieden und selbstsicher. Meine Frau sagt:
»Warum willst du auf Leben und Tod vom Sprungturm springen?«
»Um den Mädels zu imponieren, ist doch klar«, sagt seine Schwester.
»Ne, gar nich’ deshalb!«
Mutter:
»Und davon lassen sie sich auch gar nicht imponieren.«
»Weiß ich doch.«
Natürlich lügen beide, das sehen wir schon an der einfachen geographischen Lage des Sprungturms; Sprungtürme haben sich während der gesamten Geschichte im Zentrum der menschlichen Aufmerksamkeit befunden. Niemand hat jemals an einer öden Küste oder an einem kleinen Teich einen Sprungturm gebaut, niemand ist auf die Idee verfallen, um die edle Kunst des Springens eine Geheimloge aufzubauen. Nein, das Springen ist auf Zuschauer berechnet, ob man nun ein Profisportler ist oder nur ein hilfloser junger Mann in Ferien. Und deshalb sage ich:
»Das weißt du nicht, mein Junge. Wir wissen beide sehr gut, daß Mädchen sich vom mutigsten Jungen imponieren lassen.«
»So was Blödes hab ich noch nie gehört«, ruft Katrine. »Du warst doch nie besonders mutig!«
Und Vater, der nun zu einer sinnreichen Entlarvung der banalen Rituale des Geschlechtslebens ansetzen wollte, die sich seiner Ansicht nach im Sperrfeuer unserer ganzen Generation von Argumenten, Wunschdenken, »Veränderung«, »Aufklärung«, »Bewußtmachung« usw. gehalten haben, muß sich nun geschlagen geben, nicht, weil ihm ein schlagendes Argument die Flügel gestutzt hat, sondern weil seine Antwort vor den Kindern nicht ohne weiteres vorgetragen werden kann. Es ist nämlich eine Tatsache, daß Katrine sich nicht für mich entschieden hat, weil ich ein vernünftiger Kümmerling bin, der nie seine Grenzen verschoben, und der sich seine ganze Jugend hindurch auf das unterste Brett beschränkt hat, auf den Einer, wo er hingehörte. Nein, ich wurde von Katrine gewählt, weil sie den, der aus den höchsten Höhen sprang, nicht gekriegt hat. Den, der aus den höchsten Höhen sprang, bekam ihre Freundin, die beiden heirateten, und Katrine brach mit ihrer Freundin (»eine oberflächliche Kuh«) und kam wohl gleichzeitig zu einer Art Erkenntnis, daß es weniger Mühe macht, sich mit dem zu bescheiden, was man gratis bekommt. Und diese Gratisperson war ich. Ich war unsterblich in sie verliebt, aber trotzdem konnte ich doch nach einer Weile folgendes aus mir herauspressen:
»Ich weiß, daß du eigentlich nicht mich wolltest, Katrine, sondern ihn. Aber das ist mir scheißegal. Jetzt habe ich dich, und ich lasse dich nie wieder los!«
Das saß. Damit zeigte ich nämlich, daß ich doch über den Mut eines Springers verfügte. Aber diese Überlegung läßt sich hier am Frühstückstisch natürlich nicht verwenden. Deshalb lächele ich bloß dämlich, wie sich das gehört für einen, der gerade in einem Disput verloren hat, und trinke meinen Kaffee, aus der Teetasse, die Katrine vor mich hingestellt hat. Heute mußte ich mir den Kaffee selber einschenken – zwischen uns gibt es nämlich etwas Ungeklärtes: Katrine weiß, daß ich mehr Informationen über den Mord habe als sie, sie weiß, daß ich alte Zeitungen gelesen und daß ich hier am Ort mit der Polizei gesprochen habe. Obwohl das nur ein lockerer Schwatz am Steg war, bei dem es zuerst ums Segeln ging, und der sich bald zur reinen Fachdebatte entwickelte, was Katrine so langweilte, daß sie sich zurückzog. Genau, wie ich geplant hatte, mit der Folge, daß der Polizist und ich zwanzig Minuten lang über den alten Mord plauderten. Erst, als ich ins Restaurant kam und mich an den Tisch setzte, den wir inzwischen bei unseren Spaziergängen durch die Ortsmitte immer belegen, ging Katrine auf, daß sie etwas verpaßt hatte, und daß das ganz allein ihre eigene Schuld war.
»Hat er dir etwas über den Mord erzählt?«
»Nicht viel!«
»John!«
»Nur, daß sie nie herausfinden konnten, wer die Schwägerin umgebracht hat, der Kapitän oder seine Frau, obwohl wir beide auf die Frau tippen und annehmen, der Kapitän habe ihr dann geholfen, das Verbrechen zu vertuschen, unter anderem dadurch, daß die Leiche vergraben wurde.«
»Und wer hat sie zersägt?«
»Vermutlich der Kapitän.«
»Aber warum in aller Welt hat er das getan?«
»Ja, was glaubst du, du liebst doch Kriminalromane? Versuch, dir einen guten Grund auszudenken, warum eine Leiche zersägt werden muß.«
»Die Romane, die mir gefallen, bringen nie ›gute‹ Gründe für so etwas, nur Geisteskrankheit in verschiedenen Varianten.«
»Und wenn ich sage, daß er ein ganz rationelles Motiv dafür hatte, sie zu zersägen, dann sagst du, wir lebten in einer kranken Welt.«
»Genau.«
»Das ist dein Lieblingssatz, meine Liebe.«
»Das macht ihn noch lange nicht falsch.«
»Dann wirst du auch die Erklärung nicht akzeptieren.«
Diese schlagfertige Zurückweisung stürzt sie in ziemliche Verwirrung, und wenn Katrine sich kritisiert fühlt, vergehen gern einige Minuten mit stummen Vorwürfen und etlichen anderen komplizierten Dingen, die zwischen den Eheleuten hin und her wandern, ehe das ursprüngliche Thema wieder aufgegriffen werden kann. Und ehe wir so weit gekommen waren, hatte unsere Tochter sich am Restauranttisch eingefunden, zur verabredeten Zeit, um zusammen mit ihrer Mutter den Einkauf des Badeanzuges zu tätigen, der, wie ich vorhin erwähnt habe, ihr Selbstvertrauen so beruhigend steigern wird; Katrine mußte unverrichteter Dinge den Tisch verlassen.
Am selben Abend griff sie den Faden jedoch wieder auf, und nun erklärte ich ihr, wie es um die Logik des Kapitäns bestellt war, daß die Schwägerin mit Zyanid ermordet worden war, daß er sie in der Mitte durchgesägt hatte, um a) ihren Magen zu entleeren und b) den Eindruck zu erwekken, man habe es mit einem kranken Mörder zu tun, falls sie unwahrscheinlicherweise gefunden würde.
»Und letzteres ist ihm ja ganz gut gelungen«, fügte ich säuerlich hinzu, ehe Katrine mit ihrem »das kann ich einfach nicht glauben« anfangen konnte.
Also sagte sie lieber:
»So etwas durchzuziehen, um den Eindruck zu erwecken, man sei geisteskrank, ist in meinen Augen ein Zeichen dafür, daß man das wirklich ist.«
So sieht man in unseren Kreisen tatsächlich die Welt, jedenfalls das, was uns an ihr nicht gefällt. Wir können es nicht hinnehmen, daß ein Mensch eine rationale Denkweise (unsere eigene) als Motiv für eine Handlung verwendet, die wir entsetzlich finden; dann machen wir aus dem Betreffenden lieber einen Geisteskranken, oder wir erklären kurz und gut die Vernunft für krank. Ich weiß noch, was passiert ist, als ich bei einem Kongreß unserer kleinen exklusiven Partei versuchen wollte, meinen Genossen zu erklären, was aus Napoleon einen genialen Feldherren machte – das ging nicht. Alle waren so damit beschäftigt, sich von allen Taten dieses Mannes zu distanzieren, daß sie sich nicht auf seine Prämissen und seine Logik einlassen konnten. Das istnatürlich gar nicht so unbegreiflich, da ein solches Einlassen – falls es geglückt wäre – eine Bestätigung dafür gewesen wäre, daß sich diese Logik auch irgendwo in diesen emanzipierten Parteigenossen wiederfand, was aber lieber nicht der Fall sein sollte. Aus diesem Grunde wollten sie auch nicht einsehen, daß Maos Militärstrategie – das Beste daran, das einzige Brauchbare sogar – um nichts von der früherer chinesischer Feldherren abwich und daß diese Strategie überraschende Ähnlichkeiten zu der von Clausewitz, Rommel, Guderian aufwies ...
Deshalb verläuft unser nun folgendes Gespräch ungefähr so.
Katrine sagt: »Glaubst du wirklich, diese Handlungsweise verteidigen zu können?«
»Nicht mehr als das, was seine Frau getan hat.«
»Versuch jetzt nicht, dich rauszureden!«
»Ich will mich gar nicht rausreden. Ich will nur sagen, daß ich ohne Probleme verstehen kann, wie er gedacht hat, aber das bedeutet natürlich nicht, daß ich das gutheiße.«
Das ist eines meiner Steckenpferde. Diese Haltung hat mich nämlich immer zu einem lauwarmen Kommunisten gemacht (und deshalb vielleicht zu einem unsterblichen Kommunisten?). Aber noch jetzt, als ich diesen alten Satz ausspreche, den ich ungefähr ebenso oft ausgesprochen habe, wie Katrine ihre Diagnosen verteilt hat, weiß ich, daß ich eine Lüge ausspreche. Ich kann die Taten dieses Mannes nämlich nicht nur verstehen, das heißt: meine eigene Verderbtheit darin erkennen. Ich kann sie sogar voll und ganz akzeptieren, kann sie lobenswert finden, da sie ja dieselbe Art von Moral zum Ausdruck bringen, die meine Loyalität meiner Frau gegenüber bedingt. Oder besser, wo ich doch offenbar so viel an ihr auszusetzen habe: meine Loyalität meinen Kindern gegenüber, dem wichtigsten Teil meines ganzen Lebens! Ich wäre willens, sie genauso zu beschützen, wie der Kapitän seine Frau beschützt hat, in meinen Augen stehen wir hier einem klassischen Beispiel für rührende, unerschütterliche Loyalität gegenüber, dem schönsten Zug der gesamten westlichen Kultur. Aber selbst die Konsequenz dieser Überlegung dringt nicht bis zu mir durch, weil es vorerst an Konsequenz mangelt; weil es hier nur um den Versuch eines Mannes des Wortes geht, der Wirklichkeit zuvorzukommen. Deshalb werde ich nicht erregt, ich werde nur von einer weiteren Dosis theoretischer Langeweile, Übelkeit fast, überwältigt.
»Was ist los, John?« fragt Katrine ängstlich.
»Nichts ...«
Ich wende mich um und sehe alles, was mir an ihr mißfällt, was ich liebe, sehe, daß unsere Beziehung, so, wie sie sich in den letzten fünfzehn Jahren ergeben hat, auf derselben Grundlage beruht, die den Kapitän in den Abgrund gerissen hat, die ihn zum Deckenbalken führte, die ihn dazu brachte, seine Schwägerin zu zersägen. Und der Gedanke, daß auch in denen unter uns, bei denen wir nicht ohne weiteres Störungen annehmen, sondern die Grundbedingungen eines friedlichen normalen Familienlebens als gegeben vermuten können, die Potentiale eines Mörders ruhen – schockiert mich nicht.
Das war gestern abend.
Jetzt ist Samstag und Wirklichkeit. Wir sitzen am Frühstückstisch. Die Kinder sind aufgestanden, sie stellen ihr Geschirr ins Spülbecken und verkünden, sie wollten »mal kurz nach draußen«, mein Sohn wird sich noch einmal am Sprungturm die Zähne ausbeißen, meine Tochter wird ihr Selbstvertrauen in ihrem neuen Badeanzug weiter stärken.
»Und seid vorsichtig. Vater und ich kommen in zwei Stunden nach.«
»Warum denn, um auf uns aufzupassen?«
»Aber nicht doch«, sagt Mutter.
»Doch«, sagt Vater. »Natürlich, um auf euch aufzupassen.«
»Die anderen Eltern machen das alle nicht.«
»Wenn du meinst ...«
»Na gut, aber laßt euch da unten bloß nicht häuslich nieder.«
Als wir endlich allein sind und die Angelegenheit fertig erörtern wollen, die gestern abend nicht fertig erörtert wurde, sage ich:
»Das mit dem Mord vergessen wir jetzt, was?«
»Warum denn?«
»Weil wir die Wahrheit nie erfahren werden. Wir können uns nicht den ganzen Sommer damit verderben, daß wir nach etwas suchen, das es nicht gibt – ich muß einen Roman schreiben.«
Sie zuckt mit den Schultern.
»Na gut, von mir aus. Jan und Bente kommen heute abend übrigens mal vorbei, ich habe sie zum Essen eingeladen.«
»Na, dann kommen wir auf jeden Fall auf andere Gedanken.«
»Worauf denn, zum Beispiel?« lächelt Katrine, meine Liebste, und wir lachen, denn unsere Treffen mit diesem Ehepaar haben uns schon manche blöde Meinungsverschiedenheit eingebrockt. Sie sind die Art von Freunden, die man sein ganzes Leben hat, während man sich immer wieder fragt, ob man nicht bald mit ihnen brechen soll.