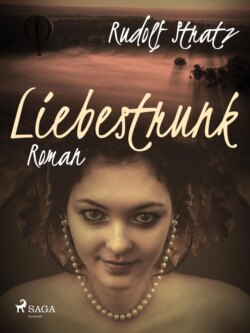Читать книгу Liebestrank - Rudolf Stratz - Страница 5
2
ОглавлениеEinige Zeit nach dem Major von Wingerow verliess auch Gabriele Lünhardt ihr Haus. Sie machte regelmässig in den ersten Nachmittagsstunden einen einsamen Spaziergang in den letzten, zwischen Spreekanal und Neuen See gelegenen Teilen des Tiergartens. Dies Bedürfnis des zeitweiligen Alleinseins mit sich hatte sie immer gehabt, auch während ihrer Ehe. Sie war eigentlich nicht gern in Berlin. Aus dem Gesellschaftstreiben und Nerbengehetze der Weltstadt machte sie sich, in ihrer ruhigen, gleichmütigen Art, nichts. Sie schätzte daran nur die Opern, die Konzerte, die Musikabende daheim, diese künstlerischen Genüsse, die man anderswo nicht haben konnte. Sonst hätte sie lieber auf dem Lande gelebt, in der freien Natur, in die man sich hineindenken, aus der man sich herausnehmen konnte, was gerade der augenblicklichen Seelenstimmung entsprach. Dann war zwischen ihr und der Welt ein Zusammenhang, wie zwischen Bild und Rahmen, so auch jetzt, hier an der Grenze von Häusermeer und Waldstille, im kühlen Hauch des Herbstes.
Sie war gar nicht gedrückt oder erregt. Sie schritt frei und leicht, schlank aufgerichtet ihres Wegs, auf dem sie schon längst jedes Brückchen und jede Bank kannte. Sie liebte dies Gewohnheitsmässige in ihrem Tun. Es war das etwas Philiströses in ihr, über das sie selbst lächelte. Ihr Gesicht war gleichmütig, trotz der ernsten
Aussprache von vorhin. Sie atmete ruhig im raschen Gehen die frische, herbe Luft ein. Sie lebte eigentlich sehr gern, auch nach dem bitteren Verlust, der ihr Dasein geknickt hatte. In diesem war nun wenigstens die Ruhe. Man hatte das Schwerste überstanden. Die Sorgen, Nöte, Kümmernisse, die andere Menschen quälten, lagen endgültig hinter einem, die konnten nicht wiederkehren. Der Tod hatte einen Riegel davor geschoben.
Freilich dachte sie sich auch jetzt wieder ein paarmal: ,Heute bin ich siebenundzwanzig geworden. Für viele fängt da das Leben erst an!‘ Dann schien es ihr selber unwahrscheinlich und unbegreiflich, dass das immer so weitergehen könne. Es musste einmal etwas dazwischen treten. Die Zeit, die noch vor ihr lag, war noch viel zu lang. Aber sie vermochte sich nicht vorzustellen, wie das kommen könnte. Es war nichtig, über Möglichkeiten des Schicksals zu grübeln. Sie gestand sich schliesslich auch ehrlich: ,Ich bin feige geworden! Das Schicksal hat mir zu weh getan! Ich will keine weiteren Berührungen. Ich zittere davor. Ich möchte bleiben, wie ich bin. Schmerzlosigkeit ist auch mir gut.‘
Sie dehnte heute ihren Spaziergang weiter als sonst aus. Es war schon nach vier Uhr, als sie jugendlich frisch, mit geröteten Wangen, von der Luft belebt, in den Vorgarten ihrer Villa trat. Im Hause war zur Rechten der Halle ein Garderobenraum. Da hing zu ihrem Erstaunen ein dickwattierter, dunkler Herrenpaletot, wie man ihn wohl im strengen Winter, aber nicht jetzt im Frühherbst trug. Darüber ein starkes, weissseidenes Cachenez. Ein Paar schwere Gummigaloschen standen am Boden. Welchem Nordpolfahrer gehörte denn das? Es waren doch nur Damen im Hause. Sie frug den Diener, und der erwiderte, verwirrt durch ihren strengen Blick: „Jawohl, gnädige Frau! . . . Der Herr sitzt im blauen Salon!“
„Welcher Herr?“
Der Diener wusste nicht Bescheid. Das Mädchen hatte die Karte angenommen. Sie erschien aus dem Souterrain herauf.
„Der Herr hat bestimmt erklärt, er wäre zur Teezeit bestellt!“ sagte sie verlegen. „Da glaubte ich . . .“
„Durch wen denn bestellt, um Gottes willen?“
„Durch den Herrn Hauptmann Bankholtz. Der habe es ihm heute mittag im Auftrag der gnädigen Frau ausgerichtet . . .“
Die junge Witwe nahm die Karte, die auf dem silbernen Tablett lag. Sie las:
„Werner Freiherr von Ostönne
Plantagendirektor
Deutsch-Ostafrika.“
„Mein Gott . . . hat der Eile!“ sagte sie unwillkürlich vor sich hin. Er musste sich gleich nach dem Frühstück mit ihrem künftigen Schwager umgezogen haben und hierhergefahren sein.
„Richtig! Ich hatte ganz vergessen!“ sagte sie zu dem Diener. „Es stimmt schon! Bitten Sie den Herrn, noch einen Augenblick zu warten!“
Als sie fünf Minuten später mit leichten, auf dem dicken Teppich kaum hörbaren Schritten in den Salon trat, entdeckten ihre schönen, grauen, etwas kurzsichtigen Augen erst nach ein paar Sekunden den Besucher. Er sass, auf ein Taburett geduckt, fröstelnd vor dem Kaminfeuer und rieb sich über der schwachen, eigentlich nur für das Auge bestimmten Kohlenglut die Hände. Wie sie dicht hinter ihm war und er sie im Spiegel sah, sprang er rasch empor und verbeugte sich. Er trug schwarzen Besuchsrock und scharf in die Falte gebügelte taubengraue Beinkleider. Es war alles, wie es sich gehörte. Und doch machte er einen exotischen Eindruck. Sein Gesicht war sonnenbraun, finster, mit einem dunklen Schnurrbart. Von ebensolcher Farbe sein Haar. Gabriele wusste, dass er ungefähr dasselbe Geburtsjahr wie ihr verstorbener Mann haben musste. Aber er sah älter aus. Er war hager gewachsen, mittelgross, mit sehr breiten Schultern und starkem Brustkasten.
„Verzeihung, gnädige Frau!“ sagte er. „Ich fror hier ein wenig. Ich friere immer, seitdem ich in Deutschland bin! . . . Wenn man so lange unter dem Äquator war . . .“
Daher die Wintersachen im Flur! . . . Der Fremde machte nicht viel Umstände. Es schien ihr, als habe er einen beinahe brutalen Zug der Rücksichtslosigkeit um die Lippen. Er gefiel ihr nicht. Aber sie lächelte höflich-kühl und sagte: „Kommen Sie, Herr von Ostönne . . . wir wollen uns recht nahe an das Feuer setzen, damit Sie die Sonne Afrikas nicht zu sehr entbehren! . . . So . . . Sie bekommen auch gleich Tee . . .“
Gabriele Lünhardt hatte, liebenswürdig wie sie von Natur war, leicht etwas in Sprache und Gesichtsausdruck, was wie vertraulich aussah — auch weniger nahen Bekannten gegenüber. Es klang dann, als redete sie mit einem guten Freund, und wurde so aufgefasst, auch wenn sie es gar nicht so meinte. Aber Herr von Ostönne zeigte keine Spur von Verbindlichkeit. Er räusperte sich nur — er war offenbar stark erkältet und vielleicht klang seine Stimme deswegen so rauh, als er kurz sagte: „Danke sehr!“
Dann schwieg er und sah sie unverwandt, sonderbar prüfend an. Sie dachte sich: „Komischer Kauz! . . . Wenn er auch ein früherer Offizier und Freiherr ist — man merkt doch, dass er lange draussen im Urwald war!‘ Sie begann, konventionell, wie eine Dame die Unterhaltung mit einem Besucher einleitet: „Sie sind schon länger zurück, Herr von Ostönne?“
„Seit vorgestern abend!“
„Und da sind Sie gleich zu mir?“
„Ja. Das ist mir sehr wichtig!“
Wieder eine Pause. Sie ärgerte sich über die starre Art, mit der sein Blick an ihr hing.
„Und gedenken Sie lange in Deutschland zu bleiben?“
„Die Frage legt mir jeder hier vor! Die scheint unvermeidlich! . . . Ich kann nur antworten: Ein Vierteljahr wird man mich wohl ertragen müssen! Dann gehe ich wieder hinüber . . .“
Sie war unter seiner Unhöflichkeit zusammengeschreckt. Sie dachte sich: ‚Da hat mein Mann ja einen netten Busenfreund gehabt! Da könnte er nun sehen, wie die Leute drüben verwildern! Er war selber auch schon auf dem Weg dazu, wenn ich ihn nicht zurückgehalten hätte . . .‘ Merklich frostiger frug sie: „Da sind Sie wohl in Geschäften in Berlin?“
„Ja. Ich will mein Plantagenunternehmen vergrössern. Endlich fängt die Geschichte an, zu gehen. Namentlich der Hanfbau schlägt ein!“
„Das ist ja sehr schön!“
Gabriele Lünhardt hatte keine Ahnung, dass in Ostafrika Hanf gedieh. Es interessierte sie nicht im geringsten, was man da drüben trieb. Darum fand sie auch so schwer eine Anknüpfung für ein Gespräch.
„Sie waren von Hause aus Artillerist, sagte mir mein Mann einmal . . .“
„Jawohl!“
„Und dann in der Schutztruppe?“
„Jawohl!“
„Da haben Sie sich dann dem Zivilberuf als Plantagenleiter zugewandt?“
„Jawohl! Vor sieben Jahren . . .“
„Und diese ganze Zeit haben Sie sich keinen Urlaub gegönnt?“
„Nicht eine Stunde, sonst wäre der Karren stecken geblieben! Man muss bei der Stange bleiben, wenn man sich einmal etwas vorgenommen hat!“
Er sagte das sonderbar hart und feindselig und schwieg mit einem kurzen, verächtlichen Achselzucken. Gabriele wusste nicht recht, wem das galt. Der Ärger stieg immer mehr in ihr empor. Wozu war dieser Afrikaner eigentlich gekommen, wenn er nur dasass und sich die Antworten silbenweise herausquetschen liess? Sie wurde nicht klug aus ihm, aber immerhin, diesem einstigen Intimus ihres verstorbenen Mannes war sie jede Rücksicht schuldig. Sie nahm sich zusammen und forschte weiter: „Sie haben wohl eine Menge Bekannte hier?“
„Gott . . . ja . . .“
„Und Angehörige?“
„Meine alte Mutter!“
Es war keine Unterhaltung in Gang zu bringen. Sie versuchte noch einen Anlauf.
„Da sind Sie also immer noch nicht verheiratet, Herr von Ostönne?“
„Nein!“
Nun wusste sie nicht mehr, was mit dem steinernen Gast anfangen. Den schien das Schweigen zwischen ihnen nicht zu stören. Er hing seinen Gedanken nach und sagte endlich: „Ich hab’ jetzt nach Europa zurück müssen! . . .“
„Ihrer Gesundheit wegen?“
„Die ist in Ordnung! . . . Aber es ist hier so dummes Gerede über mich im Umlauf . . . Sie haben jedenfalls auch davon gehört . . .“
Es schwebte Gabriele Lünhardt dunkel vor, dass sie unlängst in einer Zeitung etwas überflogen hatte, was sich auf ihren Besucher bezog. Was, war ihr entfallen. Es hatte sie nicht interessiert.
Er fuhr fort: „Aber ich werde der Bande das Vergnügen versalzen! Alles Schwindel! Dabei acht Jahre her. Damals war Paul noch mit mir in Afrika!“
Paul . . .! Sie sah befremdet auf. Dann begriff sie, dass er ihren Mann meinte. Über den hätten sie überhaupt von vornherein sprechen sollen — sie dachte es sich im stillen — dann wäre ihr Zusammensein nicht so sonderbar feindselig wortkarg ausgefallen. Er war ja das einzige Bindeglied zwischen ihnen beiden. Aber Gabriele Lünhardt hatte nicht von ihm angefangen — aus einer Scheu und Abwehr, die sie jedesmal gegen seine früheren Gefährten überkam. Diese Leute aus Afrika hatten vor ihr sein Leben mit ihm geteilt. Diese Eifersucht war ja grundlos — sie hatte ihn ja schliesslich gehabt — aber trotzdem: es kostete sie immer eine Überwindung . . .
Gerade diesem braungebrannten, ein paarmal rätselhaft und düster vor sich hin lächelnden Mann gegenüber. Sie wusste nicht, was er im Schilde führte. Sie blickte ihn misstrauisch an. Er hatte noch etwas vor. Warum harrte er sonst so stumm und steif auf seinem Sessel aus? Da kam endlich der Tee. Es war eine Erlösung. Sie machte die Tassen zurecht und reichte ihm eine, während der Diener wieder ging. Er führte sie an die Lippen, setzte sie aber sofort wieder ab und frug unvermittelt: „Paul ist hier im Hause gestorben?“
Wieder fühlte sie einen Stich bei dem Wort: Paul. Aber sie zwang sich, freundlich zu antworten.
„Nicht hier, Herr von Ostönne! . . . Er hatte den schrecklichen Fehler begangen, dass er gar nicht auf die ersten bedrohlichen Symptome achtete — er als früherer Arzt! . . . aber er war doch immer so sorglos mit sich, ritt noch aus, obwohl er schon starke Schmerzen hatte. Mittags wurde es ganz schlimm . . . abends brachten wir ihn in die Klinik . . . aber es war zu spät . . .“
Die junge Witwe atmete schwer auf und legte die Hände im Schoss zusammen. „Ich habe Ihnen das übrigens ja alles seinerzeit nach Afrika geschrieben!“ sagte sie.
„Wenigstens das meiste!“
„. . . Also haben Sie den Brief bekommen?“
„Ja. Aber nicht beantwortet! Es gibt Sachen — die kann man nur sagen . . . geschrieben machen sie sich schlecht . . . ich habe lieber damit gewartet, bis mich mein Weg wieder einmal nach Europa herüberführte! Nun war ich ohnedies dabei, um dieser Ehrabschneiderbande, die sich hier gegen mich etabliert hat, das Handwerk zu legen . . .“
Er stellte die Teetasse, die er immer noch unberührt in der Hand hielt, vor sich auf den Tisch. Sie sah etwas Versonnenes, in sich Gekehrtes in seinen schwarzen Augen. Die Wildnis draussen hatte ihn, allein unter seinen Negern, das Schweigen gelehrt. Er hob den Kopf zu dem Bild seines Freundes hinauf. Dann schaute er wieder dessen Witwe an. Und diesmal so kalt und schonungslos, dass es ihr graute. Sie sagte, mit der Selbstbeherrschung einer Frau von Welt: „Man macht sich hinterher natürlich die verzweifeltsten Vorwürfe! Hätte man am Ende doch operieren sollen? . . . Wäre das besser gewesen? . . . Es haben mich ja freilich alle Autoritäten beruhigt. Es wäre doch so gekommen, so oder so . . .“
„Nein — die Ärzte haben ihn nicht umgebracht!“ versetzte Werner von Ostönne.
„Nicht wahr? . . . das sage ich mir auch immer!“ „Sondern Sie selber, gnädige Frau . . .“
Das Teezeug klirrte. Gabriele Lünhardt war jählings aufgesprungen. Sie traute ihren Ohren nicht. Sie starrte ihren Besucher an. War er am Ende wahnsinnig? Hatte er den Tropenkoller von drüben mitgebracht? Ihre erste Regung war, auf den Klingelknopf zu drücken. Aber sie hielt an sich.
„Was sagen Sie?“ frug sie, immer noch atemlos vor Schrecken.
Er war gleichgültig sitzen geblieben.
„Ich sage, dass Paul nicht an irgend solch einer zufälligen, dummen Geschichte gestorben ist, sondern an Ihnen!“
Das kam klar und langsam zwischen seinen wessen Zähnen unter dem dunklen Schnurrbart hervor. Sie trat vor ihm zurück. Sie konnte nur wiederholen: „. . . an mir . . . gestorben . . .? Ich glaube, Sie sind verrückt . . .“
Nun hatte auch er sich erhoben.
„Gott . . . Ich bin’s nicht mehr als andere . . .“ sagte er. „Jedenfalls nicht ärger, als es Paul in seiner letzten Zeit war . . .“
Die junge Witwe fuhr sich mit der Hand über die Augen.
„Ich weiss immer noch nicht, ob ich wache oder träume . . .“ versetzte sie. „Da steht jemand und behauptet mir ins Gesicht, ich hätte . . . bitte . . . Herr von Ostönne . . . dort drüben liegt Ihr Hut . . . wollen Sie ihn sofort nehmen und Ihrem Besuch ein Ende machen . . .“
Er achtete nicht auf ihre Worte, sondern kam auf sie zu.
„Herr von Ostönne . . . Sie haben gehört . . . zwingen Sie mich nicht zu einem Auftritt vor der Dienerschaft . . .“
„Ach . . . lassen Sie doch Ihre Leute unterwegs!“ Er zuckte die Achseln und blieb stehen. „Wenn ich sage ‚umgebracht‘, so meine ich damit natürlich nicht, dass Sie ihm Rattengift in die Suppe getan haben! An die Blinddarmentzündung glaube ich! Aber der Mensch hat auch eine unsterbliche Seele . . . sozusagen sein besseres Teil . . . was hat denn Paul in diesem Hause damit angefangen? Wo ist denn die hier schliesslich geblieben? . . . he?“
Er frug es herausfordernd. Sie bebte am ganzen Leibe vor Empörung.
„Ich begreife nicht, woher Sie den Mut nehmen, so zu mir zu reden! . . . Ich kann nur glauben, dass Sie in den Tropen zuviel an Gesundheit und Erziehung zugesetzt haben. Aber nun ist’s genug!“
Er überhörte das wieder. Er meinte: „Sie bedauerten doch eben, dass ich Ihnen auf Ihren Brief nicht geantwortet habe. Nun bringe ich Ihnen die Antwort persönlich. Die müssen Sie hören. Sie würden ja doch keine Ruhe haben, wenn ich jetzt ginge, ohne weitere Erklärung . . . Sie würden sich hinterher den Kopf darüber zerbrechen! Denn ich glaube wirklich, wie ich Sie jetzt so vor mir sehe: Sie sind ganz ahnungslos! . . . Sie begreifen noch gar nicht, was Sie für eine Schuld auf sich geladen haben . . .“
Vor Gabriele Lünhardt drehte sich das Zimmer im Kreise. Sie konnte kaum herausbringen: „Was haben Sie für ein Recht, so mit mir zu sprechen . . .?“
„Als Pauls Freund! Das war keine Freundschaft, wie wenn sie hier auf der Bierbank Schmollis machen . . . wir haben uns als Männer getroffen . . . draussen . . . wo man bald weiss, was ein Mann wert ist, das war wie eine Blutsbrüderschaft!“
„Und daraus leiten Sie die Mission her, mich nach Jahren hier zu beleidigen?“
Er liess sich nicht beirren.
„Ein Mann ist dazu da, dass er auf der Welt nach aussen hin etwas vor sich bringt! Das wollten wir beide, Schulter an Schulter. Ich hatte mein Leben darauf aufgebaut, nach schweren Enttäuschungen, die mir widerfahren waren. Wir hatten gemeinsam das Stück Urwald in Angriff genommen, aus dem inzwischen meine Plantage entstanden ist. Die Arbeit war viel zu viel für einen einzigen Mann. Es musste sich einer auf den anderen verlassen. Kaum aber hatten wir angefangen, so ging Paul vor sieben Jahren, um mehr Geld aufzutreiben, auf ein Vierteljahr nach Europa, und kam nicht wieder, sondern blieb bei Ihnen. Und ich konnte schauen, wie ich allein mit allem fertig wurde.“
Es war nicht Gabriele Lünhardts Absicht gewesen, überhaupt noch mit ihrem Gast zu sprechen. Sie stand da, zitternd vor Zorn, und wartete nur, bis er zu Ende sein und freiwillig gehen würde. Aber angesichts seiner letzten Ungerechtigkeit konnte sie sich nicht enthalten, zu erwidern: „Hat er sich Ihnen denn etwa verschrieben, mit Leib und Seele? . . . Er hat hier eben Besseres gefunden! . . . Er hat sein Glück gefunden! . . . Es war ein Zufall, dass er und ich uns trafen — aber dann war er auch entschieden! . . . Von da ab gehörte sein Leben mir und nicht mehr Ihnen! Und im übrigen . . . Sie sagten, er habe hier Geld aufbringen sollen! Hat er Ihnen denn nicht reichlich Geldmittel zur Verfügung gestellt, auf meinen eigenen Wunsch?“
„Ich hab’ sie aber nicht genommen! . . .“
„Warum nicht?“
„Weil sie von Ihnen kamen! . . .“
Seine gelassene Todfeindschaft erfüllte sie mit Grauen. Das war ihr noch nie widerfahren im Leben, dass jemand sie so hasste! . . . Sie dachte sich: ,Er wird mir doch nicht plötzlich an die Gurgel springen oder ein Messer hervorziehen? Fähig scheint er zu allem! Und warum ist er denn eigentlich überhaupt hier, wenn er mich so verabscheut? Er muss doch einen Grund haben! . . .ʻ Dann versetzte sie kühl, unwiderruflich dem Gespräch ein Ende zu machen: „Das sind geschehene Dinge. Der Tod ist dazwischen. Wir haben keine Macht mehr, etwas zu ändern! Also beruhigen Sie sich! Sie müssen sich doch selber sagen, dass einem Mann die Frau mehr ist als der Freund. Sie hätten im gleichen Fall genau so gehandelt . . .“
„Ich beklage auch nicht, dass ich meinen Freund verloren habe, sondern dass er sich verloren hat!“
„. . . sich verloren hat!“
„Mit Haut und Haar! Und das darf ein Mann nicht! Er soll schaffen . . . schaffen . . .“
Auf einmal verstärkte er seine bis dahin gedämpfte Stimme: “Aber da lebt ein Herr in Berlin — reitet spazieren — läuft in Gesellschaften — sitzt in der Oper — kurzum, stiehlt unserem Herrgott nach Noten den lieben langen Tag — und das ist Paul Lünhardt — mein Paul Lünhardt, der wirklich einmal etwas Gutes und Nützliches war und tausendmal zu schade dafür, Ihren Schleppträger zu machen . . .“
„Herr von Ostönne! Jetzt ist aber meine Geduld zu Ende! . . .“
„Ein ganzer Kerl war er da drüben! Ein Deutscher von dem Schlag, der uns so bitter nottut . . . und der hält Ihnen nun das Strickgarn!“
„Herr von Ostönne: Sie waren doch früher Offizier! Ich weiss wirklich nicht, wo Sie Ihre Erziehung gelassen haben!“
„Meinetwegen draussen im Vorzimmer. Auf schöne Worte kommt’s jetzt nicht an! . . . Mein armer Paul! . . . Dies verfluchte Drohnenleben! Und nichts dagegen zu machen! Er blieb nun mal hier im warmen Nest. Ich verachte die Leute, die zu was Besserem geboren sind und sich dann von ihrer Frau durchfüttern lassen!“
Sie richtete sich empört auf. „Das . . . das sagen Sie von meinem Mann?“ stammelte sie.
„Ist’s denn nicht wahr? Er hatte nichts . . . seine paar Kröten waren auf den Forschungsreisen draufgegangen und Sie . . .,“ er streifte mit einem spöttischen Rundblick die kostbare Wohnungseinrichtung, “Sie sind doch reich! . . . Sehr sogar! Man sieht’s! Ich hab’s ihm seinerzeit geschrieben: Eine reiche Heirat — das ist der Traum von Barbiergesellen! . . . Ein Mann erwirbt! Der lässt sich nichts schenken!“
„Wenn Sie ihn deswegen verachten, dann haben Sie ihn nie gekannt! Als ob es Berechnung gewesen wäre, dass er mich geheiratet hat, und nicht reinste Liebe . . .“
„Das weiss niemand besser als ich!“
„Nun also! Und Liebe macht glücklich! Und zum Glück sind wir auf der Welt! Und nicht bloss, wie Sie sich einbilden, um unter den Wilden im Urwald zu sitzen!“
„Für einen Mann ist Arbeit Glück, Frau Lünhardt. Und Liebe ist doppeltes Glück für ihn . . .“
„Ja eben!“
„. . . wenn sie ihn in dem fördert, was er ist und soll! Sie aber haben Paul den Boden unter den Füssen weggezogen! Er hat seitdem nicht mehr gewusst, wozu er auf der Welt war. Ob man dann noch zufällig an einer Krankheit stirbt . . . tot ist man schon vorher . . .“ „Herr von Ostönne . . .,“ versetzte die junge Witwe mühsam, „ich glaube, nun haben wir uns wohl alles gesagt — nicht wahr? . . . Sie haben Ihr Herz ausgeschüttet! Das war Ihnen wohl schon lange ein Bedürfnis. Sie haben auch, scheint es, etwas Fieber — ich betrachte Sie als einen Kranken und habe mir von Ihnen Dinge ins Gesicht sagen lassen, die mir noch nie ein Mensch gesagt hat. Aber nun ist’s heraus und ich hoffe, wir sehen uns nicht wieder! Nur um das eine möchte ich Sie bitten, ehe Sie gehen: bemitleiden Sie meinen Mann nicht noch im Grabe! Er hat es nicht nötig! Er hat in der kurzen Spanne Zeit, die uns zusammenzuleben vergönnt war, alles besessen, was er vom Schicksal wollte. Er war sehr glücklich, das dürfen Sie mir glauben.“
Der Plantagendirektor sah sie prüfend an. Dann sagte er kurz: „Frau Lünhardt . . . ich bitte, mich noch einen Moment setzen zu dürfen! Ich bin, wie Sie eben selbst andeuten, von dem Klimawechsel ein wenig mitgenommen. Das lange Stehen strengt mich an!“
Er nahm, ohne eine weitere Erlaubnis von ihr abzuwarten, Platz, dicht neben dem Kamin, und schlug ein Bein über das andere. Die spielenden Flämmchen wetterleuchteten von unten über sein sonnenverbranntes, düsteres Antlitz. Er schaute ihnen eine Weile zerstreut, in sich fröstelnd, zu, dann hob er entschlossen den Kopf.
„Und nun heraus mit der Wahrheit! Und wenn uns das Dach hier über dem Kopf zusammenfällt! Gesagt muss es werden! Sonst hätte ich mir den Weg hierher überhaupt sparen können . . .“
„Was haben Sie denn noch?“ frug Gabriele nervös. Eine neue, unbestimmte Angst vor dem unheimlichen Besucher kam über sie. Es ging ihr durch den Sinn: „Hätte ich nur Bankholtz gesagt, ich wollte ihn gar nicht erst sehen! Aber das konnt’ ich doch nicht . . . ich wusste doch nicht . . . nun ist’s zu spät . . .ʻ
Sie hatte sich nicht gesetzt. Sie war weit von Ostönne am Fenster stehen geblieben. Seine schwarzen Augen verfolgten sie bis dorthin. Es fing allmählich an zu dämmern. Er sagte langsam, jedes Wort betonend: “Sie sind in einem schweren Irrtum befangen, Frau Lünhardt. Sie meinen, Ihr Mann sei mit seinem Schicksal sehr zufrieden gewesen . . .“
„Dazu hatte er allen Grund!“
„Ich aber sage Ihnen: er war in seinen letzten Lebensjahren der unglücklichste Mensch unter Gottes Sonne!“
„Was?“
„Und zu helfen war ihm nicht. Er wollte es ja selbst so! . . . Er war ja weiches Wachs in Ihrer Hand . . . Das war sein Verhängnis, dass er schwächer war als Sie!“
„Ich verstehe Sie nicht!“
“Und das war Ihr schweres, nie wieder gutzumachendes Unrecht, dass Sie Ihre Stärke benutzt haben, um ihn so völlig zu unterdrücken und in eine Welt hinüberzuziehen, in die er so gut gepasst hat, wie ich zum Vortänzer bei Hofe. Wären Sie an seine Seite getreten als Kamerad in seinem Beruf und in seiner Arbeit, weiss Gott: ich hätte Ihnen die Hand geschüttelt und gedankt, und wenn ich zehnmal meinen Freund darüber verloren hätte! Er wäre doch er geblieben! . . . Aber Sie waren blind egoistisch. Sie haben ihn seiner Liebe zu Ihnen geopfert. Und dass er starb, als Sie ihn glücklich so weit hatten, das war die richtige Strafe Gottes . . .“
Es war ein schweres Schweigen. Dann fuhr er fort: „Sie sind eine starke Natur. Eine zu starke! Sie haben den Bogen überspannt! Ihr Mann war unglücklich . . . das wiederhole ich Ihnen! Sie hat er geliebt — o gewiss! . . . viel mehr, als gut war! . . . Aber an sich selber hat er zugleich verzweifelt! . . . Das verträgt auf die Dauer keiner. Daran ist er gestorben! . . .“
Gabriele Lünhardt war sehr bleich geworden.
„Sie kommen da in mein Haus . . . Herr von Ostönne. Sie sagen mir da auf einmal Dinge, die . . . Es ist gerade, als ob Sie nicht zurechnungsfähig wären . . . Nie bin ich oder sonst jemand auf diese Gedanken gekommen . . .“
„Antworten Sie mir einmal die reine Wahrheit, Frau Lünhardt: Hätten Sie Ihren Mann nach Afrika begleitet, wie es jetzt so manche Frauen tun?“
“Dazu taug’ ich nicht! Das wusst’ er auch!“
„Haben Sie je viel mit ihm über seine Pläne, seine Erlebnisse gesprochen?“
„Ich verstehe doch davon nichts!“
„Haben Sie sich je bemüht, seine Freunde in Ihrem Haus um ihn zu versammeln?“
„Ich kann nichts dafür, dass sie weggeblieben sind!“
„Haben Sie ihn also nicht schliesslich äusserlich und innerlich ganz vereinsamt? Denn das war das Ende. Ich weiss es sehr genau, Frau Lünhardt!“
„Von wem?“
„Von Paul selber!“
“Den haben Sie, seit er mich geheiratet hat, bis zu seinem Tode nicht mehr gesehen und gesprochen! . . . Und nun kommen Sie auf einmal und rütteln an den Fundamenten meines Lebens. Denn das ist darauf aufgebaut — auf dieser heiligen Überzeugung — auf diesem Glauben an ein Glück — wenn auch ein verlorenes! In dem Glauben liegt mein Frieden. Sie werden ihn mir nicht nehmen . . .“
„Ich muss!“ sagte der Afrikaner, aufstehend und nach seinem Zylinderhut greifend. „Es ist meine Pflicht. Die Vergeltung dafür, dass Sie sein Leben entzweigeknickt haben wie ein Streichholz!“
Sie warf den Kopf zurück. Jetzt reizte dieser Junggeselle, der sich da nachträglich in ihre Ehe drängte, allmählich ihren Hohn.
„Sie sind zu lange in Afrika geblieben, Herr von Ostönne . . . Sonst würden Sie wissen, dass man solche Dinge nicht ausspricht, ohne sie beweisen zu können!“
„Ich habe Beweise!“
„Was denn?“
„Briefe!“
„Von ihm?“
„Ich werde sie Ihnen schicken!“
Er stand an der Türe. Er wiederholte: “Briefe von ihm, bis zu seinem Todestag!“
Es war, als ob sie ihm etwas erwidern wollte — aber sie schwieg mit einem erschrockenen und hasserfüllten Blick auf ihn. Er gab ihn ihr hart zurück. Auch er blieb stumm. Er verbeugte sich plötzlich und ging.
Es verstrich wohl eine Viertelstunde, ehe Gabriele Lünhardt wieder ganz zu sich kam. Am liebsten hätte sie sich vorgestellt, sie hätte diesen plötzlichen Besuch aus Afrika nur geträumt. Aber er war dagewesen. Sie merkte es an ihrem wilden Herzklopfen. Eine unbestimmte Angst trieb sie durch die Zimmer hin. Die waren alle leer. Nirgends ein Laut. Vor den Fenstern der Herbst. Himmel und Zukunft still. Leise durchfröstelte sie die Angst des Alleinseins, die sie sonst von sich hielt. Sie hatte ja sich! Aber nun wurde sie für einen Augenblick beinahe an sich selber irre.
Ratlos sass und ging sie umher. Sie wollte in das Musikzimmer und drehte wieder um — sie stand vor ihrem Geburtstagstisch und sah leer darüber hin, sie fuhr zusammen, als sie in dem grossen Wandspiegel nebenan eine schöne junge Frau in kupferfarbigem Kleid sah und sich klarmachte, dass sie es sei, die auf einmal nicht mehr Trauer trug . . . Das fehlende Schwarz wurde ihr zum Vorwurf. Sie wehrte sich dagegen. Sie hatte ein gutes Gewissen! Es sollte keiner kommen und ihr das bisschen Harmonie ihres Lebens mutwillig stören. Es konnte es auch keiner! Diesem Herrn von Ostönne hatte die Tropensonne zu heiss auf dem Scheitel geschienen.
Aber die Briefe . . . die Briefe . . .
Sie wollte nicht weiter daran denken. In denen stand wahrscheinlich gar nichts darin — wenn sie überhaupt existierten. Am Ende war das auch nur ein rachsüchtiges Geschwätz dieses Mannes, wie alles andere. Sie setzte sich an den Schreibtisch, um ein paar Geburtstagsglückwünsche zu beantworten — sie nahm ein Buch zur Hand und sprang wieder auf, als habe sie jemand gerufen. Es war wie eine Stimme: . . . die Briefe . . . die Briefe. Es war wie die Stimme ihres Mannes . . .
Schliesslich suchte sie bei ihm selber vor sich Schutz. Am Ende der prunkenden Wohnräume, etwas zurückgelegen, war die Türe zu einem Gartenzimmer. Die öffnete sie selten. Oft monatelang nicht. Jetzt drückte sie die Klinke auf und war mit einem Schritt mitten in Afrika — im Arbeitsstübchen Paul Lünhardts — des einzigen Orts im ganzen Hause, der ihm ganz gehört hatte. Eine schwere, sonderbare Luft brütete darin, die durch alles Fensteröffnen in den letzten Jahren noch nicht vertrieben worden war — von Schiffsknaster, von Kampfer, von mottigen Tierfellen, von Gehörnen an den Wänden, der weissen Knochenmasse eines Elefantenschädels in der Ecke, von zermürbten Lederköchern mit Giftpfeilen, Massaispeeren, Federputz, Zauberkram, von Büchern, Büchern in Menge — ärztlichen Kompendien, Reiseberichten, Atlanten, Globuskugeln, Wandkarten. Alles von einer dichten Staubschicht überzogen. Der Raum war genau so geblieben wie er bei Paul Lünhardts Tode gewesen. Die alten, wurmstichigen paar Möbel aus seiner Junggesellenzeit standen unverrückt. Auf dem Schreibtisch lag noch ein angefangener Brief — die verräucherte Lampe, die dazu geleuchtet hatte, war halbgefüllt wie damals, in den Winkeln am Fenster, hinter den verschabten Plüschvorhängen, woben die Spinnen ihr Netz.
Die junge Witwe atmete in schweren Zügen die seltsame Atmosphäre des totenstillen Raumes ein, dieses Mitteldings von Mausoleum, Studierstube, Schiffskabine und Naturalienkabinett. Sie fühlte sich als Fremde hier. Sie war hier eigentlich immer ein Eindringling gewesen. Sie war fast nur hereingekommen, um ihren Mann zu holen, wenn drüben in den Salons Gäste sassen. Dann hatte er geschimpft und gelacht und sich schliesslich doch aus seiner Höhle, wie sie es nannte, hinüber unter den Lichterkreis des Kronleuchters, unter die schwatzende Gesellschaft ziehen lassen. Jetzt dünkte es ihr auf einmal fraglich, ob sie daran immer recht getan? Er war hier so gern gewesen, hatte sich hier eingeschmökert und eingequalmt, den bescheidenen Kachelofen in der Ecke oft eigenhändig nachgeheizt, um sich nicht erst durch einen der vielen Dienstboten des Hauses in seiner Behaglichkeit stören zu lassen. Das hier war sein Reich — sie hielt sich nie länger als ein paar Minuten darin auf. Man nahm immer den Geruch von kaltem Rauch in Haar und Kleid mit hinaus! Aber sie bereute jetzt doch, dass sie als Witwe nicht öfter hier gewesen war. Sie hätte pietätvoller sein sollen! Sein Bild besass sie drüben überall. Die Spuren seines Eigenlebens hier hatten sie nie gelockt. Diese Schwelle hier war die Grenze gewesen. Von da ab hatte er nicht mehr ihr gehört, sondern Afrika . . . der Vergangenheit . . .
Sie dachte sich: ,Man heiratet doch nicht einen Mann, damit er dort hinübergeht und am Fieber stirbt!ʻ Das war billige Weisheit. Aber es war wahr. Alles war damit entkräftet, was ihr der dunkle Gast an Verwirrung und leiser Reue in Haus und Herz getragen hatte. Und trotzdem blieb das Unbehagen in ihr — die Unruhe. Er hatte noch nicht seine letzten Karten ausgespielt . . . die Briefe . . . die Briefe . . .
Während ihr Auge über den fremdartigen Tand an den Wänden glitt, während sich ihr die muffige Laboratoriumsluft, zum Husten reizend, auf die Lunge legte, frug sie sich wieder: Was mag in den Briefen stehen, die aus dieser Klause übers Meer unter die Palmen gewandert sind?ʻ Bei Lebzeiten Paul Lünhardts hatte sie nie viel gesorgt, was und an wen er schrieb. Jetzt quälte sie auch diese Unterlassungssünde. Etwas wie schlechtes Gewissen. Sie war so nervös, dass selbst das leise, vorsichtige Öffnen der Türe sie erschreckte. Und doch steckte nur ihre Mutter, die Kommerzienrätin, ihr rotes, breites, gutmütig lächelndes Matronengesicht mit dem grossen darüber schaukelnden Federhut durch den Spalt und wunderte sich: „Da bist du, Kind! . . . Ist’s die Möglichkeit . . . Ja — da kann ich dich freilich lange suchen . . .“
Das gab ihr wieder einen Stich ins Herz, dass man sie überall im Hause eher vermutete, als hier in den vier Wänden ihres Mannes, in denen alles noch voll von seinem Wesen, seinem Leben war. „Was hast du denn, Mama?“ frug sie ungeduldig.
„. . . Bankholtz ist schon wieder mit uns zurückgekommen und sitzt drüben mit Gischen! . . . Ist das nicht ein bisschen zu viel für einen Bräutigam?“
„Ach — lass sie doch, Mama!“
„Nun — wenn du meinst . . .“
Frau Weiferling wandte sich zum Gehen. Ihre Tochter folgte ihr in den nächsten Raum und blieb da neben ihr stehen.
„Sage, Mama: du warst ja oft bei uns zu Besuch, solangʻ mein Mann noch lebte . . . was hast du denn eigentlich für einen Eindruck von ihm gehabt? In welcher Geistesverfassung war er . . .“
„Zu mir frech!“ meinte die alte Dame gemütlich. “Die ewigen Schwiegermutterwitze — ich hab’s ihm oft verwiesen! Ich hab’ ihm gesagt: Wenn Sie nichts anderes drüben in Afrika gelernt haben, Paul, als ,Schwiegermutterʻ auf ,Tigerfutterʻ zu reimen . . ., ja . . . dann lachte er gottlos! . . . Na ja . . . ein Schwiegersohn . . . wie sie eben so sind . . . aber der Schlimmste noch nicht!“ schloss sie mütterlich-behaglich, während sie mit Gabriele durch den grossen Saal ging.
Dort kam ihnen eilig die jüngere Schwester entgegen. „Walter muss doppelkohlensaures Natron haben!“ meldete sie aufgeregt von ihrem Bräutigam. „Denkt mal . . . er hat mit einem Freund gefrühstückt — einem Herrn von Ostönne . . . und der hat ihn in eine wahre Räuberhöhle verschleppt! Ein Frass . . . sagt er . . . er liegt ihm jetzt noch wie Blei im Magen . . .“
Die Kommerzienrätin murmelte nur etwas Missbilligendes und rauschte weiter, in ihre Gemächer. Gabriele hielt die andere fest.
„Du, Gise . . .“ sagte sie ernst.
„Lass mich jetzt doch . . .“
„Ach . . . dein Walter wird nicht gleich sterben . . . hör mal . . . erinnere dich doch an den Winter vor drei Jahren, wo du bei uns hier in Berlin warst und zum erstenmal ausgegangen bist . . .“
„Na ja . . . und?“
„Was hältst du davon: in welcher Stimmung war damals mein Mann?“
„Na . . . ulkig . . . jedenfalls zu mir . . .“
„Nicht wahr, ulkig? . . .“ sagte die junge Witwe mit einem seltsamen, schwachen Lächeln.
„Ich war manchmal wütend, wenn er einen am Ohr zu fassen kriegte und meinte: ,Schaut mal . . . das Püppchen will schon tanzen gehen! . . .ʻ“
„Siehst du . . . wenn man so dumme Spässe macht, dann ist man doch nicht traurig!“
„Traurig . . .? Der Onkel Paul . . .?“ Die Kleine lachte. „Der war doch immer so furchtbar komisch! . . . Na . . . aber nun muss ich nach dem Natron sehen . . .“
Sie lief davon. Gabriele Lünhardt trat in das Besuchszimmer, wo der Hauptmann Bankholtz bei ihrem Nahen aufsprang.
„Ostönne wollte gleich nach dem Frühstück zu Ihnen kommen, Schwägerin!“ sagte er. „War er schon da?“
„Ja.“
„Ich hab’ gute Lust, dem Kerl noch nachträglich meine Sekundanten zu schicken! . . . Dieser Mittagstisch . . . ja . . . ihm ist’s gleich! Er frisst Kieselsteine und merkt’s nicht! Ein furchtbar abgehärteter Mensch.“
„Ein furchtbar harter Mensch!“
„Dafür gilt er. Es ist nicht gut mit ihm Kirschen essen!“
„Und doch hat er Sie und meinen verstorbenen Mann und viele andere zu Freunden!“
„Ja . . . Er ist aber doch ein ganzer Kerl! . . . Donnerwetter ja . . . Respekt! . . . Was hat er sich da drüben aus dem Nichts geschaffen, in den letzten fünf, sechs Jahren. Da muss man selber alter Afrikaner sein, um die kolossale Arbeit zu würdigen! Und ganz allein! Keiner hat ihm geholfen . . .“
Sie zuckte zusammen.
„Soll das etwa eine Anspielung darauf sein, Schwager, dass mein Mann nicht wieder zu ihm hinüber ist?“
„Herrgott . . . warum denn auf einmal so heftig? . . . Das geht doch mich nichts an!“
„Aber Sie haben doch beide gut gekannt — meinen Mann und jenen. Sie waren mit Paul noch wenige Stunden vor seinem Tod zusammen!“
„Ja gewiss . . .“
„Haben Sie . . . Hand aufs Herz . . . die Frage ist mir furchtbar wichtig — haben Sie je an ihm bemerkt, dass ihm etwas gefehlt hat — dadurch, dass er Afrika aufgegeben hat?“
Der Hauptmann der Schutztruppe lachte etwas gezwungen.
„Da müssen Sie nicht gerade mich fragen! . . . Ich gehöre doch auch sozusagen zum Bau — wenn auch nur als ein Africanus minor!“
„Aber ich will es wissen . . .“
„Wie kommen Sie denn überhaupt darauf . . .?“
„Herr von Ostönne war eben hier und hat in seiner brüsken Art so rätselhafte Andeutungen gemacht . . .“
Das frische, rotwangige Gesicht ihres künftigen Schwagers wurde plötzlich sehr ernst. Ein Schatten von Misstrauen und Zurückhaltung erschien darauf.
„Ich weiss nicht, wie viel Ostönne erzählt hat!“ sagte er. „Da will ich lieber schweigen. Ich will mein Wort nicht verletzen!“
„Ein Wort?“
„Ja!“
„Wem haben Sie das gegeben?“
„Ihrem Mann!“
„Wann?“
„Ganz kurz, bevor er starb!“
Gabriele Lünhardt sah ihn ungläubig an. Das alte Bangen überrieselte sie. Da war wieder das Gespenst von vorhin. Zweifel krochen aus den Winkeln — geheimste Dinge, die sie nicht kannte und nur die andern wussten! Grosser Gott — sie konnte doch nicht blind die ganze Zeit einhergegangen sein! Sie stand stumm vor Schrecken. Ihre Schwester kehrte, ein Schächtelchen schwingend, zurück. „Walter . . . schwör mir!“ schrie sie schon von weitem, „dass du nie wieder ausser dem Hause Fischmayonnaise isst!“
Die junge Witwe drehte sich rasch um und ging und liess die beiden allein. Sie wusste: sie erfuhr von Bankholtz vorläufig doch nichts mehr. An einem Offizierswort war nicht zu rütteln. Der Schwager schwieg. Ihr Herz schlug heftig, in unbestimmter Angst, als sei ihr heute etwas in ihrem Leben zerstört worden . . . oder würde noch zerstört . . . etwas Dunkles stieg herauf . . . die Briefe . . . die Briefe . . .