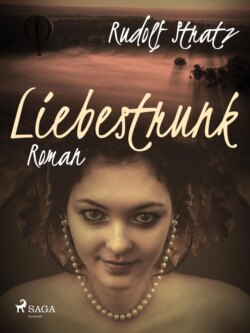Читать книгу Liebestrank - Rudolf Stratz - Страница 7
4
Оглавление„Mein lieber alter Werner!
„Ich hab’ hier in Berlin im Tiergarten ein schönes Haus. Aber davon gehört mir nur ein kleines, räucheriges Zimmer. In dem bin ich mit meinen Junggesellenmöbeln und Raritäten eingesargt — ich selber, glaub’ ich, die Hauptrarität — ein Afrikareisender an der Strippe, ein Kerl, der längst nichts mehr durchquert als den Potsdamer Platz — und sitze des Abends und schreibe bei der stillen Lampe an Dich.
„Das heisst: still ist es bei uns nie. Meine Frau hat drüben Gäste. Sie musizieren. In ganz schweren Fällen — Parsifal und so — haben sie sogar eine Harfe. Gewöhnlich begraben sie aber den Siegfried. Sie begraben den Siegfried jetzt beinahe täglich. Es ist eine Vorübung für Bayreuth. Dort verzapfen sie dies Jahr den ,Ring‘. Wenn Du Nibelungenring sagst, bist Du ein Banause. Dann sehen mich unsere Gäste mit einem Blick voll Mitleid und Verachtung an. Sie tun das freilich immer. Sie wissen nicht recht, wozu ich auf der Welt bin. Ich, im Vertrauen gesagt, auch nicht.
„Jedenfalls bin ich an solchen verschärften Musikabenden drüben überflüssig. Ich weiss nie: ist das nun der Sang an Ägir oder der Trauermarsch aus der Götterdämmerung? Bei mir ist die Gebrauchsanweisung verloren gegangen. Was fängt man nun an?
Totschlagen kann man mich nicht! Also Stallfütterung bis an das selige Ende. Jawohl, mein Lieber: ,Hier ruht Paul Lünhardt. Möge ihm Berlin leicht sein!ʻ Aber in Frieden schlafen kann er nicht. Dazu machen sie zu viel Spektakel da drüben. Dreimal in der Woche. Die anderen Abende ist meine Frau im Konzert oder übernachtet im Opernhaus. Ich soupiere dann mit meiner Schwiegermutter. Ja, da lachen bei Dir die Affen auf den Bäumen. Aber es ist so!
„Und ich liebe meine Frau . . . ich liebe sie . . . liebe sie . . . Sie hat mich auch sehr gern! — Sie ist schöner, als ich Dir sagen kann . . . sie ist ein Traum . . . sie ist ein Rausch . . . ein Licht . . . in das flattert die Motte . . . verbrennt sich, das unkluge Biest. Warum? Sie muss. Ich muss auch . . . Es ist komisch: Eine Zeitlang lenkt man sein Leben. Alles geht gut. Plötzlich kommt ’ne Faust von oben und stopft einen gerade in den Winkel der Welt, in den man im hitzigsten Fieber nicht gehört. Da bleibt man nun bis Sankt Nimmermehr! . . .
„Und das Drolligste ist das Problem: Wie kann derselbe Mensch in derselben Stunde glücklich und unglücklich zugleich sein? Ich bringe das Kunststück jeden Tag fertig. Ich möchte jauchzen und mir dabei eine Kugel vor den Kopf schiessen. Ich vergöttere meine Frau und bin mir selber ein Greuel. Das hält sich die Wage. Aber das Zünglein daran senkt sich doch in letzter Zeit bedenklich auf die Minusseite. Man muss das Leben humoristisch auffassen. Sonst kommt man über all den Unsinn nicht hinweg.
„Eben singt meine Frau! Sie hat eine wundervolle, starke Stimme. Die klingt aus der Entfernung wie ein gewaltiges, seelenloses Instrument. Es ist ein Naturlaut ohne Trauer und Gnade. Ein Triumph! Dann stütz’ ich hier den Kopf in die Hand und denke an die Zeit, als es noch keine Liebe und dafür einen Paul Lünhardt auf der Welt gab . . . sonderbarer Tausch . . . wenn man sich hergibt, kann man doch eigentlich nichts dafür einhandeln . . . das sind nun so Mitternachtsgedanken . . .
„Und meine Frau singt! Sie hat dabei etwas Fanatisches, Freudiges, Grausames im Gesicht. Ihre Augen glänzen. Sie lebt erst, wenn der Siegfried stirbt . . .
„Die anderen machen dazu einen Höllenlärm im Orchester. Der Cellist, ein kleines, langhaariges Scheusal, für den ich Luft bin, kratzt wie besessen auf seinen Schafsdärmen. Ich stelle mir das hier so vor. Selber bin ich drüben überflüssiger als der bescheidenste Notenständer oder das Kerzenlicht auf dem Klimperkasten — — und bin einsam und bin in einer niederträchtigen Stimmung zwischen Lachen und Heulen, mein alter Schwede! Weisst du, warum?
„Vorhin hab’ ich mein Fenster aufgemacht. Das geht nach dem Garten. Die frische Luft kam in meine Knasterbude. Weit dahinten liegt der Zoologische Garten. In dem brüllten die Löwen durch die Nacht. Auch aus Langerweile und Ärger über das faule Leben in Berlin W, genau wie ich. Brüllten, was sie konnten. Brüllten mir in die Ohren, wie das Jüngste Gericht. Ich wollte, sie brüllten bis in das Musikzimmer Gabrieles, mitten in das Bayreuther Treiben hinein. Die haben dort freilich die Fenster zu. Die sind taub. Aber mir war es, als frugen mich die langmähnigen Burschen: ,Paul Lünhardt . . . was hast du aus dir gemacht? . . . Wie soll das werden?ʻ
„Und jetzt spielen sie wieder drüben den Siegfried-Totenmarsch. Da begraben sie mich, mit allem Pomp. Sie tuten mich zu Tod. Dabei spaziert man immer noch herum, als wäre nichts geschehen! . . . Kerl . . . mir kommen wahrhaftig die Tränen . . . ich liebe meine Frau mehr als mich selber . . . verstehst Du mich? . . . leb wohl! . . .“
Gabriele Lünhardts schönes Antlitz war wie versteinert. Sie fuhr sich mit der Hand über Augen und Scheitel, als ob sie zu träumen fürchtete. Dann legte sie den Brief langsam zu dem Päckchen anderer, das ihr heute früh die Post gebracht, in einem Umschlag, der sonst kein Begleitschreiben Werner von Ostönnes, keine Erklärung enthielt. Sie sass in ihrem Boudoir. Sie hatte es noch nicht verlassen, noch mit keinem Menschen gesprochen, obwohl es schon später Vormittag war. Sie konnte nicht. Draussen war der Herbsttag wie vor vier Jahren, als die inzwischen verwelkte Hand ihres Mannes diese Zeilen da vor ihr geschrieben. Und andere mehr. Sie hatte schon die meisten Briefe gelesen, mit ungläubigem Herzen, mit einem Schwindel, als öffnete sich der Boden unter ihren Füssen, dieser Boden, auf dem sie bisher so ruhig und selbstsicher gewandelt. War denn das möglich? . . . War ihr Mann so als Fremder neben ihr hergegangen? Es entsetzte sie viel weniger, dass er in Spott und Ernst mit seinem Schicksal haderte, als dass er sie so sah — dass er für all dies Höhere und Eigene in ihrem Leben nur die Resignation eines gezähmten Wilden übrig hatte. Das hatte er ihr nie zu zeigen gewagt. Er hatte sich gehütet. Er wusste: dann wäre Entfremdung zwischen ihnen die Folge gewesen. Wenn er auch nicht musikalisch war, so hatte sie ihm doch das ahnende, nachfühlende Verständnis der Liebe für das zugetraut, was für sie den Inbegriff ihrer Persönlichkeit bedeutete. Wenn sie sich darin getäuscht hatte — grosser Gott — was war sie ihm denn dann eigentlich gewesen? . . .
Sie stand auf und schichtete mit bebenden Fingern die vergilbten Blätter zu einem losen Stoss aufeinander. Im Kamin drüben flackerte das Feuer. Hinein damit, mit diesen Zeichen der Vergangenheit. Sie sollten nicht aufstehen, nachträglich, und wider das Glück zeugen, das sie doch besessen, das sie doch gegeben hatte, dessen Abglanz jetzt noch über ihrem Haupte leuchtete. Aber auf halbem Wege blieb sie stehen. Sie fühlte: Wenn sie auch diese Briefe — die schon gelesenen und die paar letzten, noch nicht gelesenen — den Flammen preisgab — sie wirkten doch fort! Sie liessen sich nicht mehr aus der Welt schaffen. Der Zweifel an allem blieb, wuchs gerade, wenn seine Unterlage zerstört war.
So kehrte sie um und setzte sich wieder. Ja — das waren die kleinen, kritzeligen Schriftzüge ihres Mannes. Er hatte eine Gelehrtenhand. Er war solch eine echte deutsche Mischung von Denker, Abenteurer und altem Korpsburschen gewesen — ein Mann, der beim Abhäuten eines Löwen über den Buddhismus plaudern konnte und dabei tiefe Züge aus der Flasche mit Tropenbier tat . . . sie hatte das alles an ihm gekannt — ihn ganz zu verstehen geglaubt, auch da, wohin sie ihm nicht folgen konnte. Und er? . . . Wieder frug sie sich in ihrer Verstörung: ,Wenn er das nicht auch tat, wie ich — das an mir ehrte, was er nicht begriff — was hat er dann an mir geliebt? . . .ʻ
Es waren nur noch zwei Briefe da, die sie nicht kannte. Sie nahm in einem jähen Entschluss den oberen zur Hand. Sie las:
„Werner!
„Ich sollte Dir nicht schreiben! . . . Ich bin ein Gram vor Deinen Augen. Beruhige Dich: vor meinen noch viel mehr! . . . Dies Gefühl allgemeiner Elendigkeit wächst unaufhaltsam in mir. Seit meinem letzten Brief ist es riesengross geworden — steigt mir nächstens über den Kopf. So sende ich diese Zeilen ins Leere. Drüben überm Meer finden sie den einzigen Menschen, der mich versteht . . .
„Werner . . . nun weiss ich, was heue ist, in all meiner Liebe. Wehe den heillosen Leuten, die sich selber einsperren und dann den Schlüssel zum Fenster hinauswerfen. So einer bin ich! Hinterher rüttelt er an den Stäben . . . geschehen ist geschehen . . .
„Und die Freiheit so nahe . . . so verflucht nahe . . . man setzt sich aufs Schiff . . . man fährt durch unsern guten Suezkanal, den wir schon so oft sachte entlanggegondelt sind — im Roten Meer beginnt schon die andere Welt — die Fische fliegen — das Wasser über den Korallenklippen ist smaragdgrün . . . ist milchweiss und purpurrot — ich hab’ mich immer gewundert, wo unser Herrgott all die Farben für seine Palette in diesem Erdenwinkel hernimmt — und drüben leuchtet der Schnee des Sinai . . . und dann die langen Wellen des Indischen Ozeans . . . die ersten Kokospalmen über der Brandung . . . Es ist ja wirklich nur ein Katzensprung zu Euch hinüber . . .
„Ich will Dir verraten: Ich war letzte Woche entschlossen, diesen Sprung zu machen. Mein Koffer war gepackt. Passage belegt. Alles zur Flucht bereit. Ich wollte heimlich fort. Weg wie ein Dieb aus meinem Glück, von meiner geliebten Frau. Sie durfte natürlich nichts ahnen. Ich hab’ mich mit blutendem Herzen verstellt, die ganze Zeit. Sie merkte auch nichts. Ich glaube, sie merkt nie etwas, was in mir vorgeht. Ihr gibt unsere Ehe keine Probleme auf! Für sie bin ich ein humoristischer Mensch der besseren Stände, der sie liebt — der immer guter Laune ist, wenn er sie sieht, und rasend stolz darauf, sich an ihrer Seite zeigen zu dürfen. Voilà tout! Alles in schönster Ordnung! . . . Die grosse Sehnsucht . . . die kennt sie nicht . . . wenn sie auch mit Vorliebe sehnsüchtige Lieder singt . . .
„Ich aber hatte mir gesagt: Jetzt oder nie! Man muss sich losreissen! Es liegt im Menschen auch ein Wille zum Leiden, — eine Naturnotwendigkeit, ohne die man sich nicht ganz zu sich selbst entwickelt . . . ach . . . lieber Werner . . . dies letzte Beisammensein des Abends, vor Tisch! Ich hatte sie schon lange nicht so vergnügt gesehen . . . sie ging auf und ab, in ihrer langen Schleppe, mit blossen Schultern, Diamanten im Haar . . . sie war schön . . . schön . . . Und kramte geschäftig mit ihren Noten. Wir erwarteten Gäste — irgendein ganz besonderes Tier aus Bayreuth oder Buxtehude . . . ausser ihm nur noch drei, vier Auserwählte . . . aus dem ganz engsten Sang- und Klimperkreis. Und plötzlich kommt die Nachricht: ,Der grosse Mann hat Schnupfen! Kommt heute nicht! Vielleicht — übermorgen!ʻ . . . Telephon, Rohrpost, Diener nach allen Richtungen, um auch die anderen abzubestellen! Meine Frau und ich waren den Abend allein. Um zehn sah ich auf die Uhr. Da ging mein Zug. Da wusst’ ich: Das war die entscheidende Stunde meines Lebens. Die letzte. Sie kommt nicht wieder. Ich habe nicht mehr die Kraft dazu. Das Schicksal ist stärker. Es drückt mich hier platt auf den Boden. Hier bleib’ ich! Und habe meine letzte Selbstachtung verloren! Und verzehre mich an ihr. Sie trinkt mir das Blut aus dem Herzen und ahnt es nicht . . . weiss der Himmel, was schliesslich aus mir wird . . .“
Es klopfte. Der Diener meldete, dass das zweite Frühstück angerichtet sei. Die junge Witwe erhob sich und ging hinüber zu ihrer Mutter und Schwester, die schon am Tisch sassen. Es war ihr äusserlich nichts anzumerken. Sie war nur sehr still. Die beiden anderen Damen achteten nicht darauf. Sie redeten eifrig miteinander über den grossen Kolonialbasar, der in nächster Zeit in Berlin stattfinden sollte. Es war da unter anderen eine Bude geplant, in der Gisela und ihre Freundinnen allerhand Kuriositäten aus dem dunklen Erdteil, Waffen, Schmuck, Fetische verkaufen würden. Auch ihre Schwester hatte versprochen, sich zu beteiligen. Sie wollte ja jetzt wieder unter Menschen. Dies Fest war für sie, die Witwe eines Afrikareisenden, die beste Gelegenheit. Da wirkte sie in seinem Sinn, obwohl es ihr an sich völlig gleich war, ob drüben im Innern der Kolonie irgendwo ein Erholungsheim für Europäer gegründet wurde oder nicht. Sie fuhr zusammen, als Fräulein Weiferling zu ihr sagte: „Du . . . Gabriele . . . in nächster Zeit müssen wir mal anfangen, das Zeug drüben aus Pauls Zimmer, was du zum Basar stiften willst, von der Wand zu nehmen und zu putzen. Es ist alles grässlich verstaubt und vermottet!“
Das waren die afrikanischen Trophäen des verstorbenen Hausherrn. Die junge Witwe schwieg. Ihre Mutter versetzte: „Ich würde an deiner Stelle das Zimmer intakt lassen! Ich finde es ein wenig pietätlos, so mit den Erinnerungen an deinen Mann aufzuräumen. Das sind doch schliesslich die Sinnzeichen seines Lebens!“ . . .
Gabriele hob nervös den Kopf.
„Seines Lebens vor mir! An diesen Dingen habe ich nie teil gehabt!“ . . .
So sprach sie. Aber in ihr zitterte — zum erstenmal — ein Schrecken: ,ich hab’ daran so wenig teil gehabt, wie er an meinem Dasein! Aber was war denn dann eigentlich für ein Bund zwischen uns?ʻ
Die Kommerzienrätin meinte, gutmütig einlenkend — sie war dick und behaglich und liebte keinen Streit: „Nun ja . . . dann mach in Gottes Namen mit dem Krimskrams, was du willst!“
Zugleich sprang Gabriele Lünhardt plötzlich, von einer inneren Angst getrieben, auf, noch ehe der Nachtisch aufgetragen war. Sie nahm sich kaum die Zeit, den anderen flüchtig zuzunicken, und eilte wieder hinüber in ihr Zimmer. Dort griff sie hastig nach dem letzten der Briefe. Sie überflog ihn. Sie las bebend, mitten aus dem Zusammenhang heraus:
„Weisst Du denn überhaupt, Werner, was Weltschmerz ist? Grimmiger, bis auf die Knochen gehender Weltschmerz? Und so des Lebens letzte Weisheit? Sein Schluss? Sein Trugschluss? Nein — keinen blassen Schimmer hast Du davon, mein Gutester! Du bist in solchen Sachen ein ungebildeter Bursche! Mehr fürs Teeblätter zupfen und faule Nigger fuchteln. Ich aber bin eigentlich ein reich angelegter Kerl — zu weit auslaufend — zu tausenderlei zu gebrauchen — und soll immer nur ihr Mann sein . . . immer nur ihr Mann . . .
„Ich bin ein philosophischer Kopf — besonders wenn es mir schief geht! Ich grüble die ganze Zeit darüber nach: darf der Mensch seinem Dasein ein Ende machen, weil er zu glücklich ist? . . . glücklich wider sich selbst und darum vor Reue der unglücklichste Mensch unter der Sonne? Eine Doktorfrage . . . nicht? Ich wollte sie neulich praktisch lösen. Ich habe noch allerhand Giftpfeile und ähnliches Zeug von meinen Expeditionen hier an der Wand. Sie sind vermuffelt wie alles um mich. Aber trotzdem: ein Ritz an meiner Pulsader . . . Bester! wo sind alle Zweifel . . .?
„Lieber Freund . . . ich schreibe Dir . . . also lebe ich noch . . . werde leben . . . werde so alt werden wie der selige Methusalem . . . mit meiner zähen Konstitution . . . ich kann nicht hinüber in das fremde Land — ich kann ebensowenig zu Dir hinüber in Dein Land. Ich liebe sie zu sehr . . .
„Rache, Du alter Esel . . . Rache der Natur: Ich habe mein besseres Teil verkauft! Nicht um ein Linsengericht, nein, um die Liebe . . . Ich bin zwiespältig geworden von Kopf bis zu Fuss. Ein Doppelwesen. Der Mensch von heute frisst in mir den von gestern auf. Und dieser letztere war doch ich! Sein Widersacher aber geht herum und ist guter Dinge und tut, als wäre er ich selber. Was soll nun mit mir geschehen? Soll ich als meine eigene Verleugnung hier vor den Philistern paradieren? Mit offenen Augen! Ich muss wohl so elendiglich versumpfen. Ich kann den Zerstörungsprozess an mir so gut sich langsam entwickeln sehen, wie ich als Arzt früher eine Krankheit erkannte. Eine entsetzliche Perspektive! . . . Ich habe ja freilich Den kleinen schwarzen Giftpfeil an der Wand . . . Sollte es einmal geschehen, dann weisst Du, warum es geschehen ist! . . . dann wäre das die erste Stunde gewesen, wo ich mich mehr geliebt hab’ als sie — und die Stunde wird nie kommen . . .“
Gabriele Lünhardt sass, die Hände im Schoss, mit halboffenem Mund. Lange konnte sie gar nichts denken. Es war ihr, als sei das Haus eingestürzt und der Himmel dazu. Irgend etwas war geschehen, was alles bisher Gewesene aufhob. Es war unmöglich, sich da zurechtzufinden. Nur der eine Gedanke hämmerte sich immer tiefer in ihr Hirn: ,Er war so unglücklich neben dir, dass er sein Leben an deiner Seite verflucht hat! . . . Er war so unglücklich neben dir, dass er verzweifelt weg wollte, in die weite Welt hinaus! . . . Er war so unglücklich neben dir, dass ihm das Nichtsein besser dünkte als das Sein! . . . Wie hast du ihn trotzdem glücklich machen können, blind wie ihr gegeneinander wart? Die ihn glücklich machte, warst nicht du!‘
Dann war ihre Ehe ja ein einziges, furchtbares Missverständnis gewesen. Draussen im Vorsaal klangen Schritte. Die junge Witwe fuhr auf. Sie hatte eine Todesangst, dass jetzt jemand kommen könne, um sie mit irgendeiner alltäglichen Frage zu stören. Hastig, wie in der Furcht, auf einem Verbrechen ertappt zu werden, verschloss sie die Briefe. Die durfte niemand sehen. Dann stand sie auf und überlegte: Was nun? . . . Nichts! Der diese Zeilen geschrieben, war ja lange tot. Alles war zu Ende. Nichts rief die Vergangenheit zurück . . .
Nur jetzt keine Menschen! Es war die Zeit ihres gewohnten einsamen Spaziergangs. Sie kleidete sich selber an. Sie eilte durch den Tiergarten dahin, als sei ihr ein Feind auf den Fersen. Dann machte sie halt, in einem jähen Schrecken: was war das nur? Es kam über Nacht. Es warf alles über den Haufen. Wieder frug sie sich: ,Wenn diese Briefe ihn widerspiegeln, was war ich ihm dann? . . .‘ Und dachte sich im Weitergehen: ,Er sagt in diesen Beichten doch immer nur, dass ich schön sei! Das weiss ich. Das haben mir schon viele gesagt. Wenn er nicht mehr in mir gesehen hat . . . nicht gewusst hat, wie viel mehr ich bin . . .‘
Bei dieser Vorstellung rückte das Bild ihres Mannes von ihr hinweg, in die Ferne. In die feine, durchsonnte, silbern-klare Herbstluft hinaus, die ihre weissen Fäden um Baum und Strauch spann. Es war, als ob seine Züge sich leise, langsam veränderten — verschwammen. Sie erschrak von neuem. Das durfte sie doch nicht verlieren! Das war ja ihr Halt im Leben. Aber so rasch sie auch ging — es wich von ihr zurück. Es liess sich nicht mehr fassen, mit aller ihrer Liebe und mit allem Zorn.
Schlechtes Gewissen? In ihrem Leben hatte sie es nicht gekannt. Sie war mit sich ausserordentlich zufrieden gewesen und hatte es von den anderen als etwas Selbstverständliches verlangt, dass sie es auch seien. Nun war da ein Stocken des Herzschlags: ,So rächt es sich, wenn man seinen Nächsten sich zum Gleichnis macht‘ . . . Sie wollte es sich nicht eingestehen, aber sie musste es: ,Ich hab’ in ihm mich selbst geliebt! . . . Er sollte so sein, wie er mich ergänzte! . . . Mit dem Besten und Schwächsten in ihm, seiner Liebe zu mir, habe ich ihn dazu gezwungen. Und gerade dadurch blieb ich ihm fremd . . .‘
Während sie unit gesenktem Kopfe des Weges schritt, gestand sie sich: ,Und er mir fremd! Auch in ihm war mehr! Ich hab’ es nicht entdeckt. Ich war viel zu sehr mit mir selber beschäftigt. Ich hab’ es nicht gesehen, dass ein Mensch neben mir, an mir zugrunde ging — ein Mensch, den ich doch liebte wie keinen anderen auf der Welt . .
,. . . Und der mich noch viel mehr liebgehabt hat. Denn ich hätte das Opfer meiner ganzen Persönlichkeit nicht bringen können, wie er es tat . . . Und dies Opfer war umsonst! Für ihn und für mich.‘
Das wurde in ihr zu einer mitleidlosen Klarheit. Gabriele Lünhardt wusste auf einmal mit verzweifeltem Bangen: ,Vor drei Jahren habe ich meinen Mann begraben! — Verloren hab’ ich ihn heute! . . .‘
Erschüttert und erschöpft kam sie nach Hause. Da war alles wie sonst. Die beiden Damen ausgegangen. Niemand zu sehen. Die Stille war ihr unerträglich. Es bebte in ihr. Was sollte nun werden? Es konnte doch nicht so weitergehen. Sie konnte nicht schweigend diesen tödlichen Schlag tragen und lächeln und nach aussen tun, als sei nichts geschehen! Sie musste sich dagegen wehren! Es gab nur einen Menschen, an den sie sich zu klammern vermochte. In der Halle lag noch die Visitenkarte des Freiherrn von Ostönne — zuoberst in der silbernen Schale. Seine Berliner Adresse stand darauf. Die junge Witwe warf blindlings, mit zitternder Hand ein paar Zeilen auf einen Bogen.
„Ich habe die Briefe erhalten. Ich muss Sie durchaus noch einmal sprechen. Sofort. Ich werde zu Hause bleiben und Sie empfangen, wann Sie auch kommen!
Gabriele Lünhardt.“
Als sie den Diener mit dem Schreiben weggeschickt hatte, wurde es ihr in Erwartung eines kommenden Kampfes freier ums Herz. Es war ihr, als stritten sie beide um die Leiche ihres Mannes, seine Frau und sein Freund. Aber er sollte den Sieg nicht haben! Noch nie war sie einem Menschen unterlegen. Erregt schritt sie in ihrem Zimmer auf und nieder. Sie konnte nirgends ruhig bleiben. Sie suchte etwas und sagte sich mit zuckenden Lippen: ,Ich suche meinen Mann und finde ihn nicht. Nach seinem Tod war er hier überall. Jetzt, wo er noch einmal aus dem Leben zu mir sprach, ging er aus dem Hause.‘
Sie setzte sich unruhig an ihren Flügel, ihre Zuflucht in aller Not. Das war, wie wenn andere beteten. Sie hielt die Augen halb geschlossen. Sie wusste kaum, was das für Töne waren, die ihren schmalen, weissen Fingern entquollen. Es war dasselbe wie gestern — das Klagende, das Rätselhafte: Was weckst du der Wala Schlaf? . . .
Tief unter der Erde wohnen die Nornen — liegen die Toten — ist die Ruhe . . . Wehe, wenn die Abgründe sprechen — die letzten Geheimnisse sich enthüllen . . . es klang ihr düster in die Ohren, wie von einer fremden, fernen Stimme, voll Verzweiflung über das eigene Wissen und Weh. Gnade dem, dem zu viel Erkenntnis ward unter der Sonne . . .
Sie liess die Hände von den Tasten sinken. Die Saiten seufzten und verklangen. Ihr Blick fiel durch die offene Türe auf die Photographie ihres Mannes an der Wand gegenüber. Auf einmal verstand sie diesen Zug um die Lippen — dies sonderbare, stille, ironische Lächeln. Der machte sich nicht über die anderen lustig, der spottete seiner selbst: ,Schwachheit, dein Name ist Mann!‘ und schwieg . . . schwieg im Leben und im Tod . . . bis auf die heutige Stunde.
Ihre Augen waren trocken. Sie konnte nicht weinen. Sie war viel zu entsetzt. Ihr war, als ringe sie um ihr ganzes Sein gegen einen unsichtbaren Feind. Nein! Nicht unsichtbar. Er war da! . . . Man konnte ihn fassen. Sie atmete auf. Sie hörte, wie draussen in der Halle jemand mit dem Mädchen sprach. Das war der Freiherr von Ostönne. Sie wartete nicht erst, bis er sich anmelden liess. Sie öffnete selbst die Türe ihres Zimmers und sagte aus trockener Rehle in den Vorplatz hinaus: „Bitte, kommen Sie nur!“
Werner von Ostönne trat ein. Er hielt den Zylinder in der Hand und trug den langen schwarzen Gehrock wie gestern. Sein sonnengebräuntes Antlitz war ebenso gleichgültig und fest. Seine schwarzen Augen prüften sie mit einem raschen, kalten Blick. Er verbeugte sich.
„Sie wünschten mich noch einmal zu sprechen?“
Sie bot ihm keinen Stuhl an. Sie stand vor ihm im Zimmer.
„Ja. Ich habe Ihnen noch etwas zu sagen!“
„Ich stehe zu Diensten!“
Plötzlich war es mit ihrer Selbstbeherrschung vorbei. Es rang sich ihr leidenschaftlich über die Lippen. Es war ihr eine Erlösung, das aussprechen zu dürfen.
„Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie sich niedrig und verräterisch benommen haben, dass Sie dies . . . dies da an mich abgesandt haben!“
Auf seinem Gesicht zuckte Keine Muskel. Er erwiderte nur: „Hüten Sie Ihre Worte, Frau Lünhardt!“
„Nein! Das tu’ ich nicht! . . . Ich sag’ Ihnen die Wahrheit! So handelt kein Ehrenmann . . .“
„Frau Lünhardt . . .“
„Ich war so glücklich mit meinem Mann! Ich war noch so glücklich in der Erinnerung an ihn! Welches Mass von Bosheit gehört dazu, mir auch das noch zu rauben!“
„Bitte, hören Sie mich . . .“
„Ein anderer hätte sich an Ihrer Stelle gesagt: ,Und wenn es zehnmal eine Täuschung ist — diese Täuschung ist ihre ganze Seligkeit, tut keinem Menschen weh — gibt ihr und denen um sie Frieden und Ruhe . . . Wozu dies arme bisschen Schleier zerreissen? Für sie ist’s ja so viel . . .‘ Aber Ihrer Rachsucht war damit nicht gedient! Ach, schweigen Sie! Ich weiss, dass es nur Rachsucht war! Sie bilden sich ein, ich hätte Ihnen Ihren Freund genommen . . . Sie waren mein Todfeind von jeher. Nun haben Sie die Gelegenheit benutzt, mich hinterrücks zu treffen. Es ist Ihnen gelungen — aber Ihre Ehre ging dabei in die Brüche, Herr von Ostönne! Man gibt nicht Briefe preis, die einem im tiefsten Vertrauen geschrieben sind! Solche Geheimnisse sind heilig! Die mussten mit Ihnen ins Grab sinken, wenn Sie ein Ehrenmann waren . . .“
„Ich bitte, mich jetzt endlich sprechen zu lassen . . .“
„Sie waren doch Offizier! Trugen den Degen an der Seite! . . . Ich begreife es nicht, wie Sie noch vor mir stehen können und mir ins Gesicht sehen . . .“
„. . . Weil alle Ihre Anschuldigungen grundlos sind, Frau Lünhardt!“
„Grundlos! Da liegen doch die Briefe meines Mannes!“
„Sie liegen da auf seinen eigenen Wunsch!“
„Was?“
„In seinem letzten Brief an mich, am Tage vor seinem Tode, hat er mir ausdrücklich aufgetragen . . .“
Sie unterbrach ihn, wild auflachend.
„Da hab’ ich Sie schon! Es ist nicht wahr! Am Tage vor seinem Tode war er nicht mehr imstande zu schreiben! Das weiss ich besser als Sie!“
„Ich habe auch nicht gesagt, dass er selbst geschrieben hat. Er hat die paar Zeilen diktiert. Darum legte ich sie nicht bei — weil sie nicht von seiner Hand sind . . .“
„Wem hat er sie diktiert?“
„Dem Hauptmann Bankholtz, der hat sie mir auf seinen Wunsch damals geschickt, noch am gleichen Tage!“
„Wo sind sie?“
„Hier!“
Er zog einen zerknitterten Brief hervor und reichte ihn ihr. Sie erkannte die Handschrift ihres künftigen Schwagers. Das Schreiben war kurz, eine Stelle am Schluss mit Bleistift angestrichen. Sie las:
„Es ist zu Ende, alter Kerl! Der liebe Gott benötigt mich dringend da oben und meint es so, wahrscheinlich mit mir am besten! . . . Ich muss mich eilen . . . Ich kann kaum mehr. Meine Frau ist auf eine halbe Stunde fort — zum Arzt. Da hab’ ich schnell Bankholtz kommen lassen. Also höre: Wenn ich hinüber bin und all der faule Zauber mit Begräbnis und Beileid vorbei, dann schicke meiner Frau sofort alle meine Briefe an Dich. Aber so, dass sie sie sicher bekommt! Ich will es! Wenn man mit einem Bein schon hinüber ist, dann möchte man die Lügen des Lebens hinter sich ganz zerstören! Drum muss es sein! Wie ich sie geliebt hab’, das weiss sie! Was ich um sie gelitten hab’, das soll sie erst nach meinem Tode erfahren . . .“
Gabrieles Hand, die das Schreiben hielt, sank langsam nieder.
Werner von Ostönne versetzte: „Sie sehen, Frau Lünhardt: in dem Brief steht: ,sofort!‘ Trotzdem habe ich drei Jahre lang gezögert und mit mir gekämpft, ob ich es tun soll! Aber wie ich nun hier herüberkam, wurde das Verantwortlichkeitsgefühl in mir zu stark. Ich habe noch ein Letztes getan. Ich habe vorgestern mit Bankholtz darüber gesprochen. Er erklärte mir: ,Du hast kein Recht, diese Briefe zurückzuhalten, die dich nichts angehen, sondern sein Verhältnis zu seiner Frau betreffen. Du bist da lediglich der Vollstrecker eines Testaments!‘ . . . Sie sagen, Frau Lünhardt: ,Schweigen ist heilig!‘ Aber der letzte Wille eines Sterbenden ist noch heiliger! Den hab’ ich erfüllt, wenn auch mit schweren Herzen, und dabei gleich auch meine eigene Meinung mit herausgesagt. Das letztere war wohl unnötig! Das verzeihen Sie mir!“
„Warum haben Sie mir diesen Brief nicht gleich gezeigt?“
„Ich hab’ es gestern in der Erregung vergessen! Ich wusste kaum mehr, was ich sprach und tat.“
Es war eine tiefe Stille zwischen beiden. Dann versetzte Gabriele: „Sie waren doch froh, sich an mir rächen zu können . . .“
Er zuckte die Achseln und schwieg.
Sie wandte sich ab. Sie murmelte: „Aber er hat es selbst so gewollt! . . .“
„Er hat es gewollt . . .“
Draussen vor dem Fenster wiegte sich das bunte Herbstlaub im Sonnenschein, der blaue Himmel lugte hindurch. Gabriele Lünhardt stand in der Helle am Fenster, von ihrem Besucher abgewandt. Sie rang mit sich. Endlich sagte sie kaum hörbar zwischen den zusammengepressten Lippen: „Wenn dem so ist, dann kann ich Ihnen allerdings keine Vorwürfe machen! Betrachten Sie, bitte, meine verletzenden Worte von vorhin als ungesprochen!“
„Ich habe sie nie anders aufgenommen, Frau Lünhardt!“
Sie ging an ihren Schreibtisch, raffte die vergilbten Briefe zu einem Päckchen zusammen und hielt es ihm hin.
„Ich danke Ihnen!“ sagte sie kalt. „Ich habe nun gelesen, was ich lesen sollte. Ursprünglich waren Sie der Adressat! Also nehmen Sie Ihr Eigentum zurück!“
Er zögerte.
„Ich weiss nicht, ob es mein Eigentum ist, Frau Lünhardt! Ich hab’ seit Jahren das Gefühl gehabt, als ob ich etwas Fremdes unterschlüge — etwas, das Ihnen allein auf der Welt gehört!“
„Aber ich behalte diese Briefe nicht!“
Bittere Verzweiflung zuckte auf ihrem Gesicht. Sie hatte die Hand immer noch ausgestreckt. Da nahm er die Blätter.
„Was sie tun sollten, haben sie ja nun erfüllt . . . ,“ sagte er. „Nach seinem Vermächtnis! Ich war nur das Werkzeug! Das einzige, was ich von mir aus tun kann, ist das!“
Er warf den Stoss engbeschriebener Bogen in das Feuer des Kamins. Die spielenden Flämmchen haschten gierig nach dem seidendünnen Tropenpapier. Eine blaue Lohe schlug auf, flackerte und erlosch. Gabriele stand stumm daneben. Endlich, als das letzte Blatt verkohlt war, versetzte sie: „Das war vergebliche Mühe!“
Er drehte fragend den Kopf.
Sie fuhr fort: „Das verbrennt doch nicht! Das bleibt! . . .“
Er zuckte die Achseln. Er erwiderte nichts. Er wartete einige Sekunden, ob sie ihm noch etwas zu sagen habe. Es lag viel auf ihren Lippen, aber sie schwieg. Sie sah ihn wie hasserfüllt an. Da nahm er seinen Hut vom Stuhl, verbeugte sich stumm und verliess das Zimmer.
Sie hatte kaum merklich das schöne, aschblonde Haupt geneigt. Nun war sie allein. Da draussen ging ihr Besucher durch den Vorgarten, die Strasse entlang, mit gleichmässigen Schritten, ohne sich umzusehen, wie einer, der von der Blutrache kommt. Er hatte sein Opfer gestreckt. Im Herzen fühlte sie den Stoss . . .
Und dabei doch aufrecht umherwandeln zu können . . . es war unheimlich, wie viel ein Mensch ertrug . . . dieser Schrecken . . . dieser grenzenlose Schrecken . . . Alles so anders, als man gedacht . . . An den Wänden hingen die Bilder ihres Mannes. Sie vermied es, sie anzusehen, während sie halb geistesabwesend durch die Zimmer schritt, den Stimmen zu, die sie aus den Empfangsräumen vernahm. Der Hauptmann Bankholtz sass da — er benutzte sein Recht als Bräutigam, um mindestens zweimal täglich vorzusprechen — und stritt sich mit seiner Verlobten. Wenn man sah, wie sie sich leidenschaftlich das Wort abschnitten, fassunglos die Hände gegeneinander rangen, gottergeben beim Widerspruch des anderen zum Himmel aufsehend, so konnte man glauben, es handelte sich um Tod und Leben. Dabei waren es immer nur Dummheiten. Küsse das Ende. Sie massen spielend ihre Kräfte aneinander, in diesen flüchtigen Regen- und Hagelböen vor der Ehe, hinter denen gleich wieder die Sonne schien . . .
Und Gabriele Lünhardt dachte sich mit einem versteinerten Lächeln: ,Ja — ihr werdet glücklich! . . . Ihr richtet euch jetzt schon aufeinander ein! . . . Ihr verarmt nicht aneinander. Ihr treibt nicht Raubbau am Nächsten . . . ‘
Bei ihrem Eintritt fuhren die beiden Köpfe, die eben wieder einmal Versöhnung feierten, blitzschnell nach rechts und links. Der Südwestafrikaner bemühte sich, ein unbefangenes Gesicht zu machen. Er stand auf und lächelte harmlos. Dabei war er rot geworden und Gisela auch. Die junge Witwe sah es und sagte kurz: „Gott . . . Kinder . . . habt euch doch nicht! . . .“
Es war ihr selber merkwürdig, dass sie sich so ganz in ihrem äusseren Menschen verwandeln konnte. Der Hauptmann Bankholtz lachte über sein gesundes, gutmütiges Gesicht und beteuerte: „Schwägerin . . . Sie müssen mal dem Gischen gehörig den Kopf waschen! Sie ist grässlich eigensinnig!“
Und Fräulein Weiferling rief dagegen, schon an der Türe: „Er ist der Bock! . . . Aber wart nur!“
Damit lief sie davon. Zur Mutter. Mit der hatte sie jetzt immer endlose geheime Beratungen wegen der Aussteuer. Die ganzen Räume im oberen Stockwerk lagen voll Wäsche und Stoffproben. Die beiden anderen blieben allein zurück. Nun wurde der Hauptmann sofort ernst.
„Na . . . Ostönne war eben wieder da!“ sagte er.
Sie glaubte etwas aus seinen Worten herauszuhören. Natürlich . . . er war ja mit im Bunde gewesen . . . Furchtbar, wie alle diese Leute hatten schweigen können! Jahre wie Jahre . . .
Aber Bankholtz fuhr ahnungslos fort, auf das Morgenblatt deutend, das auf dem Tisch lag: „. . . War wohl grimmiger Laune . . . der alte, tüchtige Ostönne?“
„Wieso?“
„Na . . . haben Sie nicht heute früh in der Zeitung gelesen . . . diese Kolonialgeschichte!“
Sie verneinte. Sie interessierte sich nur für die Konzert- und Opernnachrichten.
„Sie rücken ihm höllisch auf die Bude! Sie wärmen den ältesten afrikanischen Kohl auf. An der Spitze der Konsul a. D. Fliesen. Ja, solche Feinde hat sich Ostönne massenhaft gemacht — ganz unnötig — nur durch seine schroffe Art . . .“
Der Hauptmann Bankholtz sah noch einmal in die Zeitung und schüttelte missbilligend den Kopf.
„. . . Na . . . wenn sie auf dieser Ostönneschen Expedition die Gefangenen umgebracht haben sollen . . . einschliesslich Weiber und Kinder . . . erstens: ich war nicht dabei — der Esel, der Fliesen, und sein Anhang von Küstenbummlern noch weniger . . . kein Mensch . . . zweitens: die Geschichte ist gut zehn Jahre her — also — wer weiss, ob daran ein Jota wahr ist? Und ist’s Verleumdung, so freut das nur die Engländer, die dann mal wieder ordentlich in Scheinheiligkeit machen können . . .“
Die junge Witwe hatte nicht zugehört. Diese Negergeschichten waren ihr völlig gleichgültig. „Ich muss einmal über etwas sehr Ernstes mit Ihnen reden, Schwager?“ sagte sie unvermittelt. „Am Tag vor seinem Tod hat, wie ich eben höre, mein Mann Sie zu sich holen lassen, während ich weg war, und Ihnen einen Brief an Herrn von Ostönne diktiert . . . nein . . . lassen Sie . . . das weiss ich schon alles . . . aber was ich wissen möchte . . . hat er auch mit Ihnen darüber gesprochen? . . . hat er etwa auch Ihnen etwas Besonderes an mich aufgetragen?“
Der Schutztruppenoffizier sah sie forschend an und überlegte. Dann verneinte er. Sie drängte weiter.
„Aber, was ist damals sonst geschehen? Erzählen Sie!“
„Anfangs, wie ich eintrat, nichts! Er warf sich hin und her. Ich beugte mich über ihn und frug ihn: ,Kann ich etwas für Sie tun?‘ da sagte er mühsam — und hatte die Augen weit offen: ,Soll ich? . . . soll ich nicht?‘ . . . Ich hab’ nicht geantwortet . . . ich wusste ja nicht, was er meinte . . . Auf einmal hat er sich aufgerichtet und angstvoll gerufen, so, als fürchtete er, er käme zu spät: ,Es muss sein . . . setzen Sie sich, Bankholtz . . . schreiben Sie!‘ Da hab’ ich geschrieben . . .“
„Er war also bei klarem Bewusstsein?“
„Ja. Den Eindruck hatte ich. Daraus habe ich auch Ostönne gegenüber kein Hehl gemacht, als ich jetzt mit ihm sprach . . .“
„Aber gegen mich haben Sie geschwiegen.“
„Ich werde mich hüten und mich in Dinge mischen, die mich nichts angehen!“ sagte der Hauptmann ehrlich. „Ostönne war der Empfänger des Briefes. Das war etwas anderes! Der tat jetzt nur seine Pflicht, wenn er . . .“
„Aus Hass tat er’s . . . aus Hass gegen mich! . . . Ich möchte nur eines . . . ich möchte ihn hier tot zu meinen Füssen sehen!“
„Um Gottes willen!“
„Sie sagen, er hat hier Feinde! Hoffentlich sind sie stärker als er! Hoffentlich erliegt er! Kann ich gar nichts dazu beitragen? . . . Gibt es kein Mittel, Schwager? . . . Dann verraten Sie es mir! . . . Ich wäre Ihnen so dankbar . . .“
„Kommen Sie doch zu sich! Das ist ja schrecklich. Man könnte sich vor Ihnen fürchten!“
„Ach . . . ihr steckt alle unter einer Decke!“ sagte Gabriele Lünhardt, plötzlich wieder verächtlich-ruhig geworden. „Also gut! Ich danke Ihnen für Ihre Auskunft!“
Sie ging hinüber in ihre eigenen Räume. Sie wiederholte sich dabei: ,Sein letzter Wunsch und Wille auf Erden war ein Giftpfeil gegen mich! Dabei hat er mich geliebt, wie nur eine Frau auf Erden geliebt werden kann. Wer löst dies Rätsel? Und wer hilft mir . . .?‘
In ihrem kleinen Zimmer, vor dem Diwan, blieb sie stehen. Sie konnte sich nicht mehr aufrecht halten. Sie stürzte hin und brach in heisse Tränen aus . . .