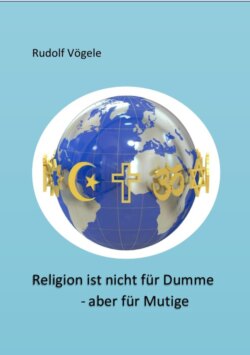Читать книгу Religion ist nicht für Dumme - aber für Mutige - Rudolf Vögele - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Welt, in der wir leben
ОглавлениеEs gibt genug Wissenschaftler*innen, die viel besser und umfassender beschreiben können, was die Welt ausmacht, in der wir heute leben. Aber ich wage zu bezweifeln, dass dies einem Gegenwartsanalytiker oder einer Gegenwartsanalytikerin gelingt. Es sind und bleiben immer nur Fragmente, Momentaufnahmen aus einer ganz bestimmten Richtung. Deshalb möchte ich hier auch nur einen eher persönlichen Spot auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte richten, der sicher nicht alles zeigt, aber beleuchtet, worauf es mir ankommt.
Als wir 1998 in der römisch-katholischen Pfarrei, in der wir als Familie seit 1993 leben, einen «Eine-Welt-Kreis» gründeten und eine Partnerschaft mit einer Pfarrei in den peruanischen Anden eingingen, hatten wir uns zunächst immer wieder dagegen zu wehren, das wir nicht als «Missionskreis» oder «Dritte-Welt-Kreis» tituliert wurden. Unsere Idee und unser Ziel war primär, gestützt auf die Partnerschaft des Bistums mit dem Land Peru, das Bewusstsein für diese «Eine Welt» und die Verantwortung füreinander zu stärken, egal auf welcher Halbkugel wir zuhause sind. Wir wollten einen Beitrag dazu leisten, dass die Erkenntnis wächst, dass wir, so unterschiedlich unsere Kulturen auch sind, viel voneinander lernen können. Und das hat nichts mit ‹missionieren› im landläufigen Sinn oder mit ‹Opfergaben› für die armen Leute im Amazonasgebiet zu tun.
Dieser Eine-Welt-Kreis besteht immer noch. Aber unsere großen Ziele mussten wir – wie viele andere Kreise dieser Art – mehr und mehr zurücknehmen. Durch das Internet hatten wir zunehmend die Möglichkeit, schnell und unkompliziert mit unserer Partnergemeinde in Soritor in Kontakt zu kommen. Aber umso mehr Kontakte wir miteinander hatten, umso mehr wurde auch deutlich, dass die Erwartungen unserer Partnerinnen und Partner ganz anders waren: sie wollten, dass wir vom angeblich ‹reichen› Deutschland aus ihre Projekte wie den Comedor [die Armenküche] oder die medizinische Versorgung alter Menschen der Pfarrei finanzieren. Eine gemeinsame Spiritualität zu entwickeln, daran hatten weder sie noch einer der vier Pfarrer, die wir seither erlebten, Interesse.
Für mich ist dies ein klassisches Beispiel dafür, dass wir wirtschaftlich, kommunikativ und touristisch in den vergangenen Jahrzehnten sehr eng miteinander verwoben sind und noch enger miteinander vernetzt sein werden. Aber kulturell, spirituell oder auch religiös differenzieren wir uns immer mehr. Menschen übernehmen nicht mehr einfach so den Glauben ihrer Eltern, sondern suchen (wenn überhaupt) ihren eigenen. Sie docken dort an, wo sie sich in einer Gemeinschaft am ehesten ‹aufgehoben› fühlen, aber dies meisten Falls auch nur phasenweise. In meiner eigenen Kirche, der römisch-katholischen, zeigt sich dies deutlich daran, dass die bisherige Territorialstruktur mehr und mehr an Bedeutung verloren hat. Menschen, die (noch) auf der Suche sind nach spirituellem Halt und nach Gemeinschaft, nehmen auch längere Wegstrecken auf sich, um bei dem Priester oder in der christlichen Gemeinde mitzuleben oder sich zu engagieren, der oder die ihrem ‹spirituellen Geschmack› am meisten entspricht. Und das ist auch gut so. Wer unbedingt am Pfarrei- oder Kirchgemeindeprinzip festhalten will, hat wohl die letzten Jahrzehnte verschlafen.
Heikel oder sogar gefährlich wird es dann, wenn sich so eine spirituelle Gemeinschaft abschottet, zur ‹Sekte› wird in dem Sinn, dass sie für sich in Anspruch nimmt, exklusiv den ‹wahren Glauben›, die Wahrheit zu leben. Und das passiert heute mehr denn je. Leitende solcher religiösen Gruppierungen verstehen ihre ‹Hirtenaufgabe› nicht darin, sich als ein Mosaikstein in einer weltumspannenden Religiosität zu sehen und Bezüge bzw. Beziehungen zu anderen zu pflegen. Vielmehr verkündigen sie ihren Glauben in einem anachronistischen Sinn – als ob der Weg zum Heil nur durch sie und nur mit der Übernahme ihrer eigenen Überzeugungen möglich wäre.
Am Beispiel der römisch-katholische Obrigkeit, die mir halt einfach am nächsten steht: auch diese schottet sich vom Mainstream der Gesellschaft ab und verspielt dadurch ihre Autorität, dass sie sich, offenkundig vehement und biblisch kaum begründbar, gegenüber längst fälligen Reformen verweigert, die eine Gleichberechtigung von Mann und Frau, eine Demokratisierung oder Gewaltenteilung ihres Systems, die Akzeptanz unterschiedlich sexueller Orientierungen usw. fordern. Abgesehen davon ist es auch sektiererisch, wenn Bischöfe bis hin zum Papst viel zu spät auf sexuellen und spirituellen Missbrauch in ihren eigenen Reihen reagieren und bis heute nichts Erkennbares unternehmen, diese systemischen Probleme anzugehen. Vielmehr schotten sich die ‹Soutaneträger› vom gemeinen Volk ab und bilden mit den wenig Verbliebenen eine «Sekte vom heiligen Rest». Immer weniger Menschen aber, die in dieser rauen und komplexen Welt mit der Endlichkeit ihres Daseins und Soseins fertig werden müssen, erwarten von einer solchen Kirchenleitung noch wegweisende Impulse. Sehr klar und drastisch hat dies der Präventionsbeauftragte des Bistums Chur, Stefan Loppacher, zum Ausdruck gebracht:
«Es gibt in der Kirche sehr viel letztgültige Entscheidungsgewalt in den Händen von wenigen Einzelpersonen, welche niemandem Rechenschaft über ihr Handeln ablegen müssen. Oft fehlt bei der Besetzung von Schlüsselstellen ein realer Bezug zur dafür erforderlichen Kompetenz. Die Ausübung von Macht ist komplett von echter und einforderbarer Verantwortung entkoppelt; absurderweise gerade in einer Institution, welche der ganzen Welt vorschreiben will, wie gutes Menschsein geht. Wie viel der bloße Bezug auf Moral, Jüngstes Gericht und Eigenverantwortung tatsächlich gebracht hat, zeigt der Scherbenhaufen, vor dem wir stehen: Personen, welche im Namen Gottes und durch kirchliche Autoritäten legitimiert aufgetreten sind, haben Abertausenden von Mitchristen unermessliches Leid zugefügt und ihre Existenz in vielen Fällen irreversibel zerstört. Ohne Rechenschaftspflicht für Menschen in Führungspositionen bleiben ihre Untergebenen, tendenziell wehrlos, der Willkür ausgeliefert.» (Schweizerische Kirchenzeitung 06/2020)
Noch deutlicher formuliert dies der Jesuit Hans Zollner, Mitglied der päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen und Leiter des Kinderschutz-Zentrums, im Interview mit kath.ch am 19. Januar 2021:
«Eine Institution wie die katholische Kirche ist über Jahrtausende gewachsen, es haben sich Subsysteme gebildet, die Missbrauch ermöglicht oder zur Vertuschung beigetragen haben. Das Eigenartige jedoch ist, dass die Machtausübung in der Kirche zwar autoritativ und hierarchisch daherkommt, aber sich auch überraschend chaotisch, unkoordiniert und unklar artikuliert… Man stellt sich ja die katholische Kirche immer so als einen monolithischen Block vor, ganz ähnlich wie das Militär. Wenn man aber genau hinschaut, ist in vielen Bereichen das Gegenteil der Fall. Ja, es gibt ein Autoritätsgehabe. Dieses ist aber oft nicht gedeckt, weder mit einer persönlichen noch mit einer strukturellen oder fachlichen Kompetenz.»
Wen wundert es da, wenn immer mehr Menschen sich aus der Institution Kirche verabschieden, was noch lange nicht besagt, dass sie dadurch zu ‹Ungläubigen› werden, wie ich in meinem letzten Buch zu verdeutlichen suchte.
Dieser Autoritätsverlust betrifft aber keineswegs nur die römisch-katholische oder die christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Auch in anderen Weltreligionen wie Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus zeichnet sich ein düsteres Bild. Der Jurist und Publizist Milosz Matuschek hat dies in einer Kolumne so auf den Punkt gebracht:
«Stellt man die monotheistischen Religionen einmal nüchtern auf den Prüfstand, ist ihre Bilanz ziemlich verheerend: Sie propagieren Frieden, aber sind oft Brutstätten von Konflikten, sie stehen vielfach für Unterdrückung, Ressentiment, Moralismus, die Verachtung der Sexualität und eine Verstümmelung des Denkens. Oder anders gesagt: Sie haben den Menschen in seiner Entwicklung oft zurückgehalten, wenig von Relevanz für den Fortschritt getan und bereiten uns schlecht auf die Zukunft vor. Trotzdem verlangen sie permanent ‹Respekt vor dem religiösen Gefühl›». (Neue Zürcher Zeitung, 18.10.2018)
Sehr viele Menschen zählen sich zwar noch zu irgendeiner ‹spirituellen Weltanschauung› und praktizieren auch entsprechende Riten und Rituale. Aber sie machen sich immer weniger abhängig von diesen. Die Abstimmung mit den Füssen ist auf dem Vormarsch – auch in den islamischen Ländern, wenn dort ungemein schwieriger.
In jeder Religion und Konfession, in jeder spirituellen Gemeinschaft und Bewegung gibt es einerseits Menschen, die absolut ‹hörig› sind und bleiben wollen, die ohne einen ‹Guru› – und sei es auch ein katholischer Bischof oder ein Iman – gar nicht existieren können. Genau diese Gruppe von ‹Religiösen› ist es, die institutionelle Religionen in Verruf bringen, weil es ihnen an Bereitschaft zum Dialog und zum interreligiösen respektive interkonfessionellen Wachstum mangelt. Dafür dominiert bei ihnen Intoleranz, Abschottung und Exklusivität. Nur die eigene Religion oder Konfession ist die einzig wahre. Alle anderen sind Ungläubige, Häretiker. Es ist allseits bekannt, dass solche ‹Religiösen› vor Verfolgung, Gewalt und Terror nicht zurückschrecken. Geschätzt sind diese weniger als zehn Prozent in jeder Religion, die aber medial sehr groß und mächtig erscheinen.
Auf der anderen Seite stehen ihnen etwa genauso viele gegenüber, welche ein ganz anderes Bild ihrer Religion veranschaulichen: interessiert an einer Weiterentwicklung der eigenen Religion oder Konfession, im Dialog mit Andersdenkenden, offen für neue Formen und Ausdrucksweisen ihres Glaubens – wie beispielsweise die Bewegung «fresh expressions», die sich ausgehend von der anglikanischen Kirche inzwischen weltweit etabliert hat (www.freshexpressions.ch).
Der Rest der ‹Religiösen›, also circa 80% der Bevölkerung, ist – zumindest in unseren Breitengraden – schweigende oder schon gleichgültig gewordene Masse. Die Medien interessieren sich jedoch vorrangig für die beiden extremen Flügel von Religionen – und bevorzugt um jene, die belegen, wie rückständig, anachronistisch und menschenrechtsverletzend Religionen sein können. Nach der Devise only bad news are good news sind manche Journalistinnen und Journalisten regelrecht geil darauf, Religionen und Religiosität an sich zu diskreditieren. Auch sie haben es meiner Überzeugung nach zu verantworten, dass Religion immer mehr an Bedeutung verliert.
Wenn ich mich in und mit diesem Buch jedoch dafür einsetze, nicht tabula rasa mit Religionen zu machen, dann muss ich wohl erst mal erläutern, weshalb mir diese für das Fortbestehen dieser «Einen Welt» so wichtig sind?!