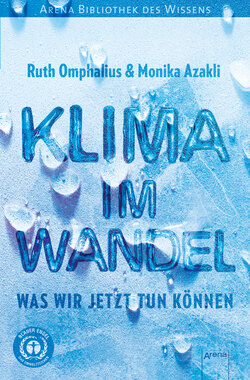Читать книгу Klima im Wandel. Was wir jetzt tun können - Ruth Omphalius - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWetter oder Klima?
Überall hört man, dass das Klima immer wärmer wird, aber gleichzeitig warnen Wetter-Apps vor Schneestürmen in den Bergen und Schneeverwehungen legen den Bahnverkehr lahm. Wie passt das zusammen? Dass das Wetter mit Sonnenschein, Gewitterfronten, Niederschlag und Wind zu tun hat, weiß jeder. Viele Menschen verfolgen täglich gespannt, ob gerade ein Hoch* oder ein Tief* über den Atlantik zieht und mit welchen Temperaturen am folgenden Tag zu rechnen ist. Oft ist auch von Klima, klimatischen Bedingungen oder klimatischen Schwankungen die Rede. Aber was ist eigentlich genau unter „Wetter“ und was unter dem Begriff „Klima“ zu verstehen? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen beiden?
Auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes kann man den Begriff „Wetter“ recherchieren und findet als Definition:
„Als ‚Wetter‘ wird der physikalische Zustand der Atmosphäre* zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem kürzeren Zeitraum an einem bestimmten Ort oder in einem Gebiet bezeichnet.“
Manchmal wird noch ergänzt, dieser Zustand sei „durch die meteorologischen* Elemente und ihr Zusammenwirken gekennzeichnet“. Diese Erklärung ist aber mindestens genauso rätselhaft wie die Ausgangsfragen. Erst wenn man ein konkretes Wetterbeispiel konstruiert, wird deutlich, was gemeint ist:
„Zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort“ könnte sich auf „heute“ und „Frankfurt am Main“ beziehen. „In der Atmosphäre“ ist schon schwerer zu verstehen. Die Atmosphäre ist eine Hülle aus Gas, die den gesamten Erdball umschließt. Sie beeinflusst alles Leben auf der Welt schon allein dadurch, dass sich in diesem Gasgemisch sowohl der Sauerstoff befindet, den wir atmen, als auch Stoffe wie Kohlendioxid (CO2) und Methan, die die Wärmeregulierung der Erde beeinflussen.
Die Grenze zum Weltall nimmt man bei 690 Kilometern Höhe an. Aber nur in den ersten 10 bis 15 Kilometern von der Erdoberfläche aus betrachtet, findet der physikalische Zustand statt, den wir „Wetter“ nennen. Diese unterste Schicht der Atmosphäre, die Troposphäre*, heißt deshalb auch Wetterschicht*.
Nun bleibt noch der „physikalische Zustand“ zu erklären. „Physik“ nennt man die Lehre von den „unbelebten Dingen der Natur“. Sie ist eine sogenannte exakte Wissenschaft, weil man es in der Regel mit Forschungsgegenständen zu tun hat, die man messen, wiegen oder auf sonstige Weise exakt bestimmen kann. Wetter ist also zum Beispiel ein Zustand 10 bis 15 Kilometer über Frankfurt, den man für heute mit physikalischen Messmethoden exakt bestimmen kann. Messen und beschreiben kann man die oben genannten meteorologischen Elemente, hinter denen sich nichts anderes verbirgt als Luftdruck, Lufttemperatur, Luftfeuchte und Luftbewegung, also Wind. Ihr Zusammenspiel an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit nennt man Wetter.
Die Erdatmosphäre besteht aus verschiedenen Schichten. Nur in der untersten, der Troposphäre, findet Wetter statt.
Nun könnte man allerdings auch das Wetter an einem anderen Ort betrachten oder einen anderen Zeitpunkt wählen, wie etwa das Wetter gestern um Viertel vor zwölf auf der Zugspitze. Auch was sich in der Wetterschicht zu dieser Zeit über dem höchsten Berg Deutschlands abgespielt hat, nennt man Wetter. Oder die Situation während der nächsten drei Tage über Schleswig-Holstein. Wetter kann also über einem einzelnen Berggipfel genauso stattfinden wie über einer größeren Fläche, es kann einen Augenblick andauern oder auch mehrere Tage. Wichtig ist, dass das Wetter zeitlich begrenzt an einem bestimmten Ort stattfindet und sich jederzeit ändern kann – ganz im Gegensatz zur „Wetterlage“, „Witterung“ oder zum „Klima“.
Von „Wetterlage“ sprechen die Meteorologen*, wenn sie das Wetter in einem größeren Gebiet beschreiben wollen, zum Beispiel über ganz Deutschland. „Witterung“ dagegen heißt das Wetter, das zwar nur über einem bestimmten Ort oder einer Region herrscht, dafür aber über mehrere Tage oder sogar Wochen andauert.
Der Begriff „Klima“ beschreibt schließlich für eine große Region, zum Beispiel alle Länder, die am Äquator liegen, den typischen jährlichen Ablauf der Witterung. Es geht hier also um viel allgemeinere Vorgänge und Zusammenhänge als einen Regenschauer morgen Abend in Berlin oder einen etwas kälteren Winter als üblich. Deswegen sind Aussagen über das Klima manchmal sogar zuverlässiger als über das Wetter fürs Wochenende, denn das Wetter an einem einzelnen Ort kann sich aufgrund vieler Faktoren sehr schnell ändern. Das Klima wird von langfristig wirkenden Elementen bestimmt. So gibt es in Europa die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter, in Indonesien dagegen wird das Jahr von Regenzeiten und Trockenzeiten strukturiert. Europa und Indonesien haben ein deutlich unterschiedliches Klima.
Das Klima einer Region hängt von vielen Faktoren ab. Am wichtigsten ist allerdings, wie viel Sonnenschein ein Gebiet bekommt. Und das wiederum hängt davon ab, wo auf der Erdoberfläche sich die betreffende Region befindet. Je nachdem, ob sie näher an den Polen oder näher am Äquator liegt, trifft das Sonnenlicht in einem anderen Winkel auf. Je steiler der Winkel, desto heißer die Region. Und weil dieser Winkel eine so zentrale Bedeutung hat, wurde das ganze Phänomen nach ihm benannt. Denn das ursprünglich griechische Wort klíma bedeutet nichts anderes als „Neigung“.
Wetter-App auf einem Smartphone
Die Teile der Erde, die nördlich und südlich des Äquators liegen, werden am intensivsten von der Sonne beschienen. Die Strahlen treffen hier fast im rechten Winkel auf die Erde auf. Zu den Polen hin nimmt die Stärke der Einstrahlung ab, der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen wird kleiner. Die Wissenschaft nennt Gebiete rund um den Planeten, die eine ungefähr gleich starke Sonneneinstrahlung erhalten und daher ein ähnliches Klima aufweisen, „Klimazonen“. Diese Zonen ziehen sich wie breite Gürtel um den Globus. Sie heißen Tropen, Subtropen, Mittelbreiten und Polarzone. Nördlich und südlich des Äquators liegen die „Tropen“. Hier ist es wegen der starken Sonneneinstrahlung besonders heiß. Im Jahresablauf gibt es kaum Veränderungen.
Die Klimazonen der Erde sind abhängig von der Sonneneinstrahlung.
An die Tropen, zu denen große Teile Afrikas, Asiens, Mittel- und Südamerikas sowie Australiens gehören, schließen sich im Norden und Süden die „Subtropen“ an. Hier sind bereits deutliche Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter messbar.
Bewegt man sich weiter in Richtung der beiden Pole, erreicht man die sogenannten „Mittelbreiten“. Hier kann man die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter klar voneinander unterscheiden. Im Bereich der Mittelbreiten liegen Europa, Nordamerika und Zentralasien. Die Gebiete direkt um die Pole herum nennt man „Polarzonen“. Hier sind die jahreszeitlichen Schwankungen am extremsten. Während die Sonne im Sommer den ganzen Tag über scheint, bleibt es im Winter völlig dunkel. Man spricht von „Polartag“ und „Polarnacht“.
Das Klima hängt also in entscheidendem Maß von der Stärke der Sonneneinstrahlung ab. Es gibt allerdings auch noch andere Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen können, wenn man nicht eine ganze Klimazone, sondern einen Teilbereich betrachtet. Beispielsweise ist es auf hohen Bergen deutlich kälter als in der Ebene. Das Klima in einer hochgelegenen Gebirgsregion wie Tibet, das auf durchschnittlich 4.500 Meter Höhe liegt, unterscheidet sich grundlegend von Regionen, die zwar in derselben Klimazone, aber eher auf Höhe des Meeresspiegels liegen.
Überhaupt ist die Beschaffenheit der Oberfläche im Einzelfall von großer Bedeutung. An Berghängen verlieren Regenwolken ihren Niederschlag, über Wasserflächen verdunstet Wasser. Die Nähe zu einem Ozean oder Meer spielt eine große Rolle. Das Meer transportiert Wärme, daher herrscht in Meeresnähe oft ein wärmeres Klima als im Inland. Viele Küstenstreifen sind allerdings auch von Stürmen geplagt, die ihren Ursprung weit draußen auf den Ozeanen haben. Die Verteilung von Wasser bestimmt in hohem Maße das Klima einer Region.
Schließlich beeinflussen auch wir Lebewesen das Klima auf unserem Planeten. Alle Pflanzen und Tiere, sogar die winzigen Bakterien, sondern Stoffe ab, die sich auf das Klima auswirken. Wir Menschen tun dies ganz besonders stark. Wir benötigen Energie nicht nur zum Überleben, also um Nahrung und Wärme bereitzustellen, sondern für eine ganze Menge Dinge, die wir mit Begriffen wie „Kulturleistung“, „Lebensstandard“, „technologische Weiterentwicklung“ oder ganz allgemein als „Fortschritt“ bezeichnen. Gemeint sind Fortbewegungsmittel wie Autos, Motorräder, Züge und Flugzeuge, die uns vergleichsweise einfach an weit entfernte Orte bringen. Oder Dinge, die unser Leben angenehmer machen, von der Fußbodenheizung, über die Waschmaschine und den Staubsauger, bis hin zur Flutlichtbeleuchtung auf dem Fußballplatz oder bei großen Konzerten.
Tibet ist das höchstgelegene Land auf der Erde.
Um das alles möglich zu machen, nutzen Menschen alle verfügbaren Energiequellen auf der Erde. Bei einer Weltbevölkerung von mittlerweile fast 8 Milliarden kommt da so viel zusammen, dass wir Menschen zum ersten Mal in der Geschichte sogar das Klima des gesamten Planeten verändern.
Angriff der Killerinsekten
Ein ohrenbetäubendes Summen und Brummen liegt in der Luft – wie in einem übergroßen Bienenstock. Ein Kribbeln, Krabbeln und Rascheln mischt sich darunter, aber kein einziger anderer vertrauter Laut, kein Vogelzwitschern, kein Hundegebell, nicht einmal eine entfernte Autohupe.
Armlange Tausendfüßer huschen über den morastigen Grund und verwandeln den Boden in ein verwirrendes, sich immer wieder neu zusammensetzendes Muster. Massen von Wanzen erklimmen die Stängel der großen Bärlappgewächse und saugen Saft aus den fleischigen Blättern. Fluginsekten in der Größe von Singvögeln ziehen ihre Kreise am Himmel und erbeuten hin und wieder unvorsichtige Schaben, die auf dem Boden in abgestorbenem Pflanzenmaterial wühlen.
Die ganze Erde ist ein Reich der Insekten. Kein Säugetier und kein Vogel macht den Krabbeltieren ihren Rang als Weltbeherrscher streitig. Die Königin in diesem Reich ist Meganeura, ein riesiges libellenartiges Insekt, das mit seinen bis zu 70 Zentimetern Flügelspannweite als das größte Insekt aller Zeiten gilt. Mit ihrem kraftvollen Flugapparat ist sie ein eleganter Flieger, der seine Beute in blitzschnellen Manövern angreift. Ihren hoch entwickelten Facettenaugen, den charakteristischen Sehorganen der Insekten, entgeht nicht die kleinste Bewegung.
Eben zieht sie noch scheinbar ungerührt ihre Kreise über dem morastigen Wasser eines kleinen Sees, dann stoppt sie abrupt und stürzt sich im Bruchteil einer Sekunde in die Tiefe. Ihr Opfer, ein kleiner Molch, hat nicht den Hauch einer Chance gegen das übermächtige Insekt. Seine Art ist gerade erst dabei, langsam den festen Boden zu erobern.
Meganeura lebte vor 300 Millionen Jahren.
Auf einem ausladenden Ast verzehrt Meganeura ungerührt ihre zappelnde Beute und kann nicht ahnen, dass sich in der Zukunft die Vorzeichen umkehren und die Amphibien zu Jägern, die Insekten zu Gejagten werden.