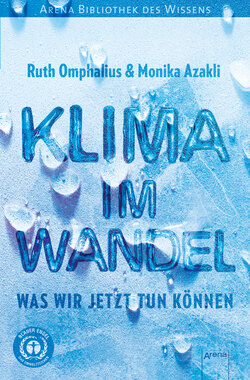Читать книгу Klima im Wandel. Was wir jetzt tun können - Ruth Omphalius - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеImmer dasselbe Klima?
Bei einem Sonntagsspaziergang durch einen solchen morastigen Wald würde wohl jeden das kalte Grausen packen. So etwas kann es doch gar nicht geben! Alles nur Science-Fiction?
Nein, einfach eine andere Zeit mit einem anderen Klima! Der beschriebene Wald hat vor 300 Millionen Jahren tatsächlich existiert – hier in Europa!
Damals gab es noch keine Säugetiere, Vögel und Blütenpflanzen, die für den Menschen der Gegenwart so selbstverständlich sind, dass man sich eine Natur ohne sie kaum vorstellen kann. Aber all diese komplexen Wesen waren einfach noch nicht entwickelt. Amphibien und frühe Reptilien repräsentierten die Spitze der Vierbeinerevolution. Diese Zeit, die man wissenschaftlich als Karbon* bezeichnet, war dafür ein Höhepunkt der Insektenentwicklung. Damals lebten Riesenformen wie nie zuvor und auch später niemals wieder.
Das gewaltigste dieser Monsterinsekten war Meganeura. Als die Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die ersten Fossilien dieses frühen Fliegers stieß, war die Überraschung groß. Niemand hätte es je für möglich gehalten, dass ein so großes Insekt tatsächlich leben könnte. Heute bringt es ein brasilianischer Nachtschmetterling gerade mal auf 32 Zentimeter Flügelspannweite, den längsten Körper hat mit 36 Zentimetern eine asiatische Gespensterschrecke und der schwerste Vertreter der Insektenwelt ist eine Grille, die – allerdings nur, wenn sie Nachwuchs erwartet – ein Lebendgewicht von 71 Gramm auf die Waage bringt. Die Forschung zeigt, dass ein größeres oder schwereres Insekt unter heutigen Bedingungen nicht existieren könnte.
Was war also anders zur Zeit der Rieseninsekten? Die Antwort ist einfach und lässt sich leicht in den Gesteinsschichten nachweisen. Zur Zeit von Meganeura gab es wesentlich mehr Sauerstoff in der Luft als heute. Das Gasgemisch unserer Atmosphäre veränderte im Laufe der Erdgeschichte immer wieder seine Zusammensetzung. Im Karbon machte der Sauerstoff 35 Prozent der Mixtur aus, in anderen Phasen der Erdgeschichte sank der Anteil auf 18 Prozent ab. Solche Schwankungen haben vermutlich zum Aussterben der Rieseninsekten geführt. Heute liegt der Sauerstoffgehalt der Luft bei 21 Prozent – viel zu wenig, um einen Koloss wie Meganeura am Leben zu halten.
Insekten besitzen einen Chitinpanzer, der den ganzen Körper umschließt. Ein Panzer, der das Gewicht eines Rieseninsekts ausreichend stützen kann, müsste sehr dick sein. Das allein ist ab einer bestimmten Größe problematisch, weil wenig Platz für innere Organe bliebe. Das größte Hindernis für ein Monsterwachstum ist für die Insekten jedoch ihre Atmung. Sie atmen mit sogenannten „Tracheen“. Das sind starre Röhren, die sich verästeln und den gesamten Körper des Tieres durchziehen. Der Sauerstoff dringt durch kleine Öffnungen im hinteren Bereich des Körpers in dieses Röhrensystem ein, verteilt sich und sickert schließlich durch die Röhrenwände in das weiche Körperinnere. Diesen Vorgang nennt man „Diffusion“.
Bei einem Rieseninsekt wären die Tracheenwände sehr dick und es würden bei dem gegenwärtigen Sauerstoffgehalt der Luft zu wenige Sauerstoffmoleküle ins Innere des Tieres gelangen. Besonders in den langen Insektenbeinen würde die Diffusion als Motor für die Sauerstoffverteilung nicht ausreichen. Erst ein höherer Sauerstoffgehalt der Luft ermöglicht das Eindringen von so vielen Sauerstoffteilchen, dass auch ein Rieseninsekt nicht ersticken muss. Nur wenn der Sauerstoffgehalt der Erdatmosphäre irgendwann wieder deutlich ansteigt, könnten erneut Monsterinsekten die Erde bevölkern.
Vulkane sind Klimamotoren.
Dieser Ausflug in die Vergangenheit zeigt, dass schon die Veränderung eines einzigen Klimafaktors, zum Beispiel die Zusammensetzung der Luft, enorme Auswirkungen auf unseren Planeten, sein Klima und das Leben auf ihm hat. Im Verlauf ihrer Geschichte sah die Erde immer verschieden aus, hüllte sich in anderes Wetter und beherbergte unterschiedliche Pflanzen und Tiere. Was unseren Planeten immer wieder umgestaltet und sein Aussehen verändert, sind im Grunde die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft.
Das ist keine neue Erkenntnis, denn schon immer wurde die Geschichte des Menschen durch diese Kräfte beeinflusst. Meist nahmen die verschiedenen Kulturen jedoch vor allem die zerstörerische Seite der Naturgewalten wahr, die in allen Teilen der Welt immer wieder großes Leid über die Menschen brachten. Vulkanausbrüche, Flutkatastrophen, Erdbeben und Stürme gehören zu den Dingen, die Menschen am meisten fürchten. Selbst die moderne Technik schützt nur begrenzt vor den Kräften der Natur. Den meisten ist nicht bewusst, dass es den Menschen und auch alles andere Leben auf der Erde ohne diese Kräfte gar nicht gäbe. Ohne Vulkane, fruchtbare Böden, die gigantischen Wassermassen der Ozeane und den Schutz der Atmosphäre wäre unser Planet wie die anderen Himmelskörper, die wir kennen: öde und leer!
„Schneeball Erde“: Die Erde war in ihrer Geschichte für einige Zeit komplett mit Eis bedeckt.
In der Frühzeit der Erde sah es zunächst gar nicht rosig für die Entwicklung des Lebens aus. Die Sonne strahlte lange nicht so hell wie heute, sondern lieferte fast 30 Prozent weniger Energie. Unser Heimatplanet war in großer Gefahr, dauerhaft einzufrieren. Einzig die Vulkane bewahrten die Erde vor dem Schicksal, ein lebloser Eisblock wie etwa der Zwergplanet Pluto zu werden. Aber nicht die Lava, die die Vulkane ausspuckten, war für die Erwärmung des Globus zuständig, sondern vielmehr waren es die riesigen Rauch- und Aschewolken, die die Vulkane bei jedem Ausbruch freisetzten. Diese Wolken enthielten ein Gas mit Superkräften: CO2.
Der Treibhauseffekt
Der Gehalt von CO2 in unserer Atmosphäre liegt bei einem Bruchteil von 1 Prozent, aber seine Auswirkungen sind dramatisch. Könnte ein böser Fluch dieses CO2 vollständig wegzaubern, dann würden die Durchschnittstemperaturen auf der Erde um 30 Grad Celsius (30 °C) fallen. Das bedeutet, Städte und Dörfer, Autobahnen und Flughäfen wären in kürzester Zeit mit einer kilometerdicken Eisschicht bedeckt und ein Leben auf diesem Planeten wäre unmöglich. Das CO2 wirkt wie eine Decke, die sich die Erde umgelegt hat, um sich warm zu halten. Sonnenstrahlen können von der Sonne zur Erde gelangen, aber das CO2 lässt die Wärme nicht mehr vollständig zurück ins Weltall – ein Teil bleibt in der Atmosphäre zurück. Der Planet erwärmt sich. Die Wissenschaft nennt dieses Phänomen „Treibhauseffekt“, weil in einem Gewächshaus genau dasselbe in viel kleinerem Maßstab passiert. Das Glas eines Treibhauses funktioniert ganz genauso wie das CO2 und andere Gase in der Atmosphäre. Es lässt die Wärme der Sonne eindringen, aber nicht wieder vollständig hinaus.
Heute pusten aber nicht nur Vulkane Rauch in die Luft, sondern auch der Mensch mit seiner Industrie und seinen Autos. Durch sie kommt zusätzliches CO2 in die Atmosphäre, was dazu führt, dass sich die Erde stärker erwärmt.
Wenn die Erwärmung damals etwas Gutes war, wieso ist sie dann heute schlecht? Ein kleiner Selbstversuch hilft, sofort die Antwort zu finden. Mit dünner Kleidung im Winter durch den tiefen Schnee zu laufen, ist mindestens so unangenehm wie im Hochsommer in der prallen Sonne mit dickem Wollpullover und Anorak. Den Selbstversuch sollte man nach wenigen Minuten abbrechen, denn auf die Dauer sind große Kälte und große Hitze gleich schädlich und machen krank. Wichtig für jeden Menschen ist, dass er eine mittlere Temperatur zum Leben hat – das gilt auch für alle Tiere und Pflanzen auf dem gesamten Globus.
Umhüllt der Mensch die Erde mit zu vielen Lagen aus Abgasen, dann werden Regulierungsmechanismen gestört. Das Leben auf der Erde würde ebenso an den Folgen leiden wie ein Mensch, der auf Dauer seinen Körper überhitzt.
In der fernen Erdvergangenheit drohte der Erde schon einmal eine Überhitzungskatastrophe. Zwar haben Vulkane durch den Treibhauseffekt überhaupt erst die Grundlage für alles Leben auf der Erde geschaffen, aber ab einem bestimmten Punkt produzierten sie viel zu viel von dem Treibhausgas CO2.
Wie die Geschichte der Erde hätte weitergehen können, sieht man heute bei einem Planeten ganz in unserer Nachbarschaft. Auf der Venus pumpten die Vulkane so viel CO2 in die Atmosphäre, dass der Treibhauseffekt dort völlig aus dem Ruder lief. Die Oberflächentemperatur der Venus erreicht bis heute um die 400 °C. Dort ist kein Leben möglich. Auf der Erde hatte das Leben mehr Glück, denn hier gab es ein gutes Gegenmittel gegen zu viel CO2, nämlich Wasser. Ein Teil war als Wasserdampf bereits in der Atmosphäre enthalten, ein anderer Teil stammte aus dem Erdinneren und wurde von den Vulkanen zusammen mit Lava an die Oberfläche transportiert. Einmal an der Oberfläche angekommen, verdampfte auch dieses Wasser und erhöhte den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre. Ein weiterer Teil könnte durch Kometen auf unseren Planeten gelangt sein.
Wasser aus dem All
Lange Zeit war man sich in der Wissenschaft nicht einig, ob und wie viel Wasser Kometen transportieren. Um diese Frage ein für alle Mal zu klären, ließ die amerikanische Weltraumbehörde NASA 2005 einen Satelliten mit dem Kometen Tempel 1 zusammenstoßen. Obwohl der Satellit den Kometen nur geringfügig beschädigte, spritzten über 230 Millionen Liter Wasser heraus. Das ist ungefähr so viel Wasser wie in 200 Schwimmbecken passt, wie sie für die Olympischen Spiele benutzt werden. Kometen sind also gigantische Wasserspeicher, die eine bedeutende Rolle für die Entstehung der Ozeane auf der Erde gespielt haben könnten.
Zunächst sammelte sich das Wasser als Dampf in der Atmosphäre. Wasserdampf ist wie CO2 ein Treibhausgas. Befindet sich viel Wasserdampf in der Atmosphäre, wird es durch den Treibhauseffekt wärmer. Je wärmer es ist, desto mehr Wasser verdunstet. Schließlich war so viel Wasserdampf in der Luft, dass es anfing zu regnen. Und es regnete und regnete, als wollte es niemals mehr aufhören. Gegen diesen Regen hätte der beste Regenschirm nichts genützt, denn die Regenzeit dauerte viele Millionen Jahre an. Heute wäre ein solcher Regen möglicherweise das Ende der menschlichen Zivilisation, aber damals, in der Frühzeit der Erde, begann ein ungewöhnlicher Kreislauf, von dem wir noch heute profitieren.
Das Regenwasser wusch Treibhausgase wie das CO2 aus der Atmosphäre heraus und beides zusammen ging als saurer Regen* nieder. Das war zu dieser Zeit nicht schlimm, weil es noch keine Pflanzen gab, die der saure Regen hätte schädigen können. Heute ist saurer Regen, der durch die vielen Abgase entsteht, ein ernstes Umweltproblem in vielen Regionen der Erde. Am Boden angekommen, reagierte das CO2 mit Mineralien in den Gesteinen zu Karbonaten*. Diese Salze wurden in die Flüsse gewaschen und nach und nach ins Meer geschwemmt. Schließlich lagerten sich die Karbonate am Meeresboden ab und wurden zu festem Gestein. Die Gefahr der Überhitzung war gebannt.
Weil die Vulkane aber immer weiter Kohlenstoff in die Atmosphäre sprühten, kühlte der Planet im Anschluss an den großen Regen nicht völlig aus. Nach einigem Hin und Her und vielen Umwegen entstand schließlich ein Gleichgewicht zwischen CO2-Ausstoß und -entzug und die Erde wurde zu einem gut temperierten Planeten, auf dem das Leben nicht nur entstehen, sondern sich auch bis heute halten konnte.
Das System arbeitet wie ein Heizungsthermostat*. Wenn das CO2 in der Luft ansteigt und es zu warm wird, nimmt die Atmosphäre auch mehr Wasserdampf auf. Der Regen nimmt zu, das überflüssige Treibhausgas wird durch den Regen aus der Atmosphäre gewaschen und reagiert am Boden mit anderen Stoffen, sodass es nicht mehr in die Atmosphäre zurückkehren kann. Der Planet kühlt ab. Wenn es dagegen zu kalt wird, gibt es weniger Regen und die Vulkane bessern den Schutzmantel der Erde wieder aus, indem sie neues CO2 ausstoßen. Dieser Kreislauf funktioniert auch heute noch. Auf diese Weise wird es niemals zu heiß oder zu kalt. Im Prinzip eine tolle Sache, aber nicht immer funktionierte das System einwandfrei. Manchmal setzte das Thermostat aus und es wurde eben doch zu heiß oder zu kalt. Der Erde haben diese Extreme nie geschadet, für das Leben auf ihr waren sie allerdings von höchster Bedeutung.
Die ersten Lebewesen
Die ersten Bewohner der Erde waren einfache Einzeller, die vor ungefähr 3,8 Milliarden Jahren den Planeten besiedelten. Man weiß nicht genau, wo und wie sie entstanden sind. Die meisten Forscherinnen und Forscher glauben heute, dass sie auf dem Meeresboden in der Nähe von heißen mineralischen Quellen entstanden sind. Sicher ist eigentlich nur, dass sie offenbar ideale Voraussetzungen auf der Erde vorfanden, denn sie vermehrten sich enorm. Die Welt war mehr oder weniger von Bakterienschleim überzogen.
Einzeller waren die ersten Lebewesen auf der Erde.
Hätte das Kohlenstoff-Thermostat immer perfekt gearbeitet, wäre die Erde vermutlich bis heute ein Schleimplanet geblieben, aber nachdem die Bakterien rund 3 Milliarden Jahre allein den Planeten beherrscht hatten, versagte die Regulierung zum ersten Mal in größerem Maßstab. Die Katastrophe war so gewaltig, dass sie das gesamte Leben auf der Erde fast ausgelöscht hätte. Damals klappte das Aufladen der Atmosphäre mit neuem Kohlenstoff nicht so ganz. Die Ursache ist unklar. Vielleicht legten die Vulkane eine Feuerpause ein, vielleicht waren andere Faktoren verantwortlich. Das Ergebnis der Regelungsfehler war jedenfalls, dass sich die Erde in einen gewaltigen „Schneeball“ verwandelte. Es gab nichts als Eis – von den Polen bis zum Äquator.
Als das Eis erst einmal angefangen hatte, sich auszudehnen, war es nicht mehr zu stoppen. Die weiße Eisdecke warf die wärmenden Sonnenstrahlen einfach zurück. Die Erde kühlte immer mehr ab. Und je mehr Eis entstand, desto weniger Strahlen erreichten die Planetenoberfläche. Man kann sich das Klima damals kaum vorstellen. Nur in der Antarktis herrschen heute vergleichbare Temperaturen.
In der Antarktis leben heutzutage wenige hoch spezialisierte Tierarten, zum Beispiel Pinguine. Sie können in ihrer lebensfeindlichen Umwelt aber nur deshalb überleben, weil sie ihr Futter aus einem gemäßigteren Lebensraum, dem Meer, beziehen. Könnten sie nicht immer wieder in diese fruchtbare Umgebung zurück, würden sie umkommen. Vor einer Milliarde Jahre gab es auf dem „Schneeball“ Erde solche Erholungsgebiete aber nicht. Alles war gefroren, eine unendliche, todbringende Eiswüste. Erst als die Vulkane ebenso unerwartet ihre Tätigkeit wieder aufnahmen, erwärmte sich die Erde erneut. Alles hätte so sein können wie vorher: eine Welt der Bakterien für weitere Jahrmillionen.
Das Klima hat dazu beigetragen, dass sich zahlreiche Tierarten entwickelt haben.
Aber die tödlichen Eismassen hatten offenbar einen wichtigen Evolutionsschritt bewirkt. Genau in die Zeit nach der großen Eiswüste fällt die Entstehung von Lebewesen, die aus mehr als einer Zelle bestehen. Dieser Schritt gehört zu den bedeutendsten in der langen Entwicklungsgeschichte des Lebens. Die Mehrzeller brachten in den kommenden Jahrmillionen eine unüberschaubar große Anzahl von Formen hervor: Bienen, Schnecken, Frösche, Adler, Löwen … Obwohl sie sehr unterschiedlich sind, haben sie alle eines gemeinsam: Sie sind Mehrzeller und haben ihren Ursprung in den frühen Formen, die sich nach dem „Schneeball“ Erde entwickelt haben. Dies gilt auch für den Menschen. Wie dieser wichtige Entwicklungsschritt geschehen konnte, weiß man nicht. Offenbar war es in jener lebensfeindlichen Umgebung ein Vorteil für die Mikroorganismen*, sich zusammenzutun. Als der Klimaregler der Erde wieder zu arbeiten begann und die Vulkane von Neuem CO2 freisetzten, war der Weg frei für eine bis dahin ungekannte Vielfalt des Lebens.
Die Evolution, die Entwicklung des Lebens, verlief jedoch auch in der weiteren Erdgeschichte nicht ohne Zwischenfälle. Katastrophale Ausfälle der Klimaregelung hat es bis heute immer wieder gegeben. Ihre Ursachen waren unterschiedlich. Manchmal sorgten die Vulkane durch Über- oder Unterversorgung der Atmosphäre mit CO2 für Probleme, manchmal kam die Klimamaschine aber auch durch Störungen von außen aus dem Gleichgewicht. Meteoriten, Asteroiden und Kometen können verheerende Auswirkungen haben. Das bekannteste Ereignis, bei dem ein Himmelskörper das Erdklima völlig durcheinanderbrachte, war ein Meteoriteneinschlag vor 65 Millionen Jahren, der das Aussterben der Dinosaurier verursacht haben soll. Das Geschoss aus dem Weltall soll bei seinem Aufprall so viel Staub in die Atmosphäre geschleudert haben, dass sich der Himmel verdunkelte und das Sonnenlicht nicht mehr durchdringen konnte. Dadurch herrschten für einen längeren Zeitraum arktische Temperaturen auf der Erde. Das Aussterben der Saurier war jedoch nicht für alle schlecht. Den Säugetieren ermöglichte es, die verschiedenen Lebensräume zu besiedeln, die zuvor von den riesigen Echsen besetzt waren, und eine unglaubliche Vielfalt an Arten zu entwickeln.
Vor den Säugetieren herrschten die Dinosaurier über die Erde.
Auch die Entwicklung der Menschen ist entscheidend von Klima und Klimawandel geprägt. Eine Eiszeit sorgte dafür, dass im afrikanischen Lebensraum unserer frühen Vorfahren die Bäume verschwanden und sich Savannenlandschaften mit großen Seen ausbreiteten. An den Ufern dieser Seen könnten sich die Vorfahren der Menschen eine neue Nahrungsquelle erschlossen haben: Fisch. Manche Forschende glauben sogar, dass das anstrengende Waten im Wasser der Seen, um Krebse zu suchen und Fische zu fangen, zur Entwicklung des aufrechten Ganges beigetragen haben könnte. Im Gegensatz zu ihren entfernten Verwandten, den Menschenaffen, haben Menschen die Hände beim Gehen frei und können sie für andere Dinge nutzen. Nur deshalb konnten sie Werkzeuge einsetzen und später selbst herstellen. Das menschliche Gehirn wuchs und so sind wir bis heute in der Lage, immer komplexere Dinge zu erfinden.
Während anderer Eiszeiten trockneten Teile der Ozeane aus. Weil große Wassermengen in den gewaltigen Eisschilden eingefroren waren, regnete es immer weniger und der Meeresspiegel sank. Das führte dazu, dass man zu Fuß andere Erdteile erreichen konnte. Auf diese Weise kamen die ersten Menschen vermutlich sogar bis nach Amerika.
Das sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie das Klima nicht nur die Oberfläche der Erde mit ihren Pflanzen und Tieren, sondern auch den Menschen immer wieder geformt hat und noch weiter formt. Das gegenwärtige Klima herrscht auf der Erde mit kleineren Schwankungen seit ungefähr 11.000 Jahren. Wir können noch nicht abschätzen, welche Entwicklungen die Evolution in Zukunft für uns bereithält. Vielleicht wird es in Jahrmillionen auch wieder mehr Sauerstoff auf der Erde geben und einen Urwald mit Rieseninsekten. Und vielleicht kann sich der Mensch ebenfalls an eine solche Umgebung anpassen. Dann könnte ein Spaziergänger die wundersame Welt einer entfernten Verwandten der Meganeura bestaunen.
Enten auf großer Fahrt
Die Ozeane bestimmen unser Klima. Dafür gibt es nicht nur einen, sondern 29.000 Beweise.
Im Jahr 1992 verlor ein Frachtschiff während eines heftigen Sturms im mittleren Pazifik Teile seiner Fracht. Damals waren der Kapitän verzweifelt, die Mannschaft machtlos und der Besitzer des Schiffs wütend, aber sonst passierte nichts Außergewöhnliches. Oder doch? Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass der Unfall die Klimaforschung einen entscheidenden Schritt weiterbringen würde. An Bord des Schiffes hatte sich nämlich eine sehr spezielle Fracht befunden: Plastikentchen. Als die Riesencontainer aus dem Schiff fielen und zerbrachen, wurden 29.000 der kleinen Badetiere ins Meer geschüttet und begannen eine unglaubliche Reise rund um den Globus. Ohne eigenen Antrieb wurden sie von Kräften weitertransportiert, die man lange unterschätzt hatte: die Meeresströmungen.
Entchen im Eis – viele der kleinen Reisenden froren in nördlichen Meeren ein, bevor sie ihre Reise fortsetzen konnten.
Zunächst ergriffen die starken Oberflächenströmungen des Pazifischen Ozeans die freigesetzten Entchen. Damit ist das schnell fließende Wasser gemeint, das die oberste Schicht eines jeden Ozeans bis in eine Tiefe von etwa 300 Metern bildet. 300 Meter, das klingt zwar nach sehr viel, umfasst aber nur einen ganz kleinen Teil des Meerwassers – eben nur die Oberfläche. Die Ozeane der Erde sind bis zu 11 Kilometer tief. Die Oberflächenströmungen durchziehen die Meere kreuz und quer wie ein riesiges Netz von Autobahnen, Bundesstraßen und Landstraßen – nur dass sie den Antrieb gleich mitliefern. Die Plastikentchen zumindest hatten keine Wahl und wurden einfach mitgerissen.
Nach und nach rückte auch in den Fokus der Wissenschaft, dass an den unterschiedlichsten Orten der Welt Spielzeugentchen angeschwemmt wurden. Kurzerhand wurde eine Art „Kopfgeld“ für jede gefundene Ente ausgesetzt. Die Forschenden ließen sich genau beschreiben, wo die gelben Plastikvögel wieder an Land gegangen waren, und erhielten die erstaunlichsten Ergebnisse.
Eine große Anzahl beendete ihre Reise in Hawaii, aber viele andere tauchten plötzlich hoch im Norden auf. Sie waren offenbar aus dem Pazifik hinausgetrieben und durch die heimtückische Beringstraße in den Arktischen Ozean geschwemmt worden.
Dort froren sie erst einmal ein und waren für mehrere Jahre im Packeis gefangen. Sobald das Eis schmolz, setzten sie ihre Reise in Richtung Süden einfach durch den Atlantik fort. Noch acht Jahre nachdem sie in den Pazifischen Ozean gefallen waren, wurden verblasste Entchen an den Küsten Nordamerikas, Kanadas, Großbritanniens und sogar Islands gefunden. Diese Nachzügler waren ganz ohne eigenen Antrieb über drei Ozeane und jede Menge anderer Meere transportiert worden.
Überall auf der Welt wurden Plastikentchen angeschwemmt.
Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen staunten nicht schlecht, als sie ihre Erkenntnisse zusammentrugen. Obwohl man seit Jahrhunderten wusste, dass es Oberflächenströmungen gibt, hatten erst die reisefreudigen Plastikentchen bewiesen, wie umfassend und gewaltig das Netz der Ozeanautobahnen wirklich ist.