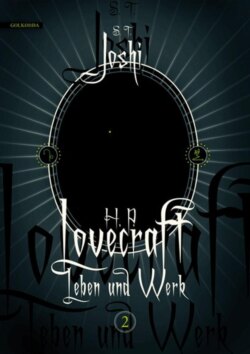Читать книгу H. P. Lovecraft − Leben und Werk 2 - S. T. Joshi - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
17. DAS WIEDERGEWONNENE PARADIES (1926)
ОглавлениеBereits in einem Brief an Arthur Harris von Ende Juli 1924 stellte Lovecraft fest: »Obwohl ich jetzt in New York bin, will ich eines Tages nach Providence zurückkehren. Denn die Stadt hat eine stille Würde, die ich nirgendwo anders gefunden habe, abgesehen von einigen Küstenstädten in Massachusetts.«1 Dies ist ein sehr frühes Zeugnis für Lovecrafts Wunsch heimzukehren, und ein Hinweis darauf, dass seine »Flitterwochen« mit New York kürzer waren, als man allgemein annimmt. Zu Lovecrafts Gunsten wollen wir davon ausgehen, dass eine solche Heimkehr auf die eine oder andere Weise auch Sonia miteinbezogen hätte. Doch Lovecrafts eigentliche Bemühungen, nach Providence zurückzukehren, begannen etwa im April 1925, als er an seine Tante Lillian schrieb:
Was Besuche anbetrifft … Ich könnte es nicht ertragen, Providence wiederzusehen, solange ich nicht für immer dort bleiben kann. Wenn ich wieder nach Hause komme, dann werde ich es mir dreimal überlegen, bevor ich auch nur einen Fuß nach Pawtucket oder East Providence setze, während der Gedanke, bei Hunt’s Mills die Grenze nach Massachusetts zu überschreiten, mir echtes Grauen einflößt! Aber ein flüchtiger Blick auf Providence würde mich in die Lage eines Schiffbrüchigen versetzen, der vom Sturm bis in Sichtweite seines Heimathafens gespült wird, nur um dann wieder hinaus in die grenzenlose Schwärze eines fremden Ozeans gerissen zu werden.2
Offensichtlich hatte Lillian vorgeschlagen, dass Lovecraft seiner Heimatstadt einen Besuch abstatten sollte, vielleicht um ihm aus der Mutlosigkeit und Depression herauszuhelfen, in die ihn Arbeitslosigkeit, bedrückende Wohnverhältnisse und der prekäre Zustand seiner Ehe gestürzt hatten. Lovecrafts Antwort ist bemerkenswert: Er schreibt nicht »falls«, sondern »wenn ich wieder nach Hause komme«, obwohl er wusste, dass seine finanziellen Verhältnisse eine sofortige Rückkehr nicht zuließen. Seine Bemerkung über den »fremden Ozean« ist ebenfalls bezeichnend: Dabei kann es sich nur um eine Anspielung auf New York handeln. Und trotz seiner unaufhörlichen Klagen über die »Fremden«, die die Stadt überfluteten, war es letztlich Lovecraft, der in New York ein Fremder blieb. 1927 schrieb er über seine New Yorker Zeit: »Ich war dort ein Fremder, dem es nicht gelang, sich anzupassen.«3 Ihm war vermutlich nicht klar, wie sehr er damit den Nagel auf den Kopf traf.
Als Lovecraft im November 1925 schrieb, dass sein »geistiges Leben sich eigentlich zu Hause in Providence« abspielte,4 war das keine Übertreibung. Während seines gesamten Aufenthalts in New York hatte er das PROVIDENCE EVENING BULLETIN abonniert und las sonntags neben der NEW YORK TIMES stets auch das PROVIDENCE SUNDAY JOURNAL. Lillian gegenüber verstieg er sich sogar zu der Behauptung, dass das BULLETIN »die einzige lesenswerte Zeitung ist, die ich kenne«.5 Auch auf andere Weise versuchte er, die geistige Verbindung mit Providence aufrechtzuerhalten, insbesondere, indem er so viele Bücher über die Geschichte seiner Heimatstadt las wie irgend möglich.6
Aber Bücher zu lesen, war Lovecraft offensichtlich nicht genug. Sonias spitze Bemerkung, dass Lovecraft mit »krankhafter Hartnäckigkeit« an seinen aus Providence mitgebrachten Möbeln hing, habe ich bereits erwähnt. Diese Möbel sind auch Gegenstand einer der bemerkenswertesten Passagen in Lovecrafts Briefen an seine Tanten, die zugleich eine präzise Momentaufnahme seiner Stimmung in der schwärzesten Phase seiner New Yorker Zeit bietet. Lillian hatte (vielleicht als Reaktion auf Lovecrafts langatmigen Bericht vom Kauf seines neuen Anzugs) in einem ihrer Briefe bemerkt, dass »Besitz eine Last« sei. Im August 1925 holte Lovecraft zu einer Antwort aus:
Jeder Mensch hat einen anderen Grund zu leben … d. h. für jeden Menschen gibt es eine Sache oder eine Gruppe von Dingen, die das Zentrum all seiner Interessen & den Kern all seiner Gefühle bilden & ohne die das bloße Überleben nicht nur keinerlei Bedeutung hat, sondern oft zu einer unerträglichen Last und Qual wird. Diejenigen, für die alte Erinnerungen & Besitztümer nicht dieses zentrale Interesse & diese zentrale Lebensnotwendigkeit sind, sollen ruhig salbungsvolle Predigten über die »Abhängigkeit von weltlichen Besitztümern« halten – solange sie ihre Ansichten nicht anderen aufzwingen.
Und worin sieht Lovecraft dieses »Zentrum all seiner Interessen«?
Was mich betrifft, so ist das Einzige, was mir Vergnügen bereitet und wofür ich Interesse aufbringen kann, in meinem Geist vergangene und bessere Tage wiedererstehen zu lassen – denn offen gestanden, habe ich keine Hoffnung, jemals ein mir wirklich angemessenes Umfeld zu finden oder wieder unter zivilisierten Menschen zu leben, die die alten Erinnerungen an die Yankee-Geschichte pflegen. Also muss ich mich, um dem Wahnsinn zu entgehen, der zu Gewalttätigkeit & Selbstmord führt, an den paar Fetzen alter Zeiten und alter Sitten festhalten, die mir übrig geblieben sind. Daher soll niemand von mir erwarten, dass ich die sperrigen Möbel & Gemälde & Uhren & Bücher aufgebe, mit deren Hilfe ich weiterhin von der Angell Street 454 träumen kann. Wenn sie dahin sind, dann werde auch ich dahin sein, denn ohne sie wäre es mir unmöglich, morgens die Augen zu öffnen und einem weiteren bewusst erlebten Tag entgegenzusehen, ohne vor Verzweiflung zu schreien & den Kopf gegen Wand und Fußboden zu hämmern, in der Hoffnung, aus dem Albtraum, den wir Realität nennen, in meinem alten Zimmer in Providence aufzuwachen. Ja, solche Empfindlichkeiten kommen äußerst ungelegen, wenn man kein Geld hat, aber es ist einfacher, sie zu kritisieren, als sie zu heilen. Wenn ein armer Narr, der an ihnen leidet, sich aufgrund einer vorübergehenden perspektivischen Täuschung & Unkenntnis der Welt ins Exil begibt & auf die falsche Bahn gerät, dann ist das einzig Richtige, ihn so lange wie möglich an seinen armseligen Fetzen festhalten zu lassen. Sie sind sein ganzes Leben.7
In diesen herzzerreißenden Sätzen scheinen sich das ganze Elend und die Perspektivlosigkeit von Lovecrafts New Yorker Zeit zu verdichten. Keine Spur mehr von dem selbstbewussten »wenn ich wieder nach Hause komme«. Jetzt sieht Lovecraft »keine Möglichkeit« mehr, jemals in die Heimat zurückzukehren. Wie Lillian darauf reagierte, dass ihr einziger Neffe allen Ernstes – oder zumindest im Ton bittersten Sarkasmus – davon spricht, seinem Leben ein Ende zu machen und mit den Fäusten gegen die Wände zu schlagen, wissen wir nicht. Seltsamerweise scheint das Thema in den folgenden Briefen zwischen den beiden nicht mehr angesprochen worden zu sein.
Es gibt eine merkwürdige, von anderer Seite kolportierte Anekdote, die vielleicht in diesen Zusammenhang gehört. Winfield Townley Scott berichtet, dass Lovecraft, nach Aussage von Samuel Loveman, während der letzten Monate seiner New Yorker Zeit »immer eine Ampulle mit Gift bei sich herumtrug«, um seinem Dasein ein Ende zu machen, wenn seine Lage unerträglich würde.8 Um ehrlich zu sein, halte ich diese Geschichte für einigermaßen absurd. Ich glaube, dass Loveman sie schlicht und einfach erfunden hat. Es gibt jedenfalls keinerlei Bestätigung für den Wahrheitsgehalt dieser Anekdote, und sie wird auch sonst von keinem Freund oder Briefpartner Lovecrafts erwähnt – obwohl man eigentlich vermuten sollte, dass Lovecraft eine so persönliche Sache eher Frank Belknap Long als Loveman anvertraut hätte. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass Lovecraft, selbst in einer so schwierigen Zeit seines Lebens, derart starke suizidale Tendenzen entwickelte. Sogar wenn man Passagen wie die oben zitierte miteinbezieht, ist der allgemeine Ton der Briefe an seine Tanten keineswegs durchgehend bedrückt oder schwermütig. Lovecraft tat alles, was in seiner Macht stand, um seinen Lebensumständen positive Seiten abzugewinnen, und seine historischen Erkundungen und die Gesellschaft enger Freunde bildeten ein echtes Gegengewicht zu seinen drückenden Problemen
Aber wie stand es um sein Verhältnis zu Sonia? Wenn Lovecraft in seinem oben zitierten Brief von »einer vorübergehenden perspektivischen Täuschung« und seiner »Unkenntnis der Welt« spricht, kann sich das eigentlich nur auf seine Ehe mit Sonia beziehen, die er damit für gescheitert erklärt. Etwa um dieselbe Zeit findet sich auch in einem der Briefe von George Kirk an seine Verlobte eine beiläufige Bemerkung, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt: »Urteile nicht zu hart über Mrs. L. Wie schon gesagt, ist sie zurzeit im Krankenhaus. H. machte ziemlich deutlich, dass sie sich trennen werden.«9 Der undatierte Brief, aus dem dieses Zitat entnommen ist, stammt wahrscheinlich aus dem Herbst 1925. Unklar ist allerdings, worauf sich Kirks Bemerkung über Sonias Krankenhausaufenthalt bezieht. Weder in Lovecrafts Briefen an seine Tanten noch anderswo wird ein solcher in dieser Zeit erwähnt. Auch wenn Lovecraft von einer Rückkehr nach Neuengland sprach, war fast immer davon die Rede, dass er sich gemeinsam mit Sonia dort niederlassen wollte. So schreibt er etwa im Juni an Maurice W. Moe: »Der Tumult und die Menschenmassen von N.Y. schlagen ihr aufs Gemüt, wie mir inzwischen auch, und wenn sich die Möglichkeit ergibt, wollen wir diesen Moloch ein für alle Mal hinter uns lassen. Ich … hoffe, den Rest meines Lebens in Neuengland verbringen zu können.«10
In seinen erhaltenen Briefen an Lillian spricht Lovecraft das Thema erst im Dezember wieder an:
Was die Wohnortfrage angeht – du meine Güte, S. H. würde mich nur allzu gern dabei unterstützen, mich dort niederzulassen, wo mein Geist am ehesten Ruhe findet & am produktivsten sein kann! Was ich mit der »Drohung einer Rückkehr nach N. Y.« meinte, war die Frage des Broterwerbs, wie zum Beispiel das Paterson-Projekt. Denn bei meinen mageren Finanzen wäre praktisch jede Möglichkeit zum Geldverdienen etwas, das ich guten Gewissens nicht ausschlagen kann. Solange ich in N. Y. bin, könnte ich so etwas vielleicht mit philosophischem Gleichmut ertragen. Doch wenn ich zurückgekehrt bin, wäre die Aussicht, wieder fortgehen zu müssen, unerträglich. Wenn ich einmal zurück in Neuengland bin, muss ich dort bleiben können – und von da an in Boston oder Providence oder Salem oder Portsmouth nach Stellen suchen, statt meine Augen auf Manhattan oder Brooklyn oder Paterson oder ähnliche entfernte & unvertraute Gegenden zu richten.11
Aus dieser Passage geht klar hervor, dass die Frage zwischen Lovecraft und seiner Tante schon zuvor diskutiert wurde, die »Drohung einer Rückkehr nach N.Y.«, die Lovecraft anführt, findet sich allerdings in keinem der erhaltenen Briefe. Es wird jedoch deutlich, dass Lillian ihm offenbar vorgeschlagen hatte, vorübergehend nach Neuengland zurückzukehren. Eine solche vorübergehende Rückkehr ist für Lovecraft aber ausgeschlossen. Im Folgenden schreibt er, dass »S. H. meinen Plan einer endgültigen Rückkehr nach Neuengland voll und ganz unterstützt & selbst vorhat, in einiger Zeit nach beruflichen Möglichkeiten in der Gegend von Boston Ausschau zu halten.« Dann singt Lovecraft ein Loblied auf Sonia, das trotz seines gestelzten Tons etwas Anrührendes hat:
S. H.s Haltung zu all diesen Fragen ist von solcher Güte & Großherzigkeit, dass jede Absicht einer dauerhaften Trennung meinerseits ein Akt der Barbarei wäre & allen Prinzipien des guten Geschmacks zuwiderlaufen würde, die einen dazu zwingen, eine Hingabe der selbstlosesten Art & ungewöhnlichsten Intensität anzuerkennen und hoch zu schätzen. Niemals habe ich eine bewundernswürdigere Haltung von Uneigennützigkeit & Beflissenheit erlebt, die das beständige Scheitern meiner Bemühungen, finanziell auf eigenen Füßen zu stehen, hinnimmt & verzeiht, sobald es sich als unvermeidlich herausgestellt hat & die selbst meine Aussage akzeptiert …, dass das Einzige, was ich wirklich zum Leben brauche, ein gewisses Maß an Ruhe & Freiheit ist, um mich kreativer literarischer Arbeit widmen zu können … Eine Hingabe, die diese Kombination von Unfähigkeit & ästhetischer Eigensucht ohne Murren hinnehmen kann, obwohl sie doch allen ursprünglich gehegten Erwartungen zuwiderlaufen muss, ist gewiss ein Phänomen, das so selten ist und jener Eigenschaft, die man ehedem als Heiligkeit bezeichnet hat, so nahekommt, dass niemand, der auch nur über den mindesten künstlerischen Sinn für Proportion verfügt, sie anders erwidern kann als mit Hochachtung, Respekt, Bewunderung & Zuneigung …
Diese gewundene Passage deutet darauf hin, dass Lillian in der vorausgegangenen Korrespondenz Lovecraft vorgeschlagen hat, ohne Sonia nach Providence zurückzukehren, woraufhin Lovecraft ausführt, dass eine »dauerhafte Trennung« von Sonia, angesichts ihrer geduldigen und verständnisvollen Haltung ihm gegenüber, moralisch nicht vertretbar wäre. Wenn diese Interpretation richtig ist, dann ist sie ein weiteres Indiz dafür, dass Lillian von Anfang an gegen Lovecrafts Ehe war.
Nach Dezember wurde eine mögliche Rückkehr nach Providence nicht mehr angesprochen, vielleicht, weil alle Beteiligten zunächst abwarten wollten, ob sich die Möglichkeit einer Anstellung in Mortons Museum in Paterson konkretisierte. Drei weitere Monate verstrichen, in denen sich für Lovecraft, abgesehen von seiner vorübergehenden Aushilfstätigkeit beim Adressieren von Briefen, keine Aussicht auf Arbeit ergab, bis er schließlich, am 27. März 1926, die Einladung erhielt, nach Providence zurückzukehren.
Was oder wer genau stand hinter dieser Einladung? Ging sie allein auf Lillians Entscheidung zurück? Hatte Annie ebenfalls mitzureden? Waren andere daran beteiligt? Winfield Townley Scott, der Frank Long dazu befragte, berichtet:
Mr. Long sagt: »Howard ging es immer schlechter, und ich begann zu befürchten, dass er irgendwann die Wände hochgehen würde … Also schrieb ich einen langen Brief an Mrs. Gamwell, in dem ich darauf drang, dass Maßnahmen ergriffen würden, um ihm die Rückkehr nach Providence zu ermöglichen … Er war so tiefunglücklich in New York, dass ich unaussprechlich erleichtert war, als er zwei Wochen später einen Zug nach Providence bestieg.«12
Fünfzehn Jahre später erzählte Long Arthur Koki dieselbe Geschichte.13 In seinen 1975 erschienenen Erinnerungen an Lovecraft stellt er die Angelegenheit jedoch etwas anders dar:
Meiner Mutter wurde schnell klar, dass seine Gesundheit tatsächlich in Gefahr war, wenn ein weiterer Monat ohne Aussicht auf Rettung verging. Also schrieb sie einen langen Brief an seine Tanten, in dem sie die Lage in allen Einzelheiten schilderte. Ich zweifle, ob Sonia je von diesem Brief erfahren hat. Zumindest hat sie ihn nie erwähnt, wenn sie über diese Zeit sprach. Zwei Tage später traf in der Pension in Brooklyn ein Brief von Mrs. Clark ein, dem eine Zugfahrkarte und ein kleiner Scheck beigefügt waren.14
Wer also schrieb den entscheidenden Brief, Long oder seine Mutter? Letzteres ist durchaus möglich: Während ihres etwa einmonatigen Besuchs in New York im Dezember 1924 und Januar 1925 hatte Lillian gemeinsam mit ihrem Neffen häufig die Longs besucht, und anscheinend freundeten sich auch die beiden älteren Damen an. Vielleicht sind jedoch Longs frühere Aussagen, dass er selbst den Brief schrieb, verlässlicher. Nicht zuletzt besteht die Möglichkeit, dass er und seine Mutter ihn gemeinsam verfassten.
In einer Hinsicht sind Longs spätere Erinnerungen jedoch ungenau: Lillians Brief an Lovecraft vom 27. März kann keine Eisenbahnfahrkarte enthalten haben, denn die endgültige Entscheidung, nach Providence zurückzukehren, fiel erst eine Woche später. Nach ihrer ersten Einladung hatte Lillian Lovecraft offenbar vorgeschlagen, sich in Boston oder Cambridge niederzulassen, da sie es für wahrscheinlicher hielt, dass er dort eine seinen Fähigkeiten gemäße Stellung fand. Lovecraft gestand widerwillig, dass dieser Gedanke manches für sich hatte: »Da Providence ein Handelshafen ist, während es sich bei Cambridge um ein kulturelles Zentrum handelt, würde man tatsächlich erwarten, dass letztere Stadt jemandem mit literarischen Neigungen mehr Möglichkeiten bietet.« Doch widerspricht er letztlich der Einschätzung seiner Tante: »Ich bin im Grunde meines Wesens ein Einsiedler, der wenig mit Leuten zu tun haben wird, wo auch immer er sich befindet.« Es folgt ein eindringliches und zugleich melancholisches Plädoyer für Providence:
In jeder Hinsicht bin ich von Natur aus stärker von der Menschheit isoliert als selbst Nathaniel Hawthorne, der allein inmitten der Menge lebte & von dem Salem erst erfuhr, nachdem er gestorben war. Daher können wir grundsätzlich davon ausgehen, dass die Menschen, die einen Ort bevölkern, für mich absolut keine Rolle spielen, außer als Elemente der Landschaft & Szenerie … Mein Leben spielt sich nicht unter Menschen, sondern an Orten ab. Meine Bindungen an einen Ort sind nicht persönlicher, sondern topographischer & architektonischer Natur … Ich bin immer ein Außenseiter – überall & gegenüber jedermann, aber gerade Außenseiter haben ausgeprägte visuelle Vorlieben, was ihre Umgebung betrifft. Unverhandelbar ist für mich allein, dass es Neuengland sein muss – in der einen oder anderen Form. Providence ist ein Teil von mir – Ich bin Providence … Providence ist meine Heimat & wenn ich mein Leben auch nur mit einem Anschein von Frieden, Würde und Schicklichkeit beenden kann, dann dort … Providence wäre immer in meinem Hinterkopf als Ziel, auf das es hinzuarbeiten gilt – ein Paradies, das endlich wiedergewonnen werden muss.15
Ob es dieser Brief war, der den Ausschlag gab, oder nicht, kurz darauf entschied Lillian, dass ihr Neffe nach Providence zurückkehren sollte und nicht nach Boston oder Cambridge. Als seine Tante das Angebot Ende März zum ersten Mal machte, war Lovecraft davon ausgegangen, dass er vielleicht ein Zimmer in der Pension in der Waterman Street 115 beziehen könnte, in der Lillian wohnte. Doch nun schrieb seine Tante, dass sie eine Wohnung für sich und ihren Neffen in der Barnes Street 10 nördlich vom Campus der Brown University gefunden hatte, und fragte Lovecraft, ob sie diese mieten solle. Lovecraft antwortete mit beinahe hysterischer Begeisterung:
Juhu! Peng!! Hurra!!! Um Gottes willen, schnapp dir die Wohnung, ohne eine Sekunde zu zögern!! Ich kann es nicht glauben – das ist zu schön, um wahr zu sein! … Jemand muss mich aufwecken, bevor der Traum so überzeugend wird, dass ich es nicht mehr ertrage aufzuwachen!!!
Ob du die Wohnung nehmen sollst? Was für eine Frage!! Ich kann zwar keine zusammenhängenden Sätze zu Papier bringen, aber ich werde mich gleich ans Packen machen. Barnes Street bei der Brown University! Endlich wieder tief durchatmen nach dem höllischen Dreck hier!!16
Ich habe Briefe wie diesen – in denen sich derartige Ausbrüche oft über Seiten hinweg aneinanderreihen – so ausführlich zitiert, um deutlich zu machen, wie nahe am Rande der Verzweiflung Lovecraft zu dieser Zeit gewesen sein muss. Zwei Jahre lang hatte er sich bemüht, die Dinge in einem positiven Licht zu sehen, und versucht, seine Tante Lillian und vielleicht auch sich selbst davon zu überzeugen, dass seine Übersiedlung nach New York kein Fehler gewesen war. Doch als sich die Möglichkeit bot, nach Hause zurückzukehren, ergriff er sie mit einer Entschiedenheit, die seine Verzweiflung verrät.
Die große Frage war natürlich, wie und ob Sonia in Lovecrafts Rückkehrpläne passte. In seinem Brief vom 1. April bemerkt er beiläufig, »S. H. unterstützt den Entschluss vorbehaltlos – erhielt gestern einen wunderbar großherzigen Brief von ihr«. Fünf Tage später schreibt er: »Ich hoffe, sie betrachtet den Umzug nicht in einem zu schwermütigen Licht oder als etwas, das vom Standpunkt der Loyalität und des guten Geschmacks her kritikwürdig ist.«17 Etwa eine Woche später berichtet Lovecraft seiner Tante, dass »S. H. den kurzfristigen Bostoner Plan aufgegeben hat, mich aber höchstwahrscheinlich nach Providence begleiten wird«.18 Damit ist allerdings nur gemeint, dass Sonia vorhatte, nach Brooklyn zu kommen, um Lovecraft beim Packen zu helfen, und ihn dann nach Providence begleiten wollte, um ihn dabei zu unterstützen, sich dort häuslich einzurichten. Zu diesem Zeitpunkt ging es sicherlich nicht darum, dass sie in Providence leben oder arbeiten sollte.
Und doch stand diese Möglichkeit natürlich im Raum – zumindest für sie, vielleicht auch für ihn. Sonia führt in ihren Erinnerungen jene Zeile aus »He« an, die auch Cook zitiert hatte: »Mir schien es unmöglich, zu meinen Leuten nach Hause zurückzukehren, denn wäre ich nicht unwürdig, wie ein Besiegter heimwärts gekrochen.« Allerdings fügt sie spitz hinzu: »Dies ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Mehr als alles andere wollte er nach Providence zurückkehren, aber er wollte auch, dass ich ihn begleite. Das konnte ich jedoch nicht, da es dort keine beruflichen Möglichkeiten für mich gab, das heißt, keine solchen, die meinen Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprachen.«19 Der vielleicht dramatischste Abschnitt ihrer gesamten Erinnerungen bezieht sich auf diese kritische Periode:
Als er Brooklyn nicht mehr ertragen konnte, war ich selbst es, die ihm vorschlug, nach Providence zurückzukehren. Darauf erwiderte er: »Wenn wir doch nur beide nach Providence gehen könnten, in die gesegnete Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Ich bin mir sicher, dort könnte ich glücklich sein.« Ich stimmte zu: »Nichts wäre mir lieber, als in Providence zu leben, wenn ich dort meine Arbeit tun könnte. Aber in Providence gibt es keine Marktlücke, die ich ausfüllen kann.« Er kehrte daraufhin nach Providence zurück. Ich besuchte ihn lange Zeit später.
H. P. wohnte damals in einer großen Einzimmerwohnung, deren Küche er mit zwei anderen Mietern teilte. Seine Tante, Mrs. Clark, bewohnte ein Zimmer im selben Haus, während Mrs. Gamwell, die jüngere der beiden Tanten, woanders wohnte. Dann berieten wir uns mit den Tanten. Ich schlug vor, dass ich ein großes Haus mieten und ein gutes Hausmädchen anstellen würde, wobei ich für alles aufkommen würde, sodass die beiden Tanten kostenlos bei uns wohnen oder doch zumindest bei gleichen Kosten besser als jetzt leben könnten. H. P. und ich verhandelten auch tatsächlich darüber, ein solches Haus zu mieten, mit einer Kaufoption, falls es uns zusagte. H. P. sollte einen Teil des Hauses als Arbeitszimmer und Bibliothek benutzen, und ich würde den anderen Teil für ein Geschäft nutzen, das ich eröffnen wollte. Zu diesem Zeitpunkt informierten mich die Tanten freundlich, aber bestimmt, dass es weder für sie noch für Howard in Frage käme, dass Howards Ehefrau in Providence für ihren Lebensunterhalt arbeitete. So viel dazu. Jetzt wusste ich, wo wir alle standen. Der Stolz zog es vor, schweigend zu leiden – sowohl ihrer wie auch meiner.20
Dieser Bericht ist in verschiedener Hinsicht problematisch. Zunächst war es definitiv nicht Sonia, die Lovecraft vorschlug, nach Providence zurückzukehren, denn dann hätte Lovecraft seiner Tante Lillian gegenüber kaum mehrfach betont, dass sie diesen Entschluss »unterstützte« oder »guthieß«. Zudem ist es unmöglich, genau zu sagen, wann die besagte »Beratung« zwischen den drei Parteien stattfand. Im Folgenden berichtet Sonia, dass sie ursprünglich eine Arbeit in New York angenommen hatte – was bedeutet, dass sie ihre Stellung in Cleveland aufgegeben hatte –, um näher bei Lovecraft zu sein und vielleicht die Wochenenden in Providence verbringen zu können. Dann erhielt sie jedoch ein Angebot aus Chicago, das zu attraktiv war, um abzulehnen. Sie bat daraufhin Lovecraft, für einige Tage nach New York zu kommen, um sich von ihr zu verabschieden, was Lovecraft auch tatsächlich tat: Im September kehrte er für kurze Zeit nach New York zurück, wobei Sonia allerdings angibt, dass sie bereits im Juli nach Chicago umgezogen sei. Jene »Beratung« könnte also im Frühsommer 1926 stattgefunden haben. Allerdings spricht Sonia davon, dass sie »lange Zeit später« stattfand, was man auch so verstehen könnte, dass sie tatsächlich erst mehrere Jahre später nach Providence kam – vielleicht erst 1929, in dem Jahr, in dem auf ihr Betreiben das Ehescheidungsverfahren in Gang gesetzt wurde.
Der kritische Punkt ist sicherlich der »Stolz«, von dem Sonia spricht. Der Konflikt zwischen den Kulturen und Generationen tritt hier in aller Deutlichkeit hervor: auf der einen Seite die dynamische, vielleicht etwas dominante Geschäftsfrau, die ihre Ehe retten will, indem sie die Dinge selbst in die Hand nimmt. Auf der anderen Seite die beiden verarmten Matronen mit ihren viktorianischen Vorstellungen von Vornehmheit, die es sich nicht »leisten« konnten, dass die Ehefrau ihres einzigen Neffen in jener Stadt, in welcher der Name Phillips noch immer einen gleichsam aristokratischen Klang hatte, ein Geschäft eröffnet, um für den gemeinsamen Lebensunterhalt zu sorgen. Vielleicht sollte man hier auf den genauen Wortlaut von Sonias Erinnerungen achten: Es scheint nicht ausgeschlossen, dass die Tanten sich möglicherweise damit abgefunden hätten, wenn sie ihr Geschäft irgendwo anders als in Providence eröffnet hätte.
Kann man Lovecrafts Tanten aufgrund ihrer Haltung einen Vorwurf machen? Im Neuengland der 1920er-Jahre bedeutete Anstand mehr als ein geregeltes Einkommen, und Lovecrafts Tanten orientierten sich lediglich an dem Verhaltenskodex, der ihr gesamtes Leben lang ihr Handeln geprägt hat. Wenn man an irgendjemandem Kritik üben kann, dann an Lovecraft. Gleichgültig, ob er seinen Tanten in dieser Frage zustimmte oder nicht – und ich vermute, dass er trotz seiner viktorianischen Erziehung zu diesem Zeitpunkt anderer Meinung war –, hätte er entschiedener versuchen können, seinem eigenen Standpunkt Geltung zu verschaffen und zwischen Sonia und seinen Tanten einen Kompromiss zu vermitteln. Stattdessen scheint er sich auf die Rolle des untätigen Zuschauers beschränkt und seinen Tanten die Entscheidung überlassen zu haben. All das deutet darauf hin, dass er seine Ehe mit Sonia beenden oder auf die Ebene eines rein brieflichen Kontakts verlagern wollte, was dann auch für die nächsten Jahre geschah. Sein einziger Wunsch war, nach Providence zurückzukehren. Sonia konnte sehen, wo sie blieb.
Wie sollen wir Lovecrafts zweijähriges Intermezzo im Hafen der Ehe beurteilen? Sicherlich kann man jeder der beteiligten Parteien Vorwürfe machen. Lovecrafts Tanten für ihre Vorbehalte gegen die Verbindung zwischen Lovecraft und Sonia und wegen ihrer mangelnden finanziellen und emotionalen Unterstützung des gebeutelten Paars. Sonia, weil sie meinte, Lovecraft nach ihren Wünschen formen zu können. Und natürlich Lovecraft, für seine Gedankenlosigkeit, seinen Mangel an Rückgrat, seine Unfähigkeit, Gefühle zu zeigen, und sein berufliches Versagen.
Aus Sonias Erinnerungen geht ziemlich deutlich hervor, dass sie in Lovecraft eine Art Genie im Rohzustand sah, das sie nach ihren eigenen Vorstellungen formen wollte. Dass Sonia sicherlich nicht die einzige Frau ist, die mit derartigen Vorstellungen in die Ehe geht, entschuldigt ihr Verhalten nur unzureichend. Erwähnt sei nur die tragikomische Episode, als Sonia Lovecraft zwang, sich einen neuen Anzug anzuschaffen, weil ihr der antiquierte Schnitt seiner alten nicht gefiel. Erinnern wir uns auch daran, wie sie Lovecraft mästete, um ihm sein »ausgehungertes« Aussehen auszutreiben. In einem weiteren Sinne wollte sie seine ganze Persönlichkeit verändern – vordergründig, um ihm zu helfen, in Wahrheit jedoch, damit er mehr ihren Vorstellungen entsprach, so etwa, wenn sie Lovecraft mit Samuel Loveman zusammenbrachte, um ihn von seinen Vorurteilen gegen Juden zu »heilen«. Im Hinblick auf die gegenseitigen Spitznamen Sokrates und Xanthippe gibt sie ihrem Glauben an Lovecrafts »sokratische Weisheit und Genie« Ausdruck und fährt fort:
Das war es, was ich in ihm spürte. Ich hatte gehofft, ihn mit der Zeit noch menschlicher zu machen, indem ich ihn auf den Pfad der Ehe und der wahren Liebe führte. Ich fürchte, dass mein Optimismus und mein übertriebenes Selbstvertrauen mich haben in die Irre gehen lassen – und ihn vielleicht auch. Ich habe große Geistesgaben stets mehr bewundert als alles andere auf der Welt (vielleicht auch, weil sie mir so sehr fehlen) und hatte die Hoffnung, H. P. aus dem bodenlosen Abgrund seiner Einsamkeit und seiner psychischen Komplexe herauszuhelfen.21
An dieser Stelle kommt Sonia dem Bekenntnis, dass sie zumindest eine Mitschuld am Scheitern ihrer Ehe trug, am nächsten. Ob ihre Amateurpsychoanalyse Lovecrafts einen Erkenntniswert hat, wage ich nicht zu entscheiden. Möglicherweise hat sie recht, wenn sie Lovecrafts grundlegendes Bedürfnis nach Einsamkeit betont und darauf hinweist, dass er unfähig oder nicht Willens war, eine tiefere emotionale Beziehung mit irgendjemandem außerhalb seines engsten Familienkreises einzugehen.
Es spricht jedoch manches dafür, dass Sonia hätte wissen können, worauf sie sich einließ. »Ganz am Anfang unserer Romanze«, so erinnert sie sich, schickte ihr Lovecraft ein Exemplar von George Gissings Roman The Private Papers of Henry Ryecroft (1903).22 Sonia nennt keinen expliziten Grund, warum Lovecraft ihr das Buch sandte, aber es liegt nahe, dass er damit versuchte, ihr zumindest einige Hinweise auf seinen Charakter und sein Temperament zu geben. Merkwürdigerweise erwähnt Lovecraft Gissings Buch gegenüber keinem seiner anderen Korrespondenten, doch steht außer Frage, dass es eine Vielzahl suggestiver Passagen enthält.
Gissings Roman ist das vorgebliche Tagebuch eines verarmten Schriftstellers, der in vorgerücktem Alter eine unerwartete Erbschaft macht, die es ihm erlaubt, sich aufs Land zurückzuziehen. Er verbringt seine Zeit damit, ein Tagebuch zu führen, aus dem Gissing als »Herausgeber« eine Auswahl von Einträgen präsentiert, die nach der Abfolge der Jahreszeiten angeordnet sind. The Private Papers of Henry Ryecroft ist in der Tat ein sehr eindringliches Werk, allerdings nur, wenn man mit den von Ryecroft zum Ausdruck gebrachten Ansichten übereinstimmt. Viele moderne Leser würden diese Ansichten jedoch vermutlich als abstoßend oder zumindest überholt empfinden. Sonia weist selbst darauf hin, dass sich in Henry Ryecroft dieselbe Haltung gegenüber Minderheiten artikuliert, die auch Lovecraft vertrat, wenngleich dieses Thema in dem Roman auch eher am Rande abgehandelt wird. Einen breiteren Raum nehmen Ryecrofts Ansichten über die Kunst und im weiteren Sinne über die Gesellschaft ein.
Obwohl Ryecroft einen großen Teil seines Lebens damit verbracht hat, Texte zum Broterwerb zu verfassen, hat er diese Tätigkeit immer gehasst und ist nun in der Lage, seiner Verachtung für die Lohnschreiberei freien Lauf zu lassen. Die Schriftstellerei ist kein »Beruf« oder sollte es zumindest nicht sein: »O du Schwerbeladener, der du dich in dieser Stunde zur verfluchten Arbeit der Feder niederlässt. Der du nicht deshalb schreibst, weil du etwas in deinem Geist oder deinem Herzen trägst, das zwingend nach Ausdruck verlangt, sondern weil die Feder das einzige Werkzeug ist, mit dem du umgehen kannst, das einzige Mittel, dein Brot zu verdienen!«23 Dieser Gedanke führt Ryecroft dazu, auch die Masse der Menschen zu verachten, die derart leblose Werke lesen. »Ich bin kein Freund des Volkes«, erklärt er unumwunden – ein Satz, den Sonia in ihren Erinnerungen zitiert.24 »Die Demokratie«, so fährt Ryecroft in einer Passage fort, die Lovecraft sicherlich aus dem Herzen sprach, »steckt voller Bedrohungen für die höheren Bestrebungen der Menschheit …«25
In den persönlicheren Passagen des Tagebuchs lässt Gissing Ryecroft über sich selbst und seine Fähigkeit, Gefühle zu haben und zu zeigen, nachgrübeln. Obwohl er selbst Witwer ist und eine erwachsene Tochter hat, erklärt Ryecroft: »Glaube ich, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt meines Lebens die Art von Mann war, der es verdient hat, geliebt zu werden? Ich vermute, nein. Ich war stets zu sehr mit mir selbst beschäftigt, zu kritisch gegenüber allem um mich herum, zu grundlos stolz.«26 Auch Ryecrofts Verteidigung der Prüderie wird Lovecrafts vorbehaltlose Zustimmung gefunden haben:
Wenn Prüderie die Eigenschaft einer im Geheimen lasterhaften Person bezeichnet, die übertriebenen Wert auf äußere Schicklichkeit legt, dann soll die Prüderie mit allen Mitteln ausgerottet werden, selbst wenn man damit eine gewisse Schamlosigkeit in Kauf nimmt. Wenn andererseits jemand als prüde bezeichnet wird, der ein anständiges Leben führt und entweder aus Neigung oder aus Prinzip eine vielleicht etwas übersteigerte Zartheit des Denkens und Sprechens im Hinblick auf die grundlegenden Tatsachen der menschlichen Natur kultiviert, dann kann ich nur mit äußerstem Nachdruck betonen, dass es sich dabei für mich um einen Fehler handelt, der in Wirklichkeit eine Tugend ist, deren Geltung ich auf keinen Fall schwinden sehen will.27
Wie kann man hier nicht an Lovecrafts Brief an Sonia denken, in dem er die Sexualität als eine vorübergehende und irrationale jugendliche Leidenschaft beschreibt, über die das »reife Erwachsenenalter« erhaben sein sollte. Oder erinnern wir uns an Lovecrafts überempfindliche Reaktion auf die bloße Erwähnung des Wortes »Sex«. Sonia hat recht, wenn sie schreibt, dass man The Private Papers of Henry Ryecroft lesen sollte, um Lovecraft zu verstehen. Mit seiner engen Beziehung zu seinem Zuhause, seiner Verachtung der Gesellschaft, seiner Liebe zu Büchern und in vielerlei anderen Hinsichten weist Ryecroft eine geradezu unheimliche Ähnlichkeit mit Lovecraft auf.
Vielleicht hätte Sonia schon aus der Lektüre von Henry Ryecroft schließen können, dass Lovecraft einen gänzlich ungeeigneten Ehemann abgeben würde. Allerdings überschätzte sie in ihrem »übertriebenen Selbstvertrauen« ihre eigenen Möglichkeiten und glaubte, sie könne Lovecraft von seinen »Komplexen« erlösen und ihn, wenn auch nicht zu einem im konventionellen Sinne beruflich erfolgreichen Ehemann, so doch zu einem aufgeschlosseneren, liebevolleren Menschen und einem noch besseren Schriftsteller machen. Ich zweifle nicht daran, dass sie Lovecraft aufrichtig liebte, dass sie ihn mit den besten Absichten heiratete und das an ihm fördern wollte, was sie für seine besten Eigenschaften hielt.
Es scheint wenig sinnvoll, Lovecraft für seine vielen Unzulänglichkeiten als Ehemann posthum zu schulmeistern, aber vieles an seinem Verhalten ist tatsächlich unentschuldbar. Am unentschuldbarsten ist vielleicht sein Entschluss, überhaupt zu heiraten, ein Entschluss, den er offensichtlich fasste, ohne sich im Geringsten der Schwierigkeiten und Herausforderungen einer Ehe bewusst zu sein und ohne sich auch nur die geringsten Gedanken zu machen, wie ungeeignet er als Ehemann war. Lovecraft war ein Mann mit einem ungewöhnlich schwach entwickelten Sexualtrieb, einer tiefverwurzelten Liebe zu seiner Heimatregion und tiefsitzenden Vorurteilen gegen ethnische Minderheiten, der sich Hals über Kopf dazu entschloss, eine Frau zu heiraten, die, obwohl deutlich älter als er, eindeutig nicht nur eine intellektuelle, sondern auch eine erotische Beziehung wünschte. Dieser Mann entschied sich, die Stadt seiner Geburt zu verlassen und in eine geschäftige, kosmopolite und ethnisch vielfältige Metropole zu ziehen, ohne dort für seinen Lebensunterhalt sorgen zu können und offenbar völlig zufrieden mit Aussicht, so lange von seiner Frau finanziell unterstützt zu werden, bis er eine ihm gemäße Arbeit gefunden hat.
Nach der Heirat war Lovecrafts Verhalten gegenüber Sonia von erstaunlicher Rücksichtslosigkeit. Er fand es offensichtlich unterhaltsamer, seine Abende und Nächte im Kreis seiner Freunde zu verbringen, und hielt es schon bald nicht mehr für nötig, wenigstens so früh nach Hause zu kommen, dass er mit seiner Frau gemeinsam zu Bett gehen konnte, obwohl ihr das erklärtermaßen wichtig war. Zwar unternahm er in seinem ersten New Yorker Jahr echte Anstrengungen, Arbeit zu finden, gab den Versuch danach aber praktisch auf. Nachdem ihm einmal klar geworden war, dass ihm das Leben als verheirateter Mann nicht zusagte, scheint er völlig zufrieden damit gewesen zu sein, seine Ehe auf eine Fernbeziehung in Briefen zu beschränken, als Sonia sich 1925 gezwungen sah, in den Mittleren Westen zu ziehen.
Doch gibt es auch eine Reihe von mildernden Umständen: Nachdem der Zauber von New York einmal verfolgen war, verschlechterte sich Lovecrafts Gemütszustand rapide. Zu welchem Zeitpunkt spürte er, dass er einen Fehler gemacht hatte? Glaubte er, dass Sonia in irgendeiner Weise für seine Misere verantwortlich war? Vielleicht ist es kein Wunder, dass er eher im Kreis seiner Freunde Trost fand als in Gesellschaft seiner Frau.
Drei Jahre nach dem Debakel blickte Lovecraft auf seine Ehe zurück, und seinen Worten ist nicht viel hinzuzufügen. Obwohl er später behauptete, dass seine Ehe »zu 98% aus finanziellen Gründen« scheiterte,28 gibt er hier unumwunden zu, dass es grundlegende charakterliche Differenzen waren, die letztlich zum Bruch geführt hatten:
Ich habe keinerlei Zweifel daran, dass die Ehe eine äußerst hilfreiche und angenehme dauerhafte Einrichtung sein kann, wenn beide Parteien das Potenzial zu einem übereinstimmenden geistigen und gefühlsmäßigen Leben haben – gleiche oder zumindest für den anderen begreifliche Reaktionen auf die wichtigsten Elemente der Umwelt, der Lektüre, der geschichtlichen und philosophischen Gedankenwelt usw.; einander entsprechende Bedürfnisse und Anforderungen hinsichtlich des geographischen, sozialen und intellektuellen Milieus … Mit einer Ehefrau vom Temperament meiner Mutter oder meiner Tanten wäre es mir vielleicht gelungen, ein häusliches Leben aufzubauen, das dem der Angell Street vergangener Tage nicht ganz unähnlich gewesen wäre, auch wenn ich in der häuslichen Hierarchie einen anderen Rang eingenommen hätte. Doch die Jahre ließen grundlegende und wesentliche Unterschiede in unseren Reaktionen auf die verschiedenen Orientierungspunkte im Strom der Zeit hervortreten, ebenso wie entgegengesetzte Wünsche und Vorstellungen im Hinblick auf das, was bei der Planung eines gemeinsamen Lebensmilieus wichtig ist. Was dort zusammenprallte, waren die abstrakt-traditionelle-individuelle-vergangenheitsbezogene-apollinische Lebensanschauung und die konkret-emotionale-in-der-Gegenwartheimische-soziale-ethische-dionysische Lebensanschauung. Und angesichts dieser Gegensätze führte die ursprünglich vermutete Seelenverwandtschaft, die auf ähnlichen Enttäuschungen, philosophischen Neigungen und Empfänglichkeit für das Schöne beruhte, einen aussichtslosen Kampf.29
So abstrakt diese Analyse klingen mag, so zeigt sie doch, dass Lovecraft das grundsätzliche Problem klar erfasst hat: Er und Sonia passten von ihren Temperamenten her schlicht nicht zusammen. Und auch wenn Lovecraft behauptet, sich eine gelungene Ehe mit einer Frau, die ihm, seiner Mutter oder seinen Tanten charakterlich ähnlicher wäre, vorstellen zu können, macht er an anderer Stelle desselben Briefes deutlich, dass die Ehe, auch wenn er sie als gesellschaftliche Institution verteidigt, für ihn als Lebensform nicht in Betracht kommt:
… Gegen die Institution der Ehe als solche habe ich nichts einzuwenden. Aber ich glaube, dass die Erfolgsaussichten für einen ausgesprochenen Individualisten, der zudem höchst eigensinnig und mit einer ausgeprägten Vorstellungskraft ausgestattet ist, verdammt klein sind. Es steht hundert zu eins, dass die vier oder fünf Versuche, die er machen würde, sich als Schüsse in den Ofen erweisen, die für ihn wie für seine Leidensgefährtin gleichermaßen bedrückend wären. Wenn er also ein kluger Junge ist, dann lässt er nach dem Scheitern des ersten Versuchs die Finger davon … und wenn er besonders klug ist, dann verzichtet er sogar auf den ersten Versuch! Abstrakt gesehen mag die Ehe der Normalzustand und grundlegend für das gesellschaftliche Leben sein usw., aber für einen Mann des Geistes und der Phantasie ist nichts im Himmel und auf Erden so wichtig wie die Unantastbarkeit seines geistigen Lebens – das Gefühl, eins mit sich selbst zu sein und als stolzes, einsames Einzelwesen dem grenzenlosen Kosmos in trotziger Unabhängigkeit gegenüberzustehen.
Das ist so ziemlich Lovecrafts letztes Wort zu diesem Thema.
Sonia ihrerseits ist bemerkenswert zurückhaltend, was ihre Meinung zum Scheitern der Ehe betrifft. In ihren Erinnerungen scheint sie die Schuld zumindest teilweise Lovecrafts Tanten zu geben, die ihr Veto dagegen einlegten, dass sie in Providence ein Geschäft eröffnete. In einem Anhang zu ihren Erinnerungen, der die Überschrift »Re Samuel Loveman« trägt, schildert sie allerdings ausführlich, wie Lovecrafts Rassismus während seiner New Yorker Zeit immer virulenter wurde, und schließt: »Um die Wahrheit zu sagen, war es diese Haltung gegenüber Minderheiten und der Wunsch, der Berührung mit ihnen zu entgehen, die ihn zurück nach Providence leiteten.«30 Sonia führt diesen Punkt in einem Brief an Samuel Loveman weiter aus, wo sie bestreitet, dass die Ehe an Lovecrafts Unfähigkeit zerbrach, für den gemeinsamen Lebensunterhalt zu sorgen: »Ich habe ihn nicht deshalb verlassen, weil er nicht für mich sorgen konnte, sondern vor allem, weil er ständig darauf herumritt, wie sehr er die J… hasste. Das, und nur das war der wirkliche Grund.«31 Diese Aussage erscheint eindeutig, und ich glaube, wir müssen sie zumindest als einen – und vielleicht den wichtigsten – Grund für das Scheitern dieser Ehe akzeptieren. Es gab finanzielle Probleme und charakterliche Diskrepanzen, doch all dies wurde überlagert oder verschärft durch Lovecrafts wachsenden Hass auf New York und seine Einwohner auf der einen und Sonias Unfähigkeit, die Mauer seiner eingewurzelten Vorurteile zu durchbrechen, auf der anderen Seite.
Äußerst bemerkenswert ist, dass Lovecraft in späteren Jahren die Tatsache, dass er verheiratet gewesen war, schlicht verschwieg. Wenn er neuen Briefpartnern die Eckdaten seines Lebens skizzierte, dann erwähnte er zwar seine Zeit in New York, nicht jedoch seine Ehe mit Sonia. Nur, wenn ein Korrespondent ihn direkt fragte, ob er je verheiratet gewesen war, gab er es zu. Ein Brief an Donald Wandrei aus dem Jahre 1927 ist in dieser Hinsicht typisch: »Neun von zehn meiner besten Freunde wohnen durch Zufall oder Notwendigkeit in New York & vor drei Jahren dachte ich, dass es auch für mich logisch wäre, mich dort niederzulassen. Also verschiffte ich meine Habseligkeiten im März 1924 dorthin & blieb bis April 1926, als ich zu der Überzeugung gekommen war, dass ich diesen abscheulichen Ort unter keinen Umständen länger ertragen konnte.«32 Hier geht Lovecraft so weit zu behaupten, dass er nur wegen seiner »Freunde« nach New York gekommen sei! Wenn diese Zurückhaltung gegenüber neuen Bekanntschaften vielleicht noch entschuldbar ist – schließlich war Lovecraft nicht verpflichtet, gegenüber irgendjemandem seine persönlichen Verhältnisse offenzulegen –, so gilt dies weniger für die »offiziellen« autobiographischen Texte, die er in den letzten zehn Jahren seines Lebens verfasste. In ihnen erweckt er den Eindruck, als hätten sein Aufenthalt in New York und seine Ehe nie stattgefunden.
Andererseits waren die erbärmlichen Umstände seiner New Yorker Existenz, insbesondere während seiner Zeit in der Clinton Street, und sein Abscheu vor der Metropole und allem, was sie verkörperte, Themen, von denen er nie genug bekam. Rückblickend beschreibt er seine damalige desolate Situation geradezu lustvoll:
Die Grundstimmung der ganzen Szenerie – Haus, Gegend und Geschäft –, war eine Atmosphäre widerwärtigen, schleichenden Verfalls. Dieser wurde von den Überresten vergangener Pracht und Schönheit gerade so weit verdeckt, um einer Ödnis und Schäbigkeit, die sonst statisch und prosaisch gewirkt hätten, Schrecken, Geheimnis und eine Aura kriechender Bewegung zu verleihen. Ich bildete mir ein, dass das riesige Mietshaus ein bösartiges, empfindungsfähiges Wesen war – eine tote, vampirische Kreatur, die denen, die in ihr wohnten, etwas aussaugte und ihnen die Samen irgendeiner schrecklichen und körperlosen psychischen Wucherung einpflanzte. Hinter jeder verschlossenen Tür schien ein brütendes Verbrechen zu lauern – oder eine Blasphemie, die zu abgründig war, um im primitiven und oberflächlichen Verständnis unserer Welt als Verbrechen zu gelten. Ich habe die genaue Topographie dieses weitläufigen und riesenhaften Hauses nie begriffen. Ich wusste, wie ich in mein Zimmer kam und in Kirks Zimmer, wenn er zu Hause war, und zur Wohnung der Vermieterin, um meine Miete zu bezahlen oder vergeblich wegen der Heizung zu fragen, bis ich mir einen eigenen Ölofen anschaffte. Aber es gab Flügel und Treppenhäuser, die ich immer nur abgeschlossen sah. Ich wusste, dass es in manchen Stockwerken fensterlose Zimmer gab, und konnte mir ausmalen, was sich in den unterirdischen Teilen des Hauses befand.33
Wenn in dieser Schilderung eine gewisse spielerische Übertreibung mehr als deutlich ist, so sind andere Bemerkungen über seine New Yorker Zeit alles andere als spielerisch:
In New York konnte ich nicht leben. Alles, was ich sah, wurde unwirklich & zweidimensional & alles, was ich dachte & tat, wurde trivial & sinnlos, da es mir an Bezugspunkten fehlte, die zu irgendeiner Struktur gehörten, der ich mich hätte zugehörig fühlen können. Ich war dabei zu ersticken – vergiftet – gefangen in einem Albtraum & heute könnte mich selbst die Drohung mit ewiger Verdammnis nicht dazu bringen, noch einmal an diesem verfluchten Ort zu verweilen.34
All diese Empfindungen schildert Lovecraft zwar auch in Erzählungen wie »He«, doch gewinnen sie als unmittelbare persönliche Bekenntnisse ohne den dünnen Schleier der Fiktion noch einmal an Eindringlichkeit. Es spricht für sich, dass Lovecraft seiner Tante Lillian derartige Einblicke in seinen Geisteszustand erst ganz am Ende seiner New Yorker Zeit gewährte: Wären sie nicht ein Eingeständnis gewesen, dass er »unwürdig, wie ein Besiegter« heimwärts gekrochen kam?
Lovecraft hatte natürlich jedes Recht der Welt, New York zu verabscheuen. Problematisch ist allerdings seine Annahme, dass jedes »normale« oder gesunde Individuum seine Auffassung teilen müsse. Das Grundthema dieser Tiraden sind natürlich die »Fremden«, die nach Lovecrafts Auffassung die Stadt überflutet haben. Doch ich glaube nicht, dass Lovecrafts Empfindungen sich auf bloßen Rassismus reduzieren lassen. Die »Fremden« sind vielmehr ein besonders augenfälliges Sinnbild dafür, wie weit New York von den Maßstäben entfernt war, die in Lovecrafts bisherigem Leben Gültigkeit gehabt hatten:
In einer farblosen oder monotonen Umgebung würde ich wahrscheinlich an seelischer Auszehrung zugrunde gehen – und New York hat mich tatsächlich beinahe umgebracht! Ich muss feststellen, dass mein Wohlbefinden in erster Linie von Schönheit & Atmosphäre abhängt, wie sie sich in malerischen Stadtpanoramen & in alten, von Landwirtschaft und Wald geprägten Landschaften manifestieren. Meine Umgebung muss kontinuierlich aus der Vergangenheit gewachsen sein – tatsächlich habe ich schon vor langer Zeit begriffen, dass die Liebe zur Vergangenheit die hauptsächliche Triebkraft meines Lebens ist.35
Doch spätestens dann, wenn er dieses Credo auf seine New Yorker Erfahrungen anwendet, unterliegt Lovecraft einem Trugschluss: Er nimmt an, dass es die Einwanderer sind, die New Yorks »natürliche« Entwicklung gestört haben – offenbar durch ihre bloße Anwesenheit. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass Lovecraft New York immer wieder mit damals noch vorwiegend »angelsächsischen« Städten wie Boston oder Philadelphia kontrastiert. Manchmal gewinnt Lovecrafts Perspektive eine geradezu absurde Komik: »New York verkörpert einen so atemberaubenden Zusammenbruch & Verfall – eine so abscheuliche Verdrängung kraftvollen und gesunden Erbguts durch charakterlosen, kriecherischen, verschlagenen Abschaum und menschlichen Bodensatz –, dass ich nicht begreife, wie irgendjemand dort längere Zeit leben kann, ohne ernsthaft krank zu werden.«36 Merkwürdig nur, dass es diesem kriecherischen Abschaum gelungen ist, die kraftvollen Arier zu verdrängen.
Letztlich dienten derartige Tiraden jedoch vor allem einem psychologischen Zweck: New York ist für Lovecraft jetzt das »Andere«, ein Symbol für alles, was in der modernen amerikanischen Zivilisation im Argen liegt. Es überrascht nicht, dass Lovecraft in den späten 1920er-Jahren, obwohl er wieder in die behagliche und vertraute Umgebung von Providence zurückgekehrt war, begann, seine Vorstellungen vom Niedergang der westlichen Zivilisation zu entwickeln – Vorstellungen, die er anhand der Lektüre Spenglers präzisierte und weiterentwickelte.
Inzwischen stand jedoch der eigentliche Umzug von Brooklyn nach Providence bevor. In der ersten Aprilhälfte sind Lovecrafts Briefe an seine Tanten voll von praktischen Details: welche Umzugsfirma er beauftragen soll, wie er seine Bücher und anderen Besitztümer am besten verpackt, wann er in Providence eintreffen wird usw. Wie bereits erwähnt, hatte Sonia sich einige Tage freigenommen, um nach Brooklyn zurückzukehren und Lovecraft beim Umzug zu helfen. In ihren Erinnerungen kommentiert sie leicht gereizt die Aussage von W. Paul Cook, dass Lovecrafts Tanten »einen Lastwagen schickten, der Howard mit all seinen Habseligkeiten nach Providence zurückbrachte«. Sonia hält dem entgegen, dass sie »extra in die Stadt zurückkam, um ihm dabei zu helfen, seine Sachen zu packen, und dafür zu sorgen, dass alles in Ordnung war, bevor ich wieder abreiste. Und ich war es, die für den Umzug – einschließlich seiner Zugfahrkarte – bezahlte.«37 Sonia kam am Sonntag, dem 11. April, morgens in New York an. Am Sonntagabend kehrten Lovecraft und sie noch einmal nach Flatbush, in ihre alte Gegend, zurück, aßen Eis, sahen einen Film in Kino an und kamen spät nach Hause zurück. Den nächsten Tag verbrachten sie auf ähnliche Art: Sie sahen sich eine Verfilmung von Cyrano de Bergerac an und aßen im Elysée in der 56. Straße zu Abend. Lovecraft bemerkt, dass Sonia damit versuchen wollte, »mir in gewissem Maße meine extreme Abneigung gegen New York zu nehmen & mir zum Abschied einige günstigere Eindrücke einzuprägen«.38 Obwohl dies offenbar nicht gelang, sprang für Lovecraft zumindest noch ein üppiges Abendessen heraus, das aus Obstsalat, Suppe, Lammkoteletts, Pommes Frites, Erbsen, Kaffee und Kirschkuchen bestand.
Am Dienstag, dem 13. April, waren Lovecrafts Sachen vollständig verpackt, sodass ihm noch Zeit blieb, einem letzten Treffen des Kalem Club bei Frank Long beizuwohnen, zu dem sich auch Morton, Loveman, Kirk, Kleiner, Orton und Leeds einfanden. Longs Mutter hatte ein Abendessen vorbereitet, und wie immer verging der Abend unter geistvollen Gesprächen. Um halb zwölf trennten sich die Freunde, und Lovecraft und Kirk entschlossen sich, zu einer letzten gemeinsamen nächtlichen Wanderung durch New York aufzubrechen. Sie gingen von der Wohnung der Longs an der Ecke West End Avenue und 100. Straße bis zur Battery an der Südspitze Manhattans. Lovecraft kam erst um sechs Uhr morgens nach Hause, stand jedoch bereits um zehn wieder auf, um die Arbeiter der Umzugsfirma in Empfang zu nehmen.
Lovecrafts Brief an seine Tante Lillian vom 15. April ist der letzte Brief vor dem eigentlichen Umzug, den wir kennen, sodass wir nicht wissen, wie genau er die letzten zwei Tage verbrachte. Am Samstag, dem 17. April, nahm er morgens einen Zug – wahrscheinlich von der Grand Central Station – und kam am frühen Nachmittag in Providence an. Er schildert den letzten Abschnitt dieser Reise in einem berühmten Brief an Frank Long:
Nun – der Zug raste weiter, und ich wurde von stillen Glückskrämpfen erschüttert, während ich nach und nach in ein waches und dreidimensionales Leben zurückkehrte. New Haven – New London – und dann das malerische Mystic mit seinen am Hang gelegenen Häusern aus der Kolonialzeit und der landumschlossenen Bucht. Dann endlich erfüllte eine noch subtilere Magie die Luft – edlere Dächer und Kirchtürme, die der Zug auf seinem Viadukt in luftigen Höhen passierte – Westerly – und ich war wieder in der königlichen Provinz RHODE-ISLAND & PROVIDENCE PLANTATIONS! GOTT SCHÜTZE DEN KÖNIG! Was folgte, war ein Rausch – Kingston – East Geenwich mit seinen steilen georgianischen Gassen, die von der Bahnlinie aus den Hang hinauf klettern – Apponaug und seine alten Dächer – Auburn, kurz vor der Stadtgrenze – ich hantiere in einem verzweifelten Versuch, ruhig zu erscheinen, mit Koffern und Taschen – DANN – eine aus einer Fieberphantasie entsprungene Marmorkuppel vor dem Zugfenster – die Luftdruckbremsen zischen – der Zug wird langsamer – ekstatisches Schaudern, und die Wolken, die meine Augen und meinen Geist umfangen hatten, lichten sich – ZU HAUSE – UNION STATION – PROVIDENCE!!!! 39
Der gedruckte Text vermittelt nur einen unvollkommenen Eindruck: Im Original wird Lovecrafts Handschrift gegen Ende immer größer, bis die Lettern des letzten Wortes eine Größe von zweieinhalb Zentimetern erreicht haben. Es ist zudem vierfach unterstrichen und mit vier Ausrufungszeichen versehen. Maurice Lévy bemerkt zu recht: »Der Bericht von dieser mythischen Heimkehr hat etwas Bewegendes, etwas, das eine wesentliche, ursprüngliche Erfahrung zum Ausdruck bringt.«40
Der gesamte Brief an Long, den Lovecraft zwei Wochen nach seiner Rückkehr schrieb, gewährt erstaunliche Einblicke. Im Grunde gab Lovecraft vor, dass es seine beiden New Yorker Jahre schlicht nicht gegeben hatte: dass sie ein »Traum« gewesen waren, aus dem er nun erwacht sei. Natürlich war das metaphorisch gemeint, aber in der Metapher schwingt ein aufrichtiges Empfinden mit: » … 1923 – 1924 – 1925 – 1926 – 1925 – 1924 – 1923 – Rumms! Zwei Jahre zum Schlechteren, aber wer zur Hölle schert sich darum? 1923 endet – 1926 fängt an! … Was haben ein oder zwei blinde Flecken in einem Lebenslauf schon zu bedeuten?« Vielleicht sollte man Lovecraft diesen Moment der Wunscherfüllung gönnen. Bald schon begriff er, dass er mit seinen beiden New Yorker Jahren irgendwie zurechtkommen und sein Leben entsprechend neu ausrichten musste. Sosehr er sich vielleicht auch nach der sorglosen Existenz vor seiner Hochzeit zurücksehnte, so wusste er doch, dass sie letztlich nur eine Phantasie war. Die folgenden elf Jahre bestätigen meiner Ansicht nach W. Paul Cooks berühmte Bemerkung: »Er kam als Mensch nach Providence zurück – und als was für ein Mensch! Er war im Feuer geläutert worden, und was herauskam, war pures Gold.«41
Hat Sonia Lovecraft zurück nach Providence begleitet? Sein Brief an Long ist in dieser Hinsicht merkwürdig unklar: Auf den gesamten zehn Seiten erwähnt er Sonia kein einziges Mal namentlich, und die ersten Abschnitte sind ausschließlich in der ersten Person Singular gehalten. Aber vielleicht war Long so gut mit der Situation vertraut, dass Lovecraft es nicht für nötig hielt, genauere Angaben zu machen. Am wahrscheinlichsten scheint es, dass Sonia Lovecraft nicht auf seiner Heimreise begleitete, sondern ihn ein paar Tage später besuchte, um ihm zu helfen, sich einzurichten. Lovecraft bestätigt diese Vermutung indirekt, indem er gegen Ende seines Briefes an Long in die erste Person Plural wechselt.42 Nachdem sie einige Tage damit verbracht hatten, Lovecrafts Habseligkeiten auszupacken, fuhren Lovecraft und Sonia am Donnerstag, dem 22. April, nach Boston, und am folgenden Tag erkundeten sie den Neutaconkanut Hill an der westlichen Stadtgrenze von Providence, den Lovecraft bereits im Oktober 1923 besucht hatte. Es ist unklar, wann Sonia nach New York zurückkehrte, aber sie blieb wahrscheinlich nicht viel länger als eine Woche.
Cook gibt eine pointierte Schilderung von Lovecrafts Zustand unmittelbar nach seiner Ankunft in Providence:
Ich sah ihn in Providence nach seiner Rückkehr aus New York, noch bevor er all seine Sachen ausgepackt und sein Zimmer eingerichtet hatte. Er war fraglos der glücklichste Mensch, den ich je gesehen habe. Er hätte für ein »davor … danach«-Bild in einer Medikamentenwerbung posieren können. Er hatte seine Medizin genommen, und es war offensichtlich, dass sie ihm gut bekommen war. Mit geradezu zärtlichen Gesten stellte er jedes Ding an seinen Platz, und seine Augen leuchteten, wenn er zum Fenster hinaussah, wie die eines Verliebten. Er war so glücklich, dass er vor sich hin summte – wenn er die notwendigen Organe besessen hätte, dann hätte er geschnurrt.43
In Lovecrafts Brief an Long ist eine detaillierte Skizze des geräumigen Ein-Zimmer-Apartments mit Kochnische enthalten, das er bezog (siehe Seite 95).
Weitere Skizzen zeigen den Wandschmuck an der Ostwand, wo sich auch die Eingangstür befand, darunter das Bild einer Rose, das seine Mutter gemalt hatte, und weitere Gemälde, die einen Hirsch und ein Bauernhaus zeigten und vielleicht von Lillian stammten. Die Südwand war vollständig von Bücherregalen eingenommen, und an der Westwand befand sich ein Kamin. Das Haus selbst war erst 1880 erbaut worden; es handelte sich also keineswegs um ein Kolonialzeithaus, aber es war ein angenehmes und geräumiges Gebäude. Wie die Angell Street 598 war es ein Doppelhaus, dessen Westhälfte die Adresse Barnes Street 10 hatte, während die Osthälfte die Hausnummer 12 trug. Lovecraft berichtete:
Das Haus ist makellos sauber & die Mieter sind ausschließlich ausgewählte Personen aus den guten, alten Familien. Die Gegend ist perfekt – alles alte Yankee-Häuser, von denen ein Gutteil aus der Kolonialzeit stammt … Der Ausblick aus dem Pseudo-Erker, wo mein Schreibtisch steht, ist bezaubernd – Ausschnitte alter Häuser, prächtige Bäume, urnenbekrönte, weiße georgianische Zäune & ein hinreißend altmodischer Garten, der einem in wenigen Monaten den Atem verschlagen wird.44
Wir wissen nicht viel darüber, wie Lovecraft die ersten Monate in Providence verbrachte. Im April, Mai und Juni berichtete er, dass er sich verschiedene Gegenden der Stadt ansah, in denen er noch nie zuvor gewesen war. Zumindest einen dieser Ausflüge unternahm er in Begleitung von Annie Gamwell, die damals im Truman Beckwith House an der Ecke College und Benefit Street wohnte. Er äußerte die Absicht, seine Recherchen zur Geschichte von Rhode Island fortzusetzen, und kündigte an, dass eine bestimmte Ecke des Lesesaals der Providence Public Library in nächster Zeit zu seinen bevorzugten Aufenthaltsorten zählen würde.
In den Erzählungen, die er im Jahr nach seiner Rückkehr verfasste, spielt Providence oft eine mehr oder weniger zentrale Rolle. Dieser Zeitabschnitt – vom Sommer 1926 bis zum Frühjahr 1927 – stellt die wohl produktivste Phase in Lovecrafts gesamter schriftstellerischer Laufbahn dar. Nur einen Monat nach seinem Abschied von New York schrieb er an Morton: »Es ist erstaunlich, wie viel besser mein guter alter Kopf arbeitet, seit er wieder in jene heimischen Gegenden versetzt worden ist, wo er hingehört. Je länger mein Exil andauerte, desto schwerer fielen mir selbst Lesen und Schreiben …«45 Das hatte sich nun grundlegend geändert: Zwei Kurzromane, zwei umfangreichere Erzählungen und drei Kurzgeschichten entstanden in diesem Zeitraum, zusammen mit einer Handvoll Gedichte und Essays. Und alle erzählenden Texte spielen – zumindest teilweise – in Neuengland.
Als Erstes brachte Lovecraft die Erzählung »The Call of Cthulhu« zu Papier, die er wahrscheinlich im August oder September 1926 verfasst hat. Die Handlung dieser Geschichte hatte Lovecraft bereits ein volles Jahr zuvor entworfen, wie aus seinem Tagebucheintrag für den 12./13. August 1925 hervorgeht: »Handlung für eine Geschichte – ›The Call of Cthulhu‹, ausgearbeitet.«
Der Untertitel der Erzählung, »Die folgenden Aufzeichnungen wurden im Nachlass von Francis Wayland Thurston aus Boston gefunden«, weist sie als Bericht Thurstons – der ansonsten nicht namentlich genannt wird – über Ereignisse aus, von denen er einerseits aus dem Nachlass seines verstorbenen Großonkels George Gammell Angell und andererseits durch persönliche Nachforschungen Kenntnis erlangt hat. Angell, Professor für semitische Sprachen an der Brown University, hat bei seinem Tod einige äußerst merkwürdige Schriftstücke hinterlassen. So hat er umfangreiche Aufzeichnungen zu den Träumen und dem Werk eines jungen Bildhauers namens Henry Anthony Wilcox gemacht, der ihm ein Basrelief gezeigt hatte, das er in der Nacht des 1. März 1925 im Schlaf angefertigt hatte. Es handelt sich um eine unbekannte Wesenheit von grässlichem Aussehen, und Wilcox berichtet, dass er in dem Traum, der ihn zu der Skulptur inspirierte, mehrfach die Worte »Cthulhu fhtagn« vernommen habe. Dies weckt Gammells Interesse, da er diese Laute Jahre zuvor bei einem Treffen der American Archaeological Society gehört hat, bei dem ein Polizeiinspektor aus New Orleans den versammelten Gelehrten eine Skulptur, die große Ähnlichkeit mit der von Wilcox aufwies, vorgelegt hatte. Diese Skulptur, so der Inspektor, sei von einem bösartigen Kult in den Sümpfen von Louisiana verehrt worden, zu dessen rituellen Gesängen der Satz »Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn« gehört habe. Eines der Mitglieder des Kultes hätte diese absonderlichen Laute als »In seinem Haus in R’lyeh wartet träumend der tote Cthulhu« übersetzt. Cthulhu sei ein riesenhaftes Wesen, das zusammen mit anderen Wesenheiten, die als die Großen Alten bezeichnet würden, von den Sternen gekommen sei, als die Erde noch jung war. Cthulhu läge in der versunkenen Stadt R’lyeh begraben und würde wiederauferstehen, »wenn die Sterne richtig stünden«, um erneut die Herrschaft über die Erde zu übernehmen. All dies würde nicht zuletzt im Necronomicon des verrückten Arabers Abdul Alhazred erwähnt.
Thurston weiß nicht, was er mit diesen bizarren Informationen anfangen soll, doch dann findet er zufällig einen Zeitungsausschnitt, in dem vom merkwürdigen Ereignissen an Bord eines Schiffes im Pazifischen Ozean berichtet wird. Der Artikel ist mit der Abbildung eines Basreliefs illustriert, das den Reliefs von Wilcox und Legrasse sehr ähnlich ist. Thurston reist nach Oslo, um den norwegischen Seemann Gustaf Johansen, der an Bord des Schiffes war, zu befragen, erfährt jedoch, dass dieser verstorben ist. Johansen hat allerdings einen Bericht hinterlassen, aus dem hervorgeht, dass er, als die Stadt R’lyeh sich infolge eines Erdbebens vom Meeresgrund erhoben hat, tatsächlich dem entsetzlichen Cthulhu begegnet ist. Da die Sterne aber nicht »richtig stehen«, versank sie samt Cthulhu wieder. Doch die bloße Existenz dieser titanischen Wesenheit bleibt für Thurston eine Quelle tiefgreifenden Unbehagens, da sie zeigt, wie brüchig die angebliche Herrschaft des Menschen über die Erde ist.
Es ist schwierig, in einer dürren Inhaltsangabe einen Eindruck vom formalen und inhaltlichen Reichtum der Erzählung zu vermitteln: ihren Andeutungen einer kosmischen Bedrohung, ihrem geschickt aufgebauten, sich nach und nach entfaltenden Höhepunkt, der Komplexität ihrer Struktur, der Vielzahl von Erzählerstimmen und ihrer stilistischen Perfektion – vom nüchternen und klinischen Beginn bis zu der poetischen Prosa des Schlusses, in der das Grauen geradezu epische Ausmaße annimmt. »The Call of Cthulhu« ist Lovecrafts beste Erzählung seit »The Rats in the Walls«. In ihr findet Lovecraft zu jener Sicherheit und Reife, die viele der Arbeiten seines letzten Lebensjahrzehnts auszeichnen sollte.
Die Ursprünge der Geschichte liegen noch weit vor der detaillierten Handlungsskizze, die Lovecraft 1925 anfertigte. Der Kerngedanke von »The Call of Cthulhu« findet sich bereits im Eintrag 25 in Lovecrafts Commonplace Book, der wahrscheinlich aus dem Jahr 1920 stammt:
Mann besucht Antikenmuseum – bietet Basrelief an, das er gerade angefertigt hat – alter & gelehrter Kurator lacht & sagt, dass er etwas so Modernes nicht annehmen kann. Mann erwidert, dass »Träume älter sind als das grüblerische Ägypten oder die nachdenkliche Sphinx oder das von Gärten umgebene Babylon« & dass er das Relief im Traum angefertigt hat. Kurator fordert ihn auf, ihm sein Werk zu zeigen & als er es tut, fragt der Kurator entsetzt, wer der Mann sei. Er nennt ihm modernen Namen. »Nein – früher«, erwidert Kurator. Mann erinnert sich nur in seinen Träumen. Dann bietet Kurator ihm hohen Preis, aber Mann fürchtet, Kurator wolle Skulptur zerstören. Nennt völlig überhöhten Preis – Kurator will mit Direktoren beraten. Gute Handlungsentwicklung hinzufügen & Beschaffenheit des Basreliefs beschreiben.
Bei diesem Eintrag handelt es sich um die ziemlich getreue Wiedergabe eines Traums, den Lovecraft Anfang 1920 gehabt hatte und den er ausführlich in zwei Briefen aus dieser Zeit beschreibt.46 Ich habe ihn nicht zuletzt deshalb so ausführlich zitiert, um zu zeigen, wie selektiv Lovecraft mit seinen Inspirationen umgeht. Nur ein sehr kleiner Teil dieses Handlungskerns hat es letztlich in die fertige Erzählung geschafft: Im Grunde bleibt nicht mehr übrig als das Motiv, dass ein moderner Bildhauer unter dem Einfluss von Träumen ein merkwürdiges Basrelief herstellt. Und obwohl Lovecraft auch den Satz über die Träume aus dem Commonplace Book übernimmt, schickt er ihm einen distanzierenden Kommentar des Erzählers voraus, wenn dieser sagt: »Die Worte des Bildhauers waren von einer eigenartigen phantastischen Poesie, die für seine gesamte Ausdrucksweise […] typisch gewesen sein muss.«
Dass Wilcox das Basrelief im Traum anfertigt, ist eine Hommage an Guy de Maupassants »Le Horla«, der als der zentrale literarische Einfluss auf »The Call of Cthulhu« gelten kann. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass Lovecraft Maupassants Erzählung schon kannte, als er 1920 jenen Traum hatte, den er in seinem Commonplace Book festhielt. Doch als er »The Call of Cthulhu« verfasste, war ihm »Le Horla« zweifellos gegenwärtig. Die Erzählung ist sowohl in Joseph Frenchs Masterpieces of Mystery (1920) als auch in Julian Hawthornes Lock and Key Library (1909) enthalten. Den letzteren Band erwarb Lovecraft 1922 bei einem seiner New-York-Besuche. In »Supernatural Horror in Literature« wertet er »Le Horla« als Maupassants unheimlich-phantastisches Meisterwerk: »Hier wird von der Ankunft eines unsichtbaren Wesens in Frankreich erzählt, welches sich von Wasser und Milch ernährt, die Gedanken anderer beeinflusst und die Vorhut einer Horde außerirdischer Organismen zu sein scheint, die auf die Erde kommen, um die Menschheit zu unterjochen und zu überrennen. In ihrem besonderen Bereich findet sich zu dieser atmosphärisch dichten Erzählung nichts Vergleichbares …«47 Natürlich ist Cthulhu nicht unsichtbar, doch der hier zusammengefasste Grundgedanke von Maupassants Erzählung findet sich recht genau in »The Call of Cthulhu« wieder. Manche der Überlegungen von Maupassants Erzähler lassen sich durchaus als »kosmisch« im Lovecraft’schen Sinne bezeichnen. Nachdem er ein Buch über »die Geschichte und Manifestationen aller unsichtbaren Wesen, die den Menschen umschweben oder von denen er träumt« gelesen hat, verfällt er in folgende Grübelei:
Es ist, als ob der Mensch, seitdem er denkt, ein neues Wesen geahnt und gefürchtet hat, das stärker ist als er selbst, das Wesen, das sein Nachfolger auf der Erde sein wird …
Wer bewohnt diese Welten? Welche Gestalten? Welche Wesen, welche Tiere, welche Pflanzen gedeihen dort? Wissen diejenigen, die dort in fernen Welten denken, mehr als wir? Was können diese Wesen mehr? Was sehen sie, das wir nicht kennen? Wird nicht eines von ihnen früher oder später den Weltenraum durcheilen und auf unserer Erde landen, um sie zu erobern, wie einst die Normannen durch die Meere fuhren, schwächere Völkerschaften zu unterjochen.
Wir sind so schwach, waffenlos, wehrlos, unwissend, so klein, wir Menschen, auf diesem Sandkorn in einem Wassertropfen!
(…)
Nun weiß ich Alles. Nun errate ich es. Die Zeit, da der Mensch herrschte, ist vorüber.48
Lovecraft hatte guten Grund, von Maupassants Erzählung angetan zu sein. Und doch lässt sich nicht leugnen, dass er selbst das Thema subtiler und vielschichtiger gestaltet als sein französischer Vorgänger.
Robert M. Price hat auf einen weiteren wichtigen Einfluss auf »The Call of Cthulhu« hingewiesen: die Theosophie.49 Diese Bewegung geht auf Helena Petrowna Blavatsky zurück, die in ihren Werken Isis Unveiled (1877) und The Secret Doctrine (1888–97) eine spezifische Mischung aus Populärwissenschaft, Mystik und Religion entwickelte. Es wäre ebenso mühselig wie nutzlos, die theosophische Lehre in ihren Einzelheiten wiederzugeben. Begnügen wir uns damit, darauf hinzuweisen, dass ihre Theorien über untergegangene Zivilisationen wie Atlantis und Lemuria – die Blavatsky behauptete, aus dem uralten »Buch Dzyan« entnommen zu haben, zu dem die Secret Doctrine vorgibt, ein Kommentar zu sein – Lovecrafts Phantasie beflügelten. Im Sommer 1926 hatte er das Buch The Story of Atlantis and the Lost Lemuria (1925) von W. Scott-Elliot gelesen,50 das in »The Call of Cthulhu« erwähnt wird. Im zweiten Kapitel werden die Theosophen sogar explizit genannt. Wenn der Mestize Castro später von den Großen Alten berichtet, dann macht er Andeutungen über gewisse Geheimnisse, die ihm »unsterbliche Chinesen« offenbart hätten – eine Anspielung auf die – fiktiven – theosophischen Berichte von der heiligen Stadt Shamballah in Tibet, dem vorgeblichen Ursprungsort der theosophischen Lehren. Lovecraft war natürlich weit davon entfernt, die Theosophie ernst zu nehmen. Er macht sich im Gegenteil über sie lustig, wenn er beispielsweise schreibt: »Der alte Castro erinnerte sich an Fetzen grässlicher Legenden, vor denen die Spekulationen der Theosophen verblassten und die den Menschen und die Welt als ein junges und kurzlebiges Phänomen erscheinen ließen.«
Ein weiterer literarischer Einfluss ist »The Moon Pool«, ein Kurzroman von A. Merritt (1884–1943). Lovecraft stimmte immer wieder Lobeshymnen auf diesen Text an, der erstmals in ALL-STORY vom 22. Juni 1918 veröffentlicht worden war und auf der zum Archipel der Karolinen gehörenden Insel Ponape spielt. Jene »Mondtür« mit dem seltsamen Öffnungsmechanismus, durch welche die Protagonisten von Merritts Erzählung in eine Unterwelt voller Wunder und Schrecken hinabsteigen, erinnert stark an die seltsame gigantische Tür in »The Call of Cthulhu«, aus der das titelgebende Wesen hervorbricht, nachdem sie von den Seeleuten geöffnet wird.
Bevor wir uns den allgemeineren Fragen zuwenden, die durch »The Call of Cthulhu« aufgeworfen werden, lohnt es sich vielleicht, kurz auf die autobiographischen Elemente der Erzählung einzugehen. Einige sind rein oberflächlicher Natur und kommen kaum über das Niveau halb privater Anspielungen hinaus: Der Name des Erzählers, Francis Wayland Thurston, ist offensichtlich von Francis Wayland (1796–1865) entliehen, der von 1827–1855 Präsident der Brown University war. Gammell ist eine Variante von Gamwell, während Angell zugleich auf eine der großen Durchgangsstraßen von Providence wie auf eine der bedeutendsten Familien der Stadt verweist. Der Name Wilcox findet sich in Lovecrafts Stammbaum.51 Und wenn Thurston das Zeitungsblatt mit dem Bericht über Johansens Reise während des Besuchs bei einem »gelehrten Freund in Paterson, New Jersey, der Kurator des dortigen Museums und ein renommierter Mineraloge war«, entdeckt, dann muss man kaum darauf hinweisen, dass es sich um eine Anspielung auf James F. Morton handelt.52
Das Fleur-de-Lys-Haus in der Thomas Street 7, in dem Wilcox wohnt, existiert bis heute. Harsch, aber durchaus berechtigt nennt Lovecraft das Gebäude »eine hässliche viktorianische Nachahmung der bretonischen Architektur des 17. Jahrhunderts, die ihre stuckverzierte Fassade zwischen den eleganten Kolonialzeithäusern auf dem alten Hügel und im Schatten eines der schönsten georgianischen Kirchtürme des ganzen Landes zur Schau stellt« – bei dem erwähnten Kirchturm handelt es sich um den Turm der First American Baptist Church.
Das in der Erzählung erwähnte Erdbeben spiegelt ebenfalls ein reales Ereignis wider. Zwar gibt es keinen Brief Lovecrafts an seine Tante Lillian, der den entsprechenden Zeitraum abdeckt, aber ein Tagebucheintrag vom 28. Februar 1925 füllt die Lücke aus: »G[eorge] K[irk] & S[amuel] L[oveman] bei mir – (…) – um 9:30 Uhr abends bebt das Haus …« Steven J. Mariconda, der die Entstehung von »The Call of Cthulhu« umfassend durchleuchtet hat, schreibt: »In New York fielen Lampen von den Tischen und Spiegel von den Wänden. Mauern bekamen Risse, und Fenster zerbrachen. Die Menschen flüchteten sich ins Freie.«53
»The Call of Cthulhu« ist in vielerlei Hinsicht die Weiterentwicklung und Neufassung einer von Lovecrafts frühesten Erzählungen, »Dagon« (1917). In »Dagon« findet sich bereits eine ganze Reihe der Motive, die Lovecraft in der späteren Geschichte ausarbeiten wird: ein Erdbeben, durch das eine versunkene Landmasse zum Vorschein kommt; ein gigantisches Monster, das in den Tiefen des Ozeans haust, und – auch wenn dies nur vorsichtig angedeutet wird – die Vorstellung, dass eine ganze Zivilisation, die der Menschheit indifferent, wenn nicht gar feindlich gegenübersteht, in einem verborgenen Winkel dieser Welt existiert. Das letztgenannte Motiv bildet auch den Kern von Arthur Machens Erzählungen über das »kleine Volk«. Ohnehin lassen sich Parallelen zwischen »The Call of Cthulhu« und Machens »Novel of the Black Seal« feststellen – einer Episode aus The Three Impostors –, in der Professor Gregg, ähnlich wie Thurston in Lovecrafts Erzählung, disparate Einzelheiten, die jede für sich wenig aussagekräftig sind, zu einem Gesamtbild zusammensetzt, das andeutet, dass die Menschheit auf ein entsetzliches Grauen zusteuert.
Von allen Erzählungen, die Lovecraft bisher verfasst hatte, weist »The Call of Cthulhu« die komplexeste Struktur auf. Es ist die erste Geschichte, in der er ausgiebigen Gebrauch von der Technik des mehrschichtigen Erzählens – der Erzählung in der Erzählung – macht, einer Struktur, die eigentlich der Romanform bedarf, um ihre volle Wirkung zu entfalten, die Lovecraft jedoch, dank der extremen Verdichtung des Textes, effektiv einzusetzen vermag. Als »Kritiker«, also bei der Beurteilung der Texte anderer Autoren, war sich Lovecraft der formalen Probleme eines verfehlten oder ungeschickten Gebrauchs der »Erzählung in der Erzählung« durchaus bewusst. Dies gilt besonders für die Gefahr, dass eine Binnenerzählung die Haupterzählung überlagert und damit die Einheitlichkeit des Textes untergräbt, eine Schwäche, die Lovecraft in seinem Essay »Supernatural Horror in Literature« in Maturins Melmoth the Wanderer diagnostiziert, wo, so Lovecraft, »[d]ie Geschichte, die Monçada dem jungen John erzählt, einen Großteil des vierbändigen Romans [füllt], ein Missverhältnis, das als einer der wichtigsten technischen Fehler der Komposition betrachtet wird.« Dass die Erzählstruktur derart aus dem Gleichgewicht gerät, lässt sich vermeiden, indem man die Binnenerzählung eng mit der Haupterzählung verknüpft, insbesondere indem man den Erzähler der Haupterzählung auf die eine oder andere Art in die Binnenerzählung miteinbezieht. In »The Call of Cthulhu« gibt es einen Haupterzähler (Francis Wayland Thurston), der mit seinen Worten die Aufzeichnungen eines Binnenerzählers (George Gammell Angell) zusammenfasst, der seinerseits wiederum zwei Berichte anderer Personen wiedergibt, den des Künstlers Wilcox und den des Polizeiinspektors Legrasse, wobei der Bericht des Letzteren gewissermaßen eine weitere Binnenerzählung enthält, die Aussage des alten Mestizen Castro. Später stößt Thurston dann auf einen Zeitungsartikel und den schriftlichen Bericht des Maats Johansen, die wiederum die Wahrheit von Angells Aufzeichnungen bestätigen. Dieses Konzert von Erzählerstimmen lässt sich in der folgenden Skizze zusammenfassen:
Diese Struktur wirkt nirgends unbeholfen, da der Leser sich stets der Anwesenheit des Haupterzählers Thurston bewusst ist, der die verschiedenen Binnenerzählungen zusammenträgt und sie immer wieder durch seine Kommentare miteinander verbindet. Bemerkenswert ist, dass der spektakulärste Teil der Erzählung – Castros Bericht von den Großen Alten – eine dreifache Binnenerzählung in der Folge Thurston – Angell – Legrasse – Castro darstellt. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass Lovecraft das Prinzip des sekundären Erzählens hier bis an seine Grenzen treibt. Wenn Lovecraft später über »The Call of Cthulhu« bemerkte, dass die Geschichte »schwerfällig« sei,54 dann dachte er vielleicht an diese strukturelle Komplexität, eine Komplexität, die jedoch die Inhalte der Erzählung effektiv und glaubwürdig vermittelt.
Von jener berühmten grüblerischen Einleitung über die Stellung des Menschen in der Welt, die ihrerseits eine Weiterentwicklung des Beginns von »Facts concerning the Late Arthur Jermyn and His Family« ist:
Die größte Gnade, die uns die Natur hat zuteilwerden lassen, ist wohl das Unvermögen des menschlichen Geistes, alle seine Inhalte miteinander in Beziehung zu setzen. Wir leben auf einer beschaulichen Insel der Unwissenheit inmitten schwarzer Ozeane der Unendlichkeit, und es ist nicht unsere Bestimmung, weit hinauszusegeln. Die Wissenschaften, von denen jede in ihre eigene Richtung strebt, haben uns bislang wenig geschadet. Eines Tages jedoch wird man die verstreuten Wissensfragmente zusammenfügen, und es werden sich so erschreckende Ausblicke auf die Wirklichkeit und unsere heillose Stellung in dieser Wirklichkeit eröffnen, dass wir angesichts der Offenbarung entweder den Verstand verlieren oder aus dem tödlichen Licht in die Ruhe und Sicherheit eines neuen dunklen Zeitalters fliehen werden …,
bis zu Johansens atemberaubender Begegnung mit Cthulhu:
Die widerwärtige See wirbelte und schäumte heftig, und während der Druck im Dampfkessel immer weiter anstieg, steuerte der tapfere Norweger sein Schiff direkt auf die sie verfolgende Gallertmasse zu, die sich wie das Heck einer dämonischen Galeone über die verseuchte Gischt erhob. Der entsetzliche Krakenkopf mit seinen zuckenden Fühlern überragte fast den Bugspriet der gedrungenen Jacht, doch Johansen hielt unerbittlich Kurs. Es gab ein Bersten, so als ob eine Blase platzen würde, dann eine schleimige Ungeheuerlichkeit, die an die Gedärme eines Mondfischs erinnerte, dann einen Gestank wie aus tausend geöffneten Gräbern und ein Geräusch, das der Chronist nicht in Worte zu fassen wagte …,
ist die Erzählung ein Meisterwerk, sowohl im Hinblick auf ihren Erzählrhythmus wie auf die virtuose Steigerung des Grauens. Mit ihren 12.000 Wörtern hat sie die Dichte und Komplexität eines Romans.
Die eigentliche Bedeutung von »The Call of Cthulhu« liegt jedoch weder in den in die Erzählung eingearbeiteten autobiographischen Details noch in ihrer literarischen Qualität, sondern in der Tatsache, dass es sich bei ihr um den ersten entscheidenden Beitrag zu dem handelt, was später als der »Cthulhu-Mythos« bezeichnet wurde. Sie enthält bereits viele der Elemente, die Lovecraft oder andere Autoren in späteren »Cthulhu-Mythos«-Erzählungen verwenden sollten. Zugleich ist es unbestreitbar, dass sich in den Erzählungen, die Lovecraft in den letzten zehn Jahren seines Lebens schuf, ein Geflecht von Zusammenhängen und Querverweisen herausbildet. Häufig sind diese Geschichten durch wechselseitige Verweise auf ein sich ständig weiterentwickelndes Korpus imaginärer Mythen miteinander verbunden, und viele von ihnen knüpfen an – teils nebensächliche, teils zentrale – Elemente vorangegangener Erzählungen an. Allerdings können wir heute einige zentrale Punkte festhalten, auch wenn manche von ihnen nicht unumstritten sind: 1) Der Begriff »Cthulhu-Mythos« stammt nicht von Lovecraft; 2) Lovecraft war der Überzeugung, dass seine weltanschaulichen Prinzipien in allen seinen Erzählungen gleichermaßen zum Ausdruck kamen; 3) der Cthulhu-Mythos – wenn man von einem solchen überhaupt sprechen kann – besteht weder aus den Erzählungen selbst, noch aus der Weltanschauung, die hinter den Erzählungen steht, sondern aus bestimmten Motiven und Elementen, die verwendet werden, um diese Weltanschauung auszudrücken. Betrachten wir diese drei Punkte genauer:
1) Es steht zweifelsfrei fest, dass der Begriff »Cthulhu-Mythos« nach Lovecrafts Tod von August Derleth geprägt wurde. Lovecraft selbst kommt einer Benennung des von ihm erfundenen Pantheons und der mit ihm zusammenhängenden Phänomene am nächsten, wenn er in einem Brief beiläufig von »Cthulhuism & Yog-Sothothery« spricht,55 wobei allerdings unklar bleibt, was genau diese Begriffe bezeichnen.
2) Wenn Lovecraft 1931 in einem Brief an Frank Belknap Long davon spricht, dass »Yog-Sothoth eine im Kern unreife Vorstellung & ungeeignet für wirklich ernsthafte Literatur ist«,56 dann war er vielleicht übertrieben bescheiden – was immer an dieser Stelle konkret mit »Yog-Sothoth« gemeint ist. Doch war, wie im weiteren Verlauf des Briefes deutlich wird, für Lovecraft seine Pseudomythologie vor allem eins: ein Mittel, um seiner »kosmizistischen« Weltanschauung Ausdruck zu verleihen. Dies tritt ebenfalls deutlich in einem Brief hervor, den Lovecraft im Juli 1927 an Farnsworth Wright schrieb, als er ihm »The Call of Cthulhu« zum zweiten Mal für WEIRD TALES anbot, nachdem Wright die Erzählung zunächst abgelehnt hatte:
Alle meine Erzählungen beruhen auf der Grundannahme, dass die gewöhnlichen menschlichen Gesetze, Interessen und Gefühle im unermesslichen Kosmos in seiner Gesamtheit keine Gültigkeit und keine Bedeutung haben. Für mich kann eine Erzählung, in der die menschliche Gestalt – und die begrenzten menschlichen Leidenschaften und Befindlichkeiten und Maßstäbe – auf andere Welten oder andere Universen übertragen werden, nur kindisch sein. Um zum Wesen eines echten Außerhalb vorzustoßen – ob es sich um ein Außerhalb der Zeit, des Raums oder der Dimensionen handelt –, muss man vergessen, dass Dinge wie organisches Leben, Gut und Böse, Liebe und Hass und alle derartigen lokalen Attribute einer unbedeutenden und vergänglichen Spezies, die sich Menschheit nennt, überhaupt existieren.57
Bei näherer Betrachtung hat diese Erklärung vielleicht nicht das philosophische Gewicht, das ihr manche Kommentatoren – darunter ich selbst – in der Vergangenheit zugeschrieben haben: Obwohl der erste Satz eine äußerst allgemeine Aussage enthält, beschäftigt sich der überwiegende Teil des Abschnitts – und des gesamten Briefes – mit einer ziemlich spezifischen technischen Frage der Science Fiction oder des unheimlichphantastischen Erzählens, nämlich der Darstellung von Außerirdischen. Wogegen Lovecraft argumentiert, ist die weitverbreitete Konvention, Außerirdische nicht nur als humanoid darzustellen, sondern auch mit menschlicher Sprache, Gewohnheiten und Gefühlen auszustatten, wie dies zum Beispiel Autoren wie Edgar Rice Burroughs oder Ray Cummings praktizierten. Der Wunsch, sich davon abzusetzen, ist einer der Gründe, warum Lovecraft einen so abseitigen Namen wie »Cthulhu« ersinnt, um ein Geschöpf zu bezeichnen, das aus den Tiefen des Weltalls stammt.
Doch behauptet Lovecraft in der oben zitierten Passage, dass alle seine Erzählungen auf die eine oder andere Weise auf dem kosmizistischen Prinzip beruhen. Wenn wir dennoch einige von ihnen zu einer eigenständigen Gruppe zusammenfassen, weil sie von seinem »künstlichen Pantheon und dessen mythologischen Hintergrund« (wie er es in »Some Notes on a Nonentity« formuliert) Gebrauch machen, dann geschieht dies nur der Zweckmäßigkeit halber und im vollen Bewusstsein, dass sich Lovecrafts Werk nicht willkürlich in strikt voneinander getrennte und sich gegenseitig ausschließende Kategorien unterteilen lässt, wie Derleth es mit seiner Unterscheidung von »Neuengland-Erzählungen«, »Dunsany-Erzählungen« und »Cthulhu-Mythos-Erzählungen« versucht hat. Es ist offensichtlich, dass sich diese Kategorien nicht scharf gegeneinander abgrenzen lassen und dass bestimmte Erzählungen durchaus zu mehreren Kategorien gleichzeitig gehören können.
3) Es wäre sowohl oberflächlich als auch ungenau zu behaupten, dass der Lovecraft-Mythos mit Lovecrafts Weltanschauung identisch ist. Weltanschaulich hing Lovecraft einem konsequenten mechanischen Materialismus an, und wenn es so etwas wie einen Lovecraft’schen Mythos gibt, dann handelt es sich um eine Reihe von erzählerischen Elementen und Motiven, die ihm zum Ausdruck dieser Weltanschauung dienen. Wir können uns an dieser Stelle darauf beschränken, diese Elemente grob zu umreißen. Sie lassen sich provisorisch in drei Bereiche unterteilen: a) erfundene »Götter« und die Kulte oder Gefolgschaften, die sich um diese gebildet haben; b) eine ständig wachsende Bibliothek mythischer Bücher und okkulter Überlieferungen; c) eine imaginäre Topographie Neuenglands (die Städte Arkham, Dunwich, Innsmouth usw.). Es fällt sogleich auf, dass Elemente aus den ersten beiden Bereichen bereits in Lovecrafts früheren Erzählungen auftauchen, wenn auch oft in noch verschwommener Form. Doch erst in Lovecrafts Spätwerk verbinden sich die drei Bereiche miteinander. Man könnte argumentieren, dass der dritte Bereich nichts dazu beiträgt, Lovecrafts Kosmizismus auszudrücken, und es trifft zu, dass sein imaginäres Neuengland den Schauplatz von Erzählungen abgibt, die alles andere als »kosmisch« sind, wie beispielsweise »The Picture in the House«. Allerdings hat seine mythische neuenglische Topographie eine nachhaltige Faszination ausgeübt und kann trotz allem als wichtiger Bestandteil der Lovecraft’schen Mythologie betrachtet werden. Es ist nur insofern sinnvoll, die Fehlinterpretationen zu diskutieren, die August Derleth der Lovecraft’schen Mythologie hat angedeihen lassen, als man sich so der Frage nähern kann, was diese Mythologie für Lovecraft selbst bedeutete. Die Fehldeutungen lassen sich in drei Rubriken zusammenfassen: 1) dass Lovecrafts Götter eigentlich Elementargeister sind; 2) dass es möglich ist, zwischen den »Älteren Göttern«, welche die Kräfte des Guten verkörpern, und den »Großen Alten«, welche die Kräfte des Bösen repräsentieren, zu unterscheiden; 3) dass Lovecrafts Mythologie in ihrer Gesamtheit eine Verwandtschaft mit dem Christentum aufweist.
Man muss nicht lange nachdenken, um alle drei Behauptungen als absurd zurückzuweisen. Die Vorstellung, dass die »Götter« für Elemente stehen, scheint vor allem darauf zurückzugehen, dass Cthulhu unter Wasser gefangen ist und dass er äußerlich einem Kraken ähnelt, woraus Derleth ableitet, dass er für das Element Wasser stehen muss. Doch sowohl der Umstand, dass er explizit außerirdischer Herkunft ist, als auch die Tatsache, dass er in der versunkenen Stadt R’lyeh gefangen ist, lassen keinen Zweifel daran, dass seine Krakenähnlichkeit zufällig und Wasser nicht sein natürliches Element ist. Derleths Versuche, aus Lovecrafts anderen »Göttern« Elementarwesen zu machen, ist noch absurder: Nyarlathotep wird willkürlich dem Element Erde zugeordnet, während Hastur – eine Wesenheit, die nur ein einziges Mal beiläufig in »The Whisperer in Darkness« erwähnt wird – aus unklaren Gründen als Luftgeist fungiert. Nicht nur bleiben in dieser Zuordnung die beiden Wesenheiten, die allem Anschein nach die Hauptgötter des Lovecraft’schen Pantheons sind – Azathoth und Yog-Sothoth –, außen vor, Derleth muss auch erklären, warum es Lovecraft aus unerfindlichen Gründen nicht gelang, dem Element Feuer eine Gottheit zuzuordnen, und das obwohl er – Derleth zufolge – während seiner letzten zehn Lebensjahre kontinuierlich am »Cthulhu-Mythos« arbeitete.
Derleth, selbst praktizierender Katholik, konnte Lovecrafts düstere atheistische Weltsicht offenbar nicht ertragen und erfand daher willkürlich die von dem britannischrömischen Gott Nodens angeführten »Älteren Götter« als Gegengewicht zu den »bösen« Großen Alten, die von der Erde »verbannt« worden sind, aber seit unvordenklichen Zeiten Vorbereitungen treffen, zurückzukehren und die Menschheit auszurotten. Offenbar hat er sich seine Inspiration dafür aus Lovecrafts Roman The Dream-Quest of Unknown Kadath geholt, wo Nodens sich gegen die Machenschaften Nyarlathoteps auf die Seite Randolph Carters zu stellen scheint. Die Hinzuerfindung der Kategorie der »Älteren Götter« ermöglichte es Derleth zu behaupten, dass der »Cthulhu-Mythos« seinem Wesen nach mit dem Christentum verwandt sei, um ihn für Menschen, die seine konventionelle Weltsicht teilten, akzeptabel zu machen. Ein wichtiges »Beweisstück«, das er wiederholt für seine These anführte, war das folgende, vorgeblich aus einem Brief Lovecrafts stammende Zitat: »Alle meine Erzählungen, so unzusammenhängend sie auch sein mögen, beruhen auf der grundlegenden Überlieferung oder Legende, dass diese Welt einst von einer anderen Rasse bewohnt wurde, die ihre Stellung verlor oder vertrieben wurde, weil sie schwarze Magie praktizierte, und die nun außerhalb ihrer Grenzen lauert und nur darauf wartet, erneut von der Erde Besitz zu ergreifen.« Trotz der oberflächlichen Ähnlichkeit, die es mit der oben angeführten Passage aus seinem Brief an Farnsworth Wright hat, welche ebenfalls mit »Alle meine Erzählungen …« beginnt, scheint dieses Zitat in jeder Hinsicht untypisch für Lovecraft; in jedem Fall steht es in dezidiertem Widerspruch zur Stoßrichtung seiner Weltanschauung. Als Derleth später gebeten wurde, den Brief vorzulegen, aus dem das Zitat angeblich entnommen war, konnte er dies nicht. Aus gutem Grund: Es findet sich in keinem von Lovecrafts Briefen. Es stammt vielmehr aus einem Brief des Komponisten Harold S. Farnese an Derleth. Farnese, der eine kurze Korrespondenz mit Lovecraft geführt hatte, dachte offensichtlich ähnlich wie Derleth und legte Lovecraft seine eigene Fehlinterpretation seines Werks in den Mund.58 Derleth wiederum ließ sich das vorgebliche Zitat als Trumpfkarte für seine irreführende Lovecraft-Interpretation nicht entgehen.
Es ist nicht mehr nötig, die ganze Angelegenheit noch einmal aufzuwärmen: Moderne Lovecraft-Spezialisten wie Richard L. Tierney und Dirk W. Mosig haben diese Frage so eindeutig geklärt, dass jeder Versuch, ihre Forschungen infrage zu stellen, nur noch als Geschichtsklitterung betrachtet werden kann. Es gibt in Lovecrafts Erzählungen kein kosmisches Ringen zwischen »Gut« und »Böse«. Was es gibt, sind Kämpfe zwischen verschiedenen außerirdischen Wesenheiten, doch haben diese Auseinandersetzungen keinerlei moralische Untertöne, sondern sind schlicht Bestandteil der Geschichte des Universums. Es gibt keine »Älteren Götter«, die darum kämpfen, die Menschheit vor den »bösen« Großen Alten zu beschützen. Die Großen Alten wurden von niemandem »vertrieben« und sind – außer Cthulhu – weder in der Erde noch sonstwo »gefangen«. Lovecrafts kosmisches Panorama ist weit weniger erbaulich: Die Menschheit nimmt keine zentrale Rolle auf der Bühne des Universums ein, und niemand hilft ihr, gegen jene Wesenheiten vorzugehen, die von Zeit zu Zeit die Erde heimsuchen, um Chaos und Verwüstung zu stiften. Letztlich sind die »Götter« der Lovecraft’schen Mythologie keine »echten« Götter, sondern bloß außerirdische Wesen, die gelegentlich ihre menschlichen Anhänger zum eigenen Vorteil manipulieren.
Dieser letzte Punkt ist insbesondere in Bezug auf »The Call of Cthulhu« interessant: Wenn Castro Inspektor Legrasse seine haarsträubende Geschichte von den Großen Alten erzählt, dann wirkt es, als ob eine enge Beziehung zwischen den menschlichen Anhängern des Cthulhu-Kultes und dem Gegenstand ihrer Verehrung bestehen würde: »Dieser Kult würde nicht sterben, bis die Sterne wieder richtig standen und die geheimen Priester den großen Cthulhu aus seinem Grab befreien würden, um seinen Untertanen das Leben zurückzugeben und ihn erneut seine Herrschaft über die Erde antreten zu lassen.« Die Frage ist: Hat Castro damit recht oder nicht? Betrachtet man die Erzählung als ganze, dann scheint er eindeutig unrecht zu haben. Mit anderen Worten, der Kult hat keinerlei Einfluss auf das Wiedererscheinen von Cthulhu, das durch ein Erdbeben ausgelöst wird, und spielt für ihn und seine möglichen Absichten keine Rolle. An dieser Stelle kommt Lovecrafts Bemerkung ins Spiel, dass man sich hüten solle, menschliche Interessen und Befindlichkeiten auf außerirdische Wesen zu übertragen: Wir wissen praktisch nichts darüber, was Cthulhu will oder beabsichtigt, und seine erbärmlichen und unwissenden menschlichen Verehrer suchen nur eine Bestätigung ihrer eigenen Wichtigkeit, wenn sie sich einreden, dass sie bei seiner Wiederkehr eine entscheidende Rolle spielen und mit ihm seine Herrschaft über die Erde antreten werden.
Hier stoßen wir endlich zum Kern der Lovecraft’schen Mythologie vor. Man hat Lovecrafts Bekenntnis, dass es Lord Dunsany war, »der mir die Idee zu jenem artifiziellen Pantheon und dem mythischen Hintergrund, für den ›Cthulhu‹, ›Yog-Sothoth‹, ›Yuggoth‹ usw. stehen«, eingab, entweder missverstanden oder ignoriert. Doch ist es entscheidend, um zu begreifen, was seine Pseudomythologie für Lovecraft bedeutete. Dunsany hatte sein imaginäres Pantheon in seinen beiden ersten Büchern The Gods of Pegāna (1905) und Time and the Gods (1906) – und nur in diesen – ausgearbeitet. Der bloße Umstand, dass ein Schriftsteller sich eine imaginäre Religion ausdenkt, verlangt nach einer Erklärung: Er deutet offensichtlich darauf hin, dass er die Religion, mit der er aufgewachsen ist – in diesem Falle das Christentum –, als unzulänglich empfindet. Dunsany war, soweit man weiß, Atheist, wenn er seinen atheistischen Überzeugungen auch nicht so offen Ausdruck verlieh wie Lovecraft. Und seine Götter waren, wie diejenigen Lovecrafts, in erster Linie Symbole für seine weltanschaulichen Überzeugungen. Im Falle Dunsanys ging es um Dinge wie die Rückgewinnung einer verlorenen Einheit zwischen Mensch und Natur und die Ablehnung zahlreicher Elemente der modernen Zivilisation (das Geschäftsleben, Reklame und allgemein die Abwesenheit von Schönheit und Poesie im Alltag). Lovecraft, der eine eigene weltanschauliche Botschaft vermitteln wollte, benutzte sein imaginäres Pantheon in einem analogen Sinne. Doch anders als Dunsany siedelte Lovecraft dieses Pantheon nicht in phantastischen Ländern an, sondern in der wirklichen Welt. Damit vollzog er den Schritt von der Fantasy zum Unheimlich-Phantastischen und verlieh seinen Wesenheiten eine weit erschreckendere Präsenz, als wenn sie ein imaginäres Land wie Pegāna bevölkert hätten.
Lovecraft schuf, wie David E. Schultz es treffend ausgedrückt hat, eine Anti-Mythologie.59 Denn was ist der Zweck der meisten Religionen und Mythologien? »Dem Menschen die Wege Gottes zu erklären«,60 wie Milton es zu Beginn von Paradise Lost formuliert. Die Menschheit hat sich immer für den Mittelpunkt des Universums gehalten und das Universum mit Göttern von unterschiedlichem Wesen und unterschiedlichen Fähigkeiten bevölkert, um die Naturphänomene ebenso wie die eigene Existenz zu erklären und sich vor der düsteren Aussicht des völligen Nichts nach dem Tode zu schützen. In jeder Religion und jeder Mythologie gibt es eine Verbindung zwischen Göttern und Menschen, und es ist ebendiese Verbindung, die Lovecraft mit seiner Pseudomythologie infrage stellt. Er war jedoch bewandert genug in Anthropologie und Psychologie, um sich bewusst darüber zu sein, dass die meisten Menschen – gleichgültig, ob es sich um sogenannte »Primitive« oder Zivilisierte handelt – sich mit einer atheistischen Sicht auf die menschliche Existenz nicht abfinden können, und entsprechend bevölkerte er seine Erzählungen mit Kulten, die auf ihre eigene pervertierte Art versuchten, jene Verbindung zu den Göttern wiederherzustellen. Was diese Kulte jedoch nicht begreifen, ist, dass das, was sie für »Götter« halten, bloß außerirdische Wesenheiten sind, die keine engere Beziehung zur Menschheit oder unserem Planeten haben und allein ihre eigenen unbekannten Ziele verfolgen.
»The Call of Cthulhu« ist in mehr als einer Hinsicht ein Quantensprung für Lovecraft. Es ist seine erste Erzählung, die man im vollen Sinne als kosmisch bezeichnen kann. In »Dagon«, »Beyond the Wall of Sleep« und einigen anderen Texten hatten sich bereits einzelne Elemente von Lovecrafts Kosmizismus abgezeichnet, doch erst »The Call of Cthulhu« verleiht dieser Idee eine umfassende und künstlerisch befriedigende Gestalt. Die Vermutung, dass unterschiedliche Phänomene in den verschiedensten Weltregionen – Basreliefs, die in New Orleans, Grönland und im Südpazifik auftauchen oder von einem Künstler in Providence im Traum angefertigt werden, merkwürdig ähnliche Träume, die von unterschiedlichen Menschen gleichzeitig geträumt werden – alle mit der Cthulhu genenannten Wesenheit verknüpft sein könnten, lässt in Thurston die Erkenntnis heranreifen, dass nicht nur er, sondern die gesamte Menschheit in Gefahr ist. Und das bloße Wissen darum, dass Cthulhu noch immer am Grunde des Ozeans existiert, auch wenn er dort für Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahrtausende ruhen wird, veranlasst Thurston zu einem düsteren Ausblick: »Ich habe alles gesehen, was das Universum an Grauen aufzubieten hat, und sogar der Frühlingshimmel und die Blumen des Sommers sind mir danach für immer vergiftet.« Dieses Empfinden ist etwas, das viele von Lovecrafts späteren Erzählern gemeinsam haben.
Eine eher triviale Frage, die jedoch unter Lovecraft-Lesern ebenso wie unter Spezialisten für viele Spekulationen gesorgt hat, ist die nach der richtigen Aussprache des Namens Cthulhu. In seinen Briefen scheint Lovecraft unterschiedliche Aussprachemöglichkeiten anzudeuten. Kanonisch geworden ist eine Briefstelle aus dem Jahre 1934:
… das Wort soll den unbeholfenen menschlichen Versuch darstellen, die Phonetik eines absolut nicht-menschlichen Wortes zu erfassen. Die höllische Kreatur erhielt ihren Namen von Wesen, deren Sprachorgane in keiner Weise den menschlichen glichen, und dementsprechend steht er in keiner Beziehung zu den menschlichen Sprechwerkzeugen. Die Silben wurden von physiologischen Werkzeugen geformt, die völlig anders sind als die unsrigen, und können daher von menschlichen Mündern niemals vollkommen richtig ausgesprochen werden … Der eigentliche Klang – soweit menschliche Sprachorgane ihn nachahmen oder menschliche Buchstaben ihn aufzeichnen können – könnte etwas wie Khlûl’-hloo sein, wobei die erste Silbe sehr guttural und heiser ausgesprochen werden sollte. Das u klingt ähnlich wie in full, und die erste Silbe hört sich etwa wie klul an, wobei das h das Heisere und Gutturale wiedergeben soll.61
Zwischen dem Kosmizismus von »The Call of Cthulhu« und der prosaischen Alltäglichkeit von »Pickman’s Model« scheinen Welten zu liegen. Aber auch wenn diese wohl Anfang September 1926 verfasste Erzählung sicherlich nicht zu Lovecrafts besten zählt, so weist sie doch einige interessante Züge auf. In »Pickman’s Model« berichtet der Erzähler, ein Mann namens Thurber, in einer für Lovecraft ungewöhnlichen umgangssprachlichen Prosa, warum er alle Beziehungen zu dem Bostoner Maler Richard Upton Pickman abgebrochen hat, der kurz darauf verschwunden ist. Eigentlich hatte Thurber noch zu Pickman gehalten, als sich alle anderen Bekannten und Freunde wegen der grässlichen Natur seiner Malerei bereits von ihm abgewandt hatten, und Pickman gewährt ihm sogar Zutritt zu seinem geheimen Kelleratelier im verfallenden North End von Boston in der Nähe des alten Friedhofs Copp’s Hill. Hier bewahrt der Maler einige der spektakulärsten seiner dämonischen Bilder auf. Insbesondere eines, das eine »riesenhafte und unbeschreibliche Abscheulichkeit mit funkelnden roten Augen« zeigt, die an einem menschlichen Kopf nagt wie ein Kind an einem Lutscher. Ein merkwürdiges Geräusch erklingt, und Pickman erklärt unruhig, dass es sich um Ratten handelt, die in den unterirdischen Tunneln leben, welche die Gegend durchziehen. Dann verschwindet er in einem anderen Kellerraum und feuert dort alle sechs Schüsse seines Revolvers ab – eine ziemliche merkwürdige Art, um gegen Ratten vorzugehen. Nachdem er sich verabschiedet hat, bemerkt Thurston, dass er unabsichtlich eine Photographie mitgenommen hat, die an der Leinwand des entsetzlichen Gemäldes befestigt war. Zunächst vermutet er, dass es sich um das Foto eines Hintergrunds für irgendeines von Pickmans Monster-Gemälden handelt. Doch dann wird ihm klar, dass es sich um ein Bild des Monsters selbst handelt: »Es war die Photographie eines lebendigen Wesens.«
Zwar hat der Leser diese Schlusspointe bereits kommen sehen, doch ist es weniger der Handlungsaufbau, der »Pickman’s Model« bemerkenswert macht, als der Schauplatz und die Ästhetik der Erzählung. Bis hin zu den Straßennamen wird das Bostoner North End von Lovecraft äußerst realistisch geschildert. Weniger als ein Jahr nachdem er die Geschichte verfasst hatte, musste er allerdings zu seiner Enttäuschung feststellen, dass ein großer Teil der von ihm beschriebenen Gegend dem Erdboden gleichgemacht worden war, um neuer Bebauung Platz zu machen. Die Tunnel, die er in »Pickman’s Model« beschreibt, gab es tatsächlich. Sie waren wahrscheinlich in der Kolonialzeit von Schmugglern angelegt worden.62 Lovecraft gelingt es, die Atmosphäre jahrhundertealten Verfalls eindringlich wiederzugeben und dabei Pickman seine eigenen Auffassungen von kulturelle Traditionen in den Mund zu legen:
Herrgott, Mann! Haben Sie sich einmal überlegt, dass dieses Viertel nicht gebaut wurde, sondern gewachsen ist, richtig gewachsen? Ganze Generationen lebten, fühlten und starben dort! Und das alles zu Zeiten, wo die Leute noch keinerlei Angst hatten zu leben, zu fühlen, zu sterben … Nein, Thurber, diese uralten Gegenden sind voll der traumhaftesten Wunder und Schrecken, voll der Flucht aus dem Banalen, was aber nützt es, wenn keine Menschenseele daraus Gewinn zu ziehen versteht?
Allerdings finden sich in »Pickman’s Model« noch weitere Gedanken, die Lovecraft am Herzen lagen. In gewissem Sinne ist die Erzählung ein fiktionalisiertes Kompendium der ästhetischen Prinzipien unheimlich-phantastischer Literatur, die Lovecraft kurz zuvor in »Supernatural Horror in Literature« umrissen hatte. Wenn Thurber beklagt, dass »jeder lausige Titelillustrator heute imstande ist, Farbe auf die Leinwand zu klatschen, um dann das Ganze meinetwegen Nachtmahr, Hexenritt oder gar Porträt des Satans zu nennen«, dann knüpft er damit an Lovecrafts Überzeugung an, dass es künstlerischer Aufrichtigkeit und eines Wissens um die tatsächlichen Ursachen menschlicher Furcht bedarf, um unheimlich-phantastische Kunst zu schaffen. »Nur der wahre Künstler«, so fährt Thurber fort, »kennt die tatsächliche Anatomie des Grauens oder die Psychologie der würgenden Furcht, deren genaue Linien und entsprechende Farbkontraste und Lichtwirkungen unserem Unterbewussten eine unerklärliche Angst einflößen.« Mutatis mutandis haben wir hier eine recht exakte Formulierung von Lovecrafts Ideal unheimlich-phantastischer Literatur vor uns. Und wenn Thurber diagnostiziert, dass Pickman »in jeder Hinsicht – im Entwurf wie in der Ausführung – ein gründlicher, detailbesessener und fast wissenschaftlicher Realist« war, dann markiert Lovecraft damit in literarischer Form seine eigene Abwendung von einer poetischen Prosa im Stile Dunsanys hin zu jener spezifischen Form des »Realismus«, die das Markenzeichen seines Spätwerks ist.
»Pickman’s Model« hat jedoch eine Reihe von Schwächen, die über die ziemlich vorhersehbare Handlung hinausgehen. Obwohl Thurber zunächst als »harter Kerl« charakterisiert wird, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hat, scheint er übermäßig schockiert von Pickmans Bildern. Seine Reaktion wirkt übertrieben und hysterisch und erweckt beim Leser den Eindruck, dass er keineswegs so »hart« ist, wie er wiederholt behauptet. Nicht zuletzt wirkt der umgangssprachliche Stil der Erzählung – wie schon in »In the Vault« – aufgesetzt und unnatürlich, und es ist erfreulich, dass Lovecraft, abgesehen von seinen Exkursionen in den Neuengland-Dialekt, in der Folge auf ihn verzichtete.
»The Call of Cthulhu« wurde von Farnsworth Wright für WEIRD TALES zunächst abgelehnt. Warum, darüber sagt Lovecraft nichts, außer der beiläufigen Bemerkung, dass Wright die Erzählung »langsam« fand.63 Es ist nirgends davon die Rede, dass Wright »The Call of Cthulhu« für zu anspruchsvoll oder abseitig für seine Leserschaft hielt. Nichtsdestotrotz ist es bezeichnend, dass er auf die konventionellere Erzählung »Pickman’s Model« sofort ansprang und sie im Oktober 1927 in seinem Magazin veröffentlichte.
Ende August 1926 reichte Lovecraft drei Erzählungen bei der Zeitschrift GHOST STORIES ein: »In the Vault« und zwei weitere, deren Titel er nicht nennt – möglicherweise »Cool Air« und »The Nameless City«.64 Wie zuvor mit DETECTIVE TALES machte Lovecraft damit den Versuch, einen weiteren kommerziellen Abnehmer für seine Geschichten zu gewinnen. Möglicherweise war dies eine direkte Folge der Ablehnung von »The Shunned House« und »Cool Air« durch Wright (Die Ablehnung von »The Call of Cthulhu« erreichte Lovecraft erst im Oktober). GHOST STORIES (1926–1932) war jedoch eine etwas merkwürdige Wahl. Das Magazin bezahlte zwar zwei Cent pro Wort,65 enthielt jedoch vor allem offensichtlich erfundene »Tatsachenberichte« über übernatürliche Phänomene, die mit ebenso offensichtlich gestellten und manipulierten Photographien illustriert wurden. Dazwischen waren gelegentlich Erzählungen von bekannten Autoren wie Agatha Christie oder Carl Jacobi eingestreut. GHOST STORIES war kein Pulp-Magazin, sondern erschien im Illustriertenformat und auf relativ hochwertigem Papier. Lovecraft las einige Ausgaben, zog jedoch das Fazit: »Die Zeitschrift ist nicht besser geworden – & eine schlechtere ist kaum vorstellbar.«66 Zwei Cent pro Wort waren allerdings ein überzeugendes Argument. Aber die drei Geschichten, die Lovecraft eingesandt hatte, kamen zurück.67
Lovecraft verfasste jedoch nicht nur eigene Erzählungen. Er fuhr zugleich damit fort, sich mit Überarbeitungen und Lektoraten ein wenig Geld zu verdienen, und begann, sich nach und nach einen Kreis von Möchtegern-Horrorautoren aufzubauen, die ihm ihre Geschichten zur Überarbeitung anvertrauten. Seit er 1923 und 1924 die vier Erzählungen von C. M. Eddy, Jr. überarbeitet hatte, hatte er keine derartigen Aufträge mehr übernommen, nun jedoch trat sein neuer Freund Wilfred B. Talman mit einer Erzählung mit dem Titel »Two Black Bottles« an ihn heran. Lovecraft fand die Geschichte vielversprechend – erinnern wir uns daran, dass Talman erst 22 Jahre alt und die Schriftstellerei nicht sein kreatives Hauptinteresse war –, hielt jedoch einige Änderungen für notwendig. Im Oktober war die Überarbeitung fertig, und das Resultat erschien im August 1927 in WEIRD TALES.
In »Two Black Bottles« kommt der Erzähler, ein Mann namens Hoffman, in die kleine Stadt Daalbergen in den Ramapo Mountains (einem im nördlichen New Jersey gelegenen Gebirgszug, der sich in den Staat New York hinein erstreckt), um das Erbe seines vor Kurzem verstorbenen Onkels Johannes Vanderhoof anzutreten. Über Vanderhoof, der Pastor der örtlichen Gemeinde war, sind seltsame Geschichten im Umlauf. Unter dem Einfluss seines betagten Küsters, Abel Foster, hatte er seiner immer stärker schrumpfenden Gemeinde feurige und dämonische Predigten gehalten. Hoffman, der der Sache auf den Grund gehen will, trifft in der Kirche auf den betrunkenen und verängstigten Foster. Foster berichtet merkwürdige Dinge über den ersten Pastor der Kirche, Guilliam Slott, der im 18. Jahrhundert eine esoterische Bibliothek zusammentrug und wohl eine Art von Dämonenbeschwörung praktizierte. Foster hat diese Bücher ebenfalls studiert und ist in Slotts Fußstapfen getreten: Als Vanderhoof gestorben ist, hat er dessen Seele in eine kleine schwarze Flasche gesteckt. Doch Vanderhoof, der dadurch zwischen Himmel und Hölle gefangen ist, findet in seinem Grab keine Ruhe, und es gibt Anzeichen, dass er versucht, sich aus der Erde zu erheben. Hoffman, der nicht weiß, was er von dieser haarsträubenden Geschichte halten soll, sieht plötzlich, wie sich das Kreuz auf Vanderhoofs Grab bewegt. Als er daraufhin zwei schwarze Fläschchen auf dem Tisch neben Foster bemerkt, greift er nach ihnen, und bei dem folgenden Handgemenge mit Foster geht eine der beiden Flaschen zu Bruch. Foster ruft aus: »Das ist mein Ende! Da drin war meine Seele! Dominie Slott hat sie vor zweihundert Jahren dort eingesperrt.« Daraufhin zerfällt Fosters Leib in kürzester Zeit zu Staub.
Die Geschichte entfaltet durchaus eine gewisse Wirkung, und zum Schluss hin gelingt es ihr, eine recht überzeugende Atmosphäre erstickenden Grauens heraufzubeschwören, vor allem durch den merkwürdigen Dialekt, in dem Foster seinen Bericht vorträgt. Nicht ganz klar ist allerdings, welchen Anteil Lovecraft an Entwurf und Ausführung hatte. Wenn man nach seinen Briefen an Talman geht, dann hat Lovecraft nicht nur einen Teil der Erzählung verfasst – insbesondere die Dialektpassagen –, sondern auch entscheidende Vorschläge in Bezug auf die Struktur gemacht. Talman hatte Lovecraft offenbar einen ersten Entwurf der Erzählung und ein Exposé geschickt – vielleicht auch nur einen Entwurf des Anfangs und eine Skizze des Rests. Lovecraft empfahl eine Vereinfachung der Handlungsstruktur, sodass alle Ereignisse aus der Perspektive von Hoffman erzählt werden. Was den Stil angeht, so schreibt Lovecraft an Talman: »Was meine Änderungen am Manuskript angeht – ich bin mir sicher, dass nichts davon mit Ihrer Urheberschaft in Konflikt steht. Meine Eingriffe beschränken sich in praktisch allen Fällen rein auf den Ausdruck und dienen ausschließlich dazu, dem Stil etwas Schliff zu verleihen und ihn flüssiger zu machen.«68
In seinen 1973 verfassten Erinnerungen an Lovecraft zeigte sich Talman allerdings etwas irritiert über Lovecrafts Überarbeitung: »Er nahm einige willkürliche Änderungen vor, vor allem in den Dialogen … Wenn ich mir die gedruckte Fassung ansehe, wäre es mir lieber, dass Lovecraft die Dialoge nicht geändert hätte, denn die Art und Weise, wie er den Dialekt verwendet, wirkt gestelzt.«69 Ich vermute, dass Talman Lovecrafts Anteil an der Erzählung herunterspielt, denn es finden sich in »Two Black Bottles« auch über die Dialektpassagen hinaus zahlreiche Stellen, die Lovecrafts Feder erkennen lassen. Wie viele der Geschichten, die Lovecraft später für andere Autoren überarbeitete, war »Two Black Bottles« genau die Art von konventioneller Horrorerzählung, die Farnsworth Wright schätzte, und es überrascht nicht, dass er die Geschichte für WEIRD TALES annahm, während er Lovecrafts eigene, anspruchsvollere Arbeiten immer wieder zurückwies.
Eine Auftragsarbeit ganz anderer Art, mit der sich Lovecraft im Oktober 1926 beschäftigte, war The Cancer of Superstition. Über dieses Projekt ist nicht viel bekannt, es scheint sich jedoch um ein Buch gehandelt zu haben, das Lovecraft und C. M. Eddy im Auftrag von Harry Houdini verfassen sollten. Houdini gastierte Anfang Oktober in Providence und bat Lovecraft kurzfristig darum, für ihn einen polemischen Artikel gegen die Astrologie zu schreiben, für den er ihm 75,00 Dollar bezahlte.70 Dieser Artikel ist verschollen, vielleicht bildete er jedoch den Ausgangspunkt für das Projekt, das offenbar als eine populärwissenschaftliche Polemik in Buchform konzipiert war, die sich gegen Aberglauben aller Art richten sollte. Houdini hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere derartige Werke verfasst, darunter A Magician Among the Spirits (1924), von dem er Lovecraft ein Exemplar mit einer persönlichen Widmung überreichte. Diesmal schwebte ihm jedoch offenbar ein Buch vor, das wissenschaftlich solider fundiert sein sollte.
Was sich von The Cancer of Superstition erhalten hat, ist ein von Lovecraft verfasstes Exposé und die ersten Seiten des Buches, die Eddy nach dem Exposé geschrieben hat. Lovecrafts Entwurf beginnt, wie zu erwarten, mit den vorgeschichtlichen Ursprüngen des Aberglaubens (»Jede Art von Aberglauben & religiösen Vorstellungen geht auf die Versuche der primitiven Menschen zurück, Ursachen für die Naturphänomene um sie herum zu finden«), wobei er sich vor allem auf Fiskes Myths and Myth-Makers und Frazers Golden Bough stützt. Das erhaltene Kapitel stammt offensichtlich aus der Feder von Eddy, aber zweifellos hat Lovecraft viele der angeführten Fakten beigetragen.
Das Projekt fand jedoch mit Houdinis plötzlichem Tod am 31. Oktober 1926 ein abruptes Ende, da seine Witwe kein Interesse an einer Fortführung hatte. Vielleicht war das auch besser so, denn das erhaltene Kapitel wirkt ziemlich mittelmäßig. Letztlich fehlt das akademische Fundament, das ein Text dieser Art benötigt. Auch wenn Lovecraft für einen Laien in Anthropologie recht bewandert war, so verfügten doch weder er noch Eddy über die wissenschaftliche Autorität für ein solches Unternehmen.
Kurz nachdem Lovecraft »Pickman’s Model« fertiggestellt hatte, finden wir ihn überraschenderweise in New York wieder. Er muss spätestens am Montag, dem 13. September, angekommen sein, denn er berichtet, dass er an diesem Abend mit Sonia im Kino war. Der Grund für diesen Besuch liegt im Dunkeln, und ich vermute, dass die Initiative von Sonia ausging. Lovecraft berichtet, dass er mit ihr ein Zimmer im Astor Hotel an der Ecke Broadway und 44. Straße in Manhattan nahm. Am Dienstagmorgen, so Lovecraft, »musste sich S. H. früh um geschäftliche Dinge kümmern & hatte einen so vollen Terminplan, dass sie keinen Moment der Freizeit hatte, mit der sie gerechnet hatte«.71 Obwohl Lovecraft natürlich immer noch mit Sonia verheiratet war, scheint er zu dem Gaststatus zurückgekehrt zu sein, den er während seiner Besuche im Jahr 1922 eingenommen hatte: Die meiste Zeit verbrachte er mit der »Gang«, vor allem mit Long, Kirk und Orton.
Am Sonntag, dem 19. September, fuhr Lovecraft nach Philadelphia, wo er bis Montagabend blieb. Sonia hatte darauf bestanden, ihm die Reise zu bezahlen,72 vielleicht als Entschädigung dafür, dass er sich überwunden hatte, in die »Pestzone« zurückzukehren. Wieder in New York, fand sich Lovecraft am 23. zu einem Treffen der »Gang« ein, das aus zwei Gründen bemerkenswert war: Zum einen hörte man sich gemeinsam die Übertragung des Dempsey-Tunney-Boxkampfes im Radio an, zum anderen traf Lovecraft dort mit Howard Wolf zusammen, einem Freund von George Kirk, der Reporter beim AKRON JOURNAL war. Lovecraft dachte sich nichts weiter dabei, doch sollte er später herausfinden, dass Wolf für seine Kolumne »Variety« einen Artikel über das Treffen und insbesondere über Lovecraft geschrieben hatte. Bei diesem Artikel handelt es sich wahrscheinlich um das erste Mal, dass Lovecrafts Name außerhalb der Welt der Amateurpresse und der Pulp-Magazine Erwähnung fand.73
Wolf beschreibt Lovecraft als einen »noch ›unentdeckten‹ Verfasser von Horrorgeschichten, dessen Werke keinen Vergleich mit irgendetwas, was heute auf diesem Gebiet veröffentlicht wird, scheuen müssen«, und berichtet, dass er und Lovecraft sich den ganzen Abend lang über unheimlich-phantastische Literatur unterhalten hätten. Dann erwähnt er, dass er in der Folge eine Reihe alter Ausgaben von WEIRD TALES gelesen habe und von Lovecraft mehr und mehr beeindruckt gewesen sei. »The Outsider« ist für Wolf ein »echtes Meisterwerk«, und »The Tomb« hält er für »fast genauso gut«. Wolf findet sogar freundliche Worte für »The Unnamable« und »The Moon-Bog«, während er »The Temple« als »nicht so gut« beurteilt. Am Ende seines Artikels wagt er die Voraussage: »Soweit ich weiß, hat dieser Mann seine Erzählungen noch nie einem Verleger vorgelegt. Wenn zufällig ein Verlagslektor diese Zeilen lesen sollte, dann würde ich ihm raten, Lovecraft aufzufordern, seine Erzählungen zu sammeln und zur Veröffentlichung anzubieten. Ein daraus zusammengestellter Band dürfte bei der Kritik und möglicherweise auch beim Publikum erfolgreich sein.« Weder Wolf noch Lovecraft konnten ahnen, wie lange es dauern sollte, bis es dazu kam.
Lovecraft blieb bis zum 25. September in New York und fuhr dann mit dem Bus nach Providence zurück. Den Briefen an seine Tanten nach zu urteilen, verbrachte er zwei recht vergnügliche Wochen in der Metropole, die mit jener Art von Besichtigungstouren und Treffen mit Freunden ausgefüllt waren, die ihn schon während seiner New Yorker Jahre aufrechtgehalten hatten. Sowohl Lovecraft wie Sonia waren sich wohl im Klaren darüber, dass es sich um nichts weiter als einen Besuch handelte.
Ende Oktober unternahm Lovecraft eine weitere Reise, diesmal mit seiner Tante Annie Gamwell, die ihn jedoch weniger weit weg von Providence führte. Zum ersten Mal seit 1908 besuchte er die Gegend seiner Herkunft rund um Foster. Lovecrafts Bericht von dieser Reise ist eine herzerwärmende Lektüre: Er nahm nicht nur den Reiz des ländlichen Neuenglands in sich auf, der ihm zeitlebens so viel bedeutet hatte, sondern erneuerte auch die Bande zu Familienmitgliedern, die das Andenken von Whipple Phillips in Ehren hielten: »Gewiss fühlte ich mich lebhafter zu meinen familiären Ursprüngen hingezogen als bei irgendeiner anderen Gelegenheit, an die ich mich erinnern kann, und habe seitdem an kaum etwas anderes gedacht! Ich bin durchtränkt und gesättigt von den lebendigen Kräften meines ererbten Seins und ganz durchdrungen von Stimmung, Atmosphäre und Wesen meiner handfesten neuenglischen Vorfahren.«74
Dass dies keine Übertreibung ist, zeigt sich in seiner nächsten Erzählung »The Silver Key«, die vermutlich in den ersten Novembertagen entstand. Hier muss Randolph Carter – der uns zuletzt in »The Unnamable« (1923) begegnet ist – im Alter von dreißig Jahren erkennen, dass er »den Schlüssel zum Tor der Träume verloren hat«, woraufhin er versucht, sich mit der wirklichen Welt zu versöhnen, die er jedoch als prosaisch und ästhetisch unbefriedigend empfindet. Nachdem er literarische, geistige und sinnliche Stimulanzien aller Art erprobt hat, findet er eines Tages auf dem Dachboden seines Hauses einen silbernen Schlüssel. Daraufhin nimmt Carter den »alten, erinnerungsschweren Weg« zurück ins ländliche Neuengland seiner Kindheit und findet sich, auf magische Weise in einen neunjährigen Jungen zurückverwandelt – wobei Lovecraft klug genug ist, keine Erklärung für die Verwandlung anzubieten –, vor dem Haus wieder, in dem er aufgewachsen ist. Ganz selbstverständlich setzt sich Carter mit seiner Tante Martha, seinem Onkel Chris und ihrem Knecht, Benijah Corey, zum Abendessen. Ohne Reue tauscht er sein tristes Erwachsenenleben gegen die Wunderwelt der Kindheit ein, und am nächsten Morgen eröffnet er sich in einer Höhle, in der er schon als Kind spielte, mithilfe des Silberschlüssels den Zugang zu noch weiter entfernten Traumreichen.
»The Silver Key« wird oft zu Lovecrafts »Dunsany-Geschichten« gezählt, weil es sich um eine traumhaft-poetische Phantasie statt um eine Horrorerzählung handelt. Allerdings weist »The Silver Key« bei genauerer Betrachtung kaum Ähnlichkeiten mit Dunsanys Art des Erzählens auf, außer vielleicht in dem sehr allgemeinen Sinne, dass philosophisch-weltanschauliche Fragen in Form einer phantastischen Erzählung verhandelt werden. Und doch zeichnet sich zwischen »The Silver Key« und dem Werk des irischen Phantasten in anderer Hinsicht eine subtile Beziehung ab: Nachdem er den Zugang zu seiner Traumwelt verloren hat, beginnt Carter wieder, Bücher zu schreiben – aus »The Unnamable« kennen wir ihn ja bereits als Verfasser von Horrorerzählungen –, aber er findet in dieser Betätigung keine Befriedigung mehr:
… denn das Gewicht des Irdischen lastete auf seinem Geist, und er konnte nicht mehr an schöne Dinge denken wie vor Zeiten. Ein ironischer Humor brachte all die Minarette, die er in der Dämmerung aufrichtete, wieder zum Einsturz, und die irdische Furcht davor, unglaubwürdig zu erscheinen, ließ all die zarten und wunderbaren Blumen in seinen Feengärten verwelken. Die Konventionen eines unechten Mitgefühls ließen seine Figuren rührselig werden, während die mythische Vorstellung, dass die Wirklichkeit Gewicht und die Erlebnisse und Gefühle der Menschen Bedeutung haben, all seine hochfliegenden Phantasien zu kaum verschleierten Allegorien und billigen Gesellschaftssatiren herabwürdigte. … Es waren elegante Romane, in denen er sich weltgewandt über die Träume lustig machte, die er mit leichter Hand aufs Papier warf. Doch erkannte er, dass ihre Perfektion ihnen das Leben ausgesaugt hatte.
Diese Sätze bringen ziemlich genau Lovecrafts Meinung über Dunsanys späteres Werk zum Ausdruck, dem er vorwarf, die Haltung kindlichen Staunens und die Höhenflüge der Phantasie aufgegeben zu haben, die seine früheren Arbeiten auszeichneten. Die Einschätzung, die Lovecraft 1936 in einem Brief gab, wurde zwar schon zitiert, es ist aber durchaus erhellend, sie an dieser Stelle noch einmal anzuführen:
Als [Dunsany] älter und abgeklärter wurde, verlor er seine Frische und Einfachheit. Er schämte sich seiner unkritischen Naivität und begann, zu seinen Erzählungen auf Distanz zu gehen und sie offensichtlich zu belächeln, während sie sich vor dem Leser entfalten. Statt zu bleiben, was der echte Phantastiker sein muss – ein Kind in einer kindlichen Traumwelt –, begann er, Wert darauf zu legen, den Leser merken zu lassen, dass er in Wirklichkeit ein Erwachsener war, der gutmütig so tat, als ob er ein Kind in einer kindlichen Welt sei.75
In Wirklichkeit ist »The Silver Key« natürlich eine kaum verbrämte Darstellung von Lovecrafts eigener gesellschaftlicher, ethischer und ästhetischer Weltanschauung. Der Text ist über weite Strecken kaum eine Erzählung, sondern eher eine Parabel oder ein philosophischer Essay. Attackiert werden der literarische Realismus:
Er widersprach nicht, als sie ihn belehrten, dass der kreatürliche Schmerz eines abgestochenen Schweins oder eines magenkranken Bauern im wirklichen Leben wichtiger wären als die unvergleichliche Schönheit von Narath mit seinen hundert reliefgeschmückten Toren und Domen aus Mondstein …
eine konventionelle Religiosität:
Er hatte sich dem sanften kirchlichen Glauben zugewandt, der ihm durch das naive Gottvertrauen seiner Vorväter lieb war, denn in diese Richtung erstreckten sich mystische Wege, die ein Entkommen aus seinem neuen Leben zu versprechen schienen. Erst bei näherem Hinsehen bemerkte er die Dürre ihrer Visionen, die schale und nüchterne Banalität, den lächerlichen Ernst und die groteske Wahrheitsgewissheit, die öde und unumschränkt unter den Bekennern herrschten … Es ermüdete Carter mitanzusehen, mit welchem Ernst diese Menschen versuchten, irdische Realität aus alten Mythen zu machen, die von jedem neuen Schritt jener Wissenschaft, auf die sie zugleich so stolz waren, widerlegt wurden …
und eine künstlerische und politische Bohème:
Ihr Leben schleppte sich unförmig in Schmerz, Hässlichkeit und Maßlosigkeit dahin, während sie zugleich lächerlich stolz darauf waren, etwas entronnen zu sein, das keineswegs unvernünftiger war als ihre jetzigen Überzeugungen. Sie hatten bloß die falschen Götter der Furcht und der blinden Frömmigkeit gegen die der Ausschweifung und der Anarchie eingetauscht.
Zu jeder dieser Passagen gibt es eine exakte Parallele in Lovecrafts Korrespondenz, und es ließen sich noch weitere solcher Parallelen anführen. Nur selten hat er seine Weltanschauung so direkt in erzählender Prosa ausgedrückt, und »The Silver Key« kann als sein endgültiger Abschied von der Dekadenzliteratur als ästhetischem Vorbild und vom Kosmopolitismus als Lebensform verstanden werden. Ironischerweise hat er die erzählerische Struktur von »The Silver Key« ebenjener literarischen Richtung entliehen, von der er sich in der Erzählung lossagt: Die Art, wie Carter bei dem Versuch, seinem Leben einen Sinn zu geben, nacheinander verschiedenartige ästhetische, religiöse und persönliche Erfahrungen durchlebt, folgt dem Vorbild des Schlüsselromans der Dekadenz, Joris-Karl Huysmans À rebours, in dem der Held Des Esseintes eine vergleichbare intellektuelle Reise unternimmt. Carters Rückkehr in seine Kindheit ist vielleicht von einer viel früheren Bemerkung Lovecrafts inspiriert: »Erwachsen zu sein ist die Hölle«, schrieb er in einem Brief aus dem Jahre 1920.76 Allerdings kehrt Carter im Grunde weniger in seine kindliche Existenz, sondern zu den Traditionen seiner Vorväter zurück; für Lovecraft das einzig wirksame Gegenmittel gegen das Gefühl der Vergeblichkeit, das die Erkenntnis, wie unbedeutend die Stellung des Menschen im Universum ist, zwangsläufig nach sich zog.
Es sollte inzwischen deutlich geworden sein, dass »The Silver Key« über weite Strecken auf dem Besuch beruht, den Lovecraft kurz zuvor in Foster gemacht hatte.77 Bestimmte Einzelheiten der Topographie, einige der Namen der handelnden Figuren78 und andere Übereinstimmungen lassen diese Schlussfolgerung unabweisbar erscheinen. So wie Lovecraft nach zwei Jahren der Entwurzelung in New York das Bedürfnis verspürte, die Verbindungen zum Ort seiner Herkunft wiederzuknüpfen, so muss er beim Verfassen von »The Silver Key« das Bedürfnis gehabt haben, ein für alle Mal deutlich zu machen, dass seine Imagination immer nach Neuengland zurückkehren und dessen Landschaft als einen Quell unerschütterlicher Werte und emotionalen Rückhalts betrachten würde, ganz gleich, wie weit sie zuvor auch in die Ferne geschweift war.
Der Frage, in welchem Verhältnis »The Silver Key« zu Lovecrafts anderen Randolph-Carter-Geschichten steht, hat man bisher nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Die Erzählung zeichnet Carters vollständigen Lebensweg von seiner Kindheit bis zu seinem Verschwinden im Alter von 54 Jahren nach. Stellt man eine Chronologie der Carter-Erzählungen auf, dann steht The Dream-Quest of Unknown Kadath an deren Anfang, denn Carter ist zur Zeit der dort geschilderten Ereignisse wohl in seinen Zwanzigern. Nachdem er mit dreißig den Schlüssel zum Tor der Träume verloren hat, unternimmt er seine Experimente mit dem literarischen Realismus, der Religion und dem Bohèmeleben. Enttäuscht wendet er sich daraufhin dunkleren Gefilden zu und experimentiert mit dem Okkultismus und düstereren Geheimlehren. Während dieser Phase trifft er auf Harley Warren und begibt sich mit diesem auf jene verhängnisvolle Friedhofsexkursion, die in »The Statement of Randolph Carter« geschildert wird. Kurz darauf und wieder in Arkham folgen dann die in »The Unnamable« geschilderten Ereignisse, die allerdings in »The Silver Key« nur indirekt angesprochen werden. Selbst aus diesen Ausflügen in die Gefilde des Unheimlich-Phantastischen zieht Carter keine Befriedigung, bis er im Alter von 54 Jahren den silbernen Schlüssel findet.
Kurz nachdem er die Erzählung verfasst hatte, notierte Lovecraft, dass er sie »noch nicht in ihre endgültige Form gebracht« habe: »Ich werde«, so kündigt er an, »in Kürze eine große Menge philosophischen Materials aus dem Anfangsteil amputieren, das die Entwicklung der Handlung verzögert und das Interesse des Lesers erstickt, bevor die Erzählung überhaupt richtig begonnen hat.«79 Lovecraft hat diese Ankündigung nie in die Tat umgesetzt, da ihm klar geworden sein muss, dass eine derartige »Amputation« die Geschichte ihres Sinnes beraubt hätte: Carters Rückkehr in die Kindheit bliebe bedeutungslos, wenn ihr nicht die Erkenntnis vorausgehen würde, dass das Erwachsenenleben in der modernen Welt ihm wenig zu bieten hat. Dass die Leser von WEIRD TALES nicht das ideale Publikum für eine Geschichte wie »The Silver Key« waren, ist offensichtlich. Es erstaunt daher nicht, dass Farnsworth Wright die Erzählung zunächst ablehnte.80 Im Sommer 1928 bat Wright Lovecraft jedoch, ihm »The Silver Key« erneut vorzulegen, und diesmal kaufte er die Geschichte für 70 Dollar.81 Nachdem die Erzählung in der Januarausgabe 1929 erschienen war, berichtete Wright allerdings, dass die Leser »heftige Abneigung« gegen »The Silver Key« geäußert hätten.82 Er war jedoch so taktvoll, keinen dieser ablehnenden Kommentare in der Leserbriefkolumne von WEIRD TALES abzudrucken.
In der Erzählung »The Strange High House in the Mist«, die Lovecraft am 9. November 1926 verfasste, ist der Einfluss Dunsanys deutlicher als in »The Silver Key«. Hier zeigt sich, dass Lovecraft die literarische Ästhetik des irischen Phantasten so weit verinnerlicht hatte, dass er in der Lage war, seine eigenen Ideen und Empfindungen in einer Form auszudrücken, die frei mit Dunsanys Stil und Atmosphäre umgeht. Direkt von Dunsany inspiriert sind in »The Strange High House in the Mist« vor allem einige Einzelheiten der Szenerie und die lebensweisheitliche, ja satirische »Botschaft« der Erzählung.
Schauplatz der Handlung ist Kingsport, wohin Lovecraft zum ersten Mal seit »The Festival« (1923) zurückkehrt, jener Geschichte, in der er seine Eindrücke des realen Marblehead und der dort lebendigen Vergangenheit auf diese fiktive Stadt übertrug. Nördlich von Kingsport steigen »die Felsen hoch und merkwürdig empor, Terrasse auf Terrasse, bis die nördlichste wie eine erstarrte, graue Windwolke am Himmel hängt«. Auf dieser Klippe steht ein uraltes Haus, dessen Bewohner kein Bürger von Kingsport je zu Gesicht bekommen hat – nicht einmal »der schreckliche alte Mann«. Eines Tages kommt ein »Sommergast« namens Thomas Olney, der als »Philosoph« vorgestellt wird und »an einem College an der Narragansett-Bay gewichtige Dinge lehrt«, auf den Gedanken, dem Haus und seinem geheimnisvollen Bewohner einen Besuch abzustatten. Olney, dem eine gewisse Vorliebe für das Seltsame und Wunderbare eigen ist, steigt mühsam die Klippen empor, muss jedoch, als er vor dem Haus steht, feststellen, dass es auf der Landseite keine Tür hat, sondern nur »einige kleine Gitterfenster mit blinden Butzenscheiben, die nach der Art des siebzehnten Jahrhunderts in Blei gefasst waren«. Die einzige Tür befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses, dessen Mauer bündig mit der senkrecht abfallenden Klippe abschließt. Da vernimmt Olney eine leise Stimme, und »ein großes, schwarzbärtiges Gesicht« schaut zu einem der Fenster heraus. Auf Einladung des Hausherrn klettert Olney durch das Fenster ins Haus, wird von diesem freundlich aufgenommen und mit wunderbaren Erzählungen unterhalten:
Und der Tag ging weiter, und Olney lauschte noch immer den Geschichten aus alter Zeit und von fernen Gegenden und vernahm, wie die Könige von Atlantis mit schlüpfrigen, gotteslästerlichen Geschöpfen kämpften, die aus Spalten im Meeresboden emporkrochen, und wie die mit Pfeilern versehenen, tangbehangenen Tempel in Poseidonis von verirrten Schiffen immer noch zu mitternächtlicher Stunde erspäht werden können, die bei ihrem Anblick wissen, dass sie verloren sind. Die Jahre der Titanen wurden heraufbeschworen, aber sein Gastgeber wurde zurückhaltend, als er vom dunklen Uralter des Chaos sprach, ehe die Götter oder die Alten geboren wurden und als die anderen Götter kamen, um auf dem Gipfel des Hatheg-Kla in der steinigen Wüste bei Ulthar hinter dem Flusse Skai zu tanzen.
Dann ertönt ein Klopfen an jener Tür über der senkrecht abfallenden Klippe. Als Olneys Gastgeber öffnet, füllt sich das Haus mit allen Arten phantastischer Gestalten, darunter »Neptun mit dem Dreizack« und »die graue, schreckliche Gestalt des uralten Nodens«. Am nächsten Tag kehrt Olney nach Kingsport zurück, unfähig, jemandem von seinen Erlebnissen zu berichten, außer dem »schrecklichen alten Mann«, der hinterher beschwört, dass »der Mann, der von dem Felsen herabgestiegen war, nicht mehr ganz der Mann sei, der hinaufgestiegen war«. Olneys Seele verlangt nicht länger nach dem Wunderbaren und Geheimnisvollen, stattdessen ist er nun zufrieden, mit seiner Frau und seinen Kindern sein prosaisches bürgerliches Leben weiterzuführen. Aber wenn die Bewohner von Kingsport zu dem Haus auf den Klippen hinaufschauen, dann scheint es ihnen, als ob »des Abends die kleinen, niederen Fenster heller erleuchtet seien als früher«.
Mehrfach hat Lovecraft bekannt, dass er, während er »The Strange High House in the Mist« verfasste, keine bestimmte Örtlichkeit im Sinn hatte. Er gibt an, dass die »titanischen Klippen von Magnolia« eine Inspiration für die Szenerie waren,83 doch dass es auf ihnen kein Haus wie das in der Erzählung gab. Eine nicht eindeutig verortete Landzunge bei Gloucester, die Lovecraft »Mother Ann« nennt,84 diente ebenfalls als Vorbild. Ein Passage in Dunsanys The Chronicles of Rodriguez, in der das auf einer Klippe gelegene Haus eines Zauberers beschrieben wird, könnte ebenfalls Anregungen geliefert haben.85 Lovecraft hat in »The Strange High House in the Mist« den neuenglischen Schauplatz demnach stärker umgestaltet als in seinen »realistischen« Erzählungen: Die Geschichte enthält kaum spezifische topographische Beschreibungen, und wir befinden uns offensichtlich in einem Phantasieland, in dem – ungewöhnlich für Lovecraft – die Hauptaufmerksamkeit dem Charakter seiner Hauptfigur gilt.
Denn das eigentliche Thema von »The Strange High House in the Mist« ist die merkwürdige Veränderung, die mit Thomas Olney vorgeht. Wie und warum hat er jene Sehnsucht nach dem Wunderbaren verloren, die bis zu seinem Besuch in Kingsport sein Leben bestimmte? Der »schreckliche alte Mann« deutet eine Antwort auf diese Fragen an: »Irgendwo unter dem grauen Spitzdach oder inmitten unfassbarer Bereiche des unheimlichen weißen Nebels verweilte immer noch der verlorene Geist dessen, der Thomas Olney war.« Olneys Körper ist ins normale Alltagsleben zurückgekehrt, doch sein Geist ist bei dem Bewohner des merkwürdigen hochgelegenen Hauses im Nebel zurückgeblieben. Die Begegnung mit Neptun und Nodens hat Olney erkennen lassen, dass jenes nebelumwogte Reich der Wunder der Ort ist, an den er wirklich gehört. Sein Körper ist nur noch eine leere, seelen- und phantasielose Hülle: »Sein gutes Weib wird immer dicker, während die Kinder immer älter, langweiliger und nützlicher werden, und er unterlässt es nie, zur gegebenen Zeit stolz und korrekt zu lächeln.« Die Erzählung lässt sich so gewissermaßen als Spiegelbild zu Lovecrafts früher Dunsany-Erzählung »Celephaïs« lesen: Während dort Kuranes in der wirklichen Welt sterben muss, damit sein Geist in das erträumte Reich der Phantasie eingehen kann, lebt Olney in der wirklichen Welt weiter, doch sein Geist bleibt im Phantasiereich zurück.
Ein weiteres kleines Werk aus dem Jahr 1926 ist ein Gedicht, das in der Dezemberausgabe von WEIRD TALES unter dem Titel »Yule Horror« veröffentlicht wurde. Dieses effektvolle vierstrophige Poem, das in demselben Swinburne entliehenen Versmaß verfasst ist wie »Nemesis«, »The House« und »The City«, war eigentlich ein Weihnachtsgedicht, das Lovecraft unter dem Titel »Festival« an Farnsworth Wright geschickt hatte. Wright war so angetan, dass er es – zu Lovecrafts Überraschung und Freude – in WEIRD TALES abdruckte, wobei er die letzte Strophe wegließ, die direkt auf ihn selbst anspielte:
And mayst thou to such deeds
Be an abbot and priest,
Singing cannibal greeds
At each devil-wrought feast,
And to all the incredulous world shewing dimly the sign of the beast.*
Abgesehen von »Yule Horror« beschränkte sich Lovecrafts poetische Produktion in seinen ersten acht Monaten in Providence auf eine gefühlvolle Elegie auf Oscar, den Kater eines Nachbarn von George Kirk, der von einem Auto überfahren worden war, und »The Return«, ein C. W. Smith gewidmetes Gedicht, das im TRYOUT vom Dezember 1926 erschien.
Ein bemerkenswertes Stück Prosa, das Lovecraft am 23. November verfasste, war der Essay »Cats and Dogs«, dessen Titel später von August Derleth in »Something about Cats« geändert wurde. Der Brooklyner Blue Pencil Club plante zu diesem Zeitpunkt eine Diskussion über die jeweiligen Vorzüge von Katzen und Hunden. Lovecraft hätte natürlich gern persönlich teilgenommen – insbesondere, da die meisten der geladenen Gäste Hundefreunde waren –, doch da er nicht nach New York kommen konnte oder wollte, verfasste er einen schriftlichen Diskussionsbeitrag, in dem er seine Zuneigung zu Katzen bekannte und zugleich eine – nur halb ironische – philosophische Begründung seiner Vorliebe gab. Das Ergebnis ist einer der köstlichsten essayistischen Texte, die Lovecraft verfasst hat.
Im Wesentlichen läuft Lovecrafts Argumentation darauf hinaus, dass die Katze das Haustier des Künstlers und Denkers ist, während der Hund von stumpfsinnigen Bürgern gehalten wird. »Der Hund spricht simple und oberflächliche Empfindungen an, während die Katze die tiefsten Quellen der Imagination und kosmischen Empfindungsfähigkeit im menschlichen Geist berührt.« Dies führt unvermeidlich zu einem veritablen Klassenunterschied zwischen beiden Spezies, den Lovecraft bündig zusammenfasst: »Der Hund ist ein Bauer und die Katze ein Gentleman.« Es sind letztlich nur oberflächliche Sentimentalität und der Wunsch nach Unterwürfigkeit, die im Lob des »treuen« und anhänglichen Hundes zum Ausdruck kommen, während die unnahbare Unabhängigkeit der Katze verschmäht wird. Es ist ein Irrtum zu meinen, dass die »sinnlose Geselligkeit und Freundlichkeit oder die sabbernde Hingabe und Ergebenheit des Hundes etwas an sich Bewundernswürdiges oder Wertvolles darstellen«. Betrachten wir das jeweilige Verhalten der beiden Spezies: »Wirf einen Stock, und der unterwürfige Hund japst und hechelt und schnauft, um ihn dir zurückzubringen. Tue dasselbe bei einer Katze, und sie wird dich nur mit kühler Höflichkeit und leicht gelangweilter Belustigung ansehen.« Und, sehen wir nicht denjenigen Menschen als überlegen an, der in seinem Denken und Handeln Unabhängigkeit beweist? Warum loben wir dann nicht die Katze, wenn sie ebendiese Eigenschaften an den Tag legt? Man besitzt eine Katze nicht, man bewirtet sie bestenfalls. Sie ist Gast, nicht Diener des Menschen.
Man könnte noch weit mehr anführen, doch sollte diese Kostprobe genügen, um ein Gefühl für die außerordentliche Eleganz und den trockenen Humor von »Cats and Dogs« zu vermitteln, einem Text, der Philosophie, Ästhetik und persönliches Empfinden zu einer Eloge jener Spezies vereint, die Lovecraft mehr als jede andere auf diesem Planeten bewunderte – seine eigene nicht ausgenommen.86
Allerdings war Lovecrafts schriftstellerischer Furor noch keineswegs erschöpft. Entgegen seinen üblichen Gewohnheiten schrieb er »The Silver Key« und »The Strange High House in the Mist«, während er gleichzeitig an einem wesentlich umfangreicheren Text arbeitete. Anfang Dezember berichtete er August Derleth: »Ich bin mittlerweile auf Seite 72 meiner Traumland-Phantasie …«87 Das Ergebnis, das Lovecraft Ende Januar 1927 fertigstellte, war das längste erzählerische Werk, das er bis dahin verfasst hatte: The Dream-Quest of Unknown Kadath.
Anmerkungen
1 HPL an Arthur Harris, 22. Juli 1924 (Manuskript, JHL).
2 HPL an LDC, 2. April 1925, Letters from New York, S. 116.
3 HPL an CAS, 15. Oktober 1927 (SL II.176).
4 HPL an LDC, 14.-19. November 1925 (Manuskript, JHL).
5 HPL an LDC, 27. Juli 1925 (Manuskript, JHL).
6 Im Februar 1925 kaufte Lovecraft Providence: A Modern City (1909 herausgegeben von William Kirk) und ein neues Exemplar von Henry Manns Our Police: A History of the Providence Police Force from the First Watchmen to the Latest Appointee (1889), einem Buch, das er bereits früher besessen hatte, das ihm jedoch abhandengekommen war. Zwischen Ende Juli und Mitte September verbrachte er viel Zeit im genealogischen Lesesaal der New York Public Library, um dort Gertrude Selwyn Kimballs Providence in Colonial Times (1912) zu lesen, eine umfassende Geschichte der Stadt im 17. und 18. Jahrhundert, die von einer 1910 verstorbenen Bekannten von Annie Gamwell verfasst worden war.
7 HPL an LDC, 8. August 1925, Letters from New York, S. 168.
8 Scott, »His Own Most Fantastic Creation«, in: Cannon, Lovecraft Remembered, S. 18. In seiner Ausgabe der Marginalia (wo Scotts Essay erstmals erschien), die sich heute im Besitz von Kenneth W. Faig Jr. befindet, hat Benjamin Crocker Clough, Rezensent des PROVIDENCE JOURNAL, notiert: »So hat er [Loveman] es mir erzählt, und ich habe es WTS erzählt. Ob er von ›Ampulle‹ sprach, dessen bin ich mir nicht mehr sicher.«
9 Hart, »Walkers in the City«, S. 10.
10 HPL an MWM, 15. Juni 1925, Letters from New York, S. 144.
11 HPL an LDC, 22.–23. Dezember 1925 Letters from New York, S. 254.
12 Scott, »His Own Most Fantastic Creation«, in: Cannon, Lovecraft Remembered, S. 18f.
13 Koki, An Introduction, S. 159.
14 Long, Dreamer on the Nightside, S. 167.
15 HPL an LDC, 29. März 1926, Letters from New York, S. 288f.
16 HPL an LDC, 1. April 1926, Letters from New York, S. 290f.
17 HPL an LDC, 6. April 1926, Letters from New York, S. 293.
18 HPL an LDC, 12.–13. April 1926, Letters from New York, S. 299f.
19 Davis, Private Life, S. 14.
20 Davis, Private Life, S. 20.
21 Davis, Private Life, S. 27.
22 Davis, Private Life, S. 23.
23 George Gissing, The Private Papers of Henry Ryecroft (1903), New York: E. P. Dutton, 1907, S. 54.
24 Gissing, Henry Ryecroft, S. 47; Davis, Private Life, S. 23.
25 Gissing, Henry Ryecroft, S. 56.
26 Gissing, Henry Ryecroft, S. 166.
27 Gissing, Henry Ryecroft, S. 280f.
28 HPL an AD, 16.Januar 1931 (SL III.262).
29 HPL an MWM, [2. Juli] 1929 (SL III.5, 8)
30 Davis, Private Life, S. 27.
31 Sonia H. Davis an Samuel Loveman, 4. Januar 1948 (Manuskript, JHL).
32 HPL an DW, 10. Februar 1927, Mysteries of Time and Spirit, S. 35.
33 HPL an Bernard Austin Dwyer, 26. März 1927 (SL II.117).
34 HPL an DW, 10. Februar 1927, Mysteries of Time and Spirit, S. 35.
35 HPL an DW, 27. März 1927, Mysteries of Time and Spirit, S. 63.
36 HPL an DW, 12. April 1927, Mysteries of Time and Spirit, S, 74.
37 Davis, Private Life, S. 11.
38 HPL an LDC, 12.–13. April 1926, Letters from New York, S. 301.
39 HPL an FBL, 1. Mai 1926 (SL II.46f.).
40 Lévy, Lovecraft: A Study in the Fantastic, S. 23.
41 Cook, »In Memoriam«, in: Cannon, Lovecraft Remembered, S. 116.
42 De Camp (Lovecraft: A Biography, S. 259) schreibt, dass Sonia durch einen »Termin, bei dem es um eine mögliche Arbeit ging«, aufgehalten wurde.
43 Cook, »In Memoriam«, in: Cannon, Lovecraft Remembered, S. 116f.
44 HPL an FBL, 1. Mai 1926 (Manuskript, JHL).
45 HPL an JFM, 16. Mai 1926 (SL II.50).
46 HPL an den Gallomo-Korrespondenzzirkel, [April 1920], in: Letters to Alfred Galpin, S.87.; HPL an RK, 21. Mai 1920 (SL I.114f.).
47 Lovecraft, DAS ÜBERNATÜRLICHE GRAUEN IN DER LITERATUR, S. 85.
48 Guy de Maupassant, »Der Horla«, übers. v. Georg Freiherr von Ompteda, in: Gesammelte Werke Bd. 7, Berlin 1905.
49 Robert M. Price, »HPL and HPB: Lovecraft’s Use of Theosophy« (CoC, Roodmas 1982), in: Ders., H. P. Lovecraft and the Cthulhu Mythos, S. 12–19.
50 HPL an CAS, 17. Juni 1926 (SL II.58). Es handelt sich um ein Kompendium zweier Werke Elliots: The Story of Atlantis (1896) und The Lost Lemuria (1904).
51 Vgl. HPL an AD, 5. Juni 1936 (SL V.263).
52 Keinen autobiographischen Hintergrund hat allerdings wohl die Namenswahl für den Mestizen Castro. Man hat vermutet, dass der Name auf Adolphe Danziger de Castro anspielt, den Freund von Ambrose Bierce, der später zu Lovecrafts Ghostwriting-Kunden zählte, doch kamen Lovecraft und de Castro erst Ende 1927 miteinander in Kontakt. In seinem wohl ersten Brief an Lovecraft vom 20. November 1927 (Manuskript, JHL) schreibt de Castro: »Mein Freund, Mr. Samuel Loveman, hat mich freundlicherweise darauf hingewiesen, dass Sie mir vielleicht dabei helfen könnten, die eine oder andere meiner Arbeiten herauszubringen, die dringend der Überarbeitung bedürfen.«
53 Steven J. Mariconda, On the Emergence of »Cthulhu«, S. 59, wo er die NEW YORK TIMES vom 1. März 1925 zitiert.
54 HPL an Bernard Austin Dwyer [Januar 1928] (SL II.217).
55 HPL an AD, 16. Mai 1931, Essential Solitude, S. 336.
56 HPL an FBL, 22. Februar 1931 (SL III.293).
57 HPL an Farnsworth Wright, 5. Juli 1927 (SL II.150).
58 Vgl. David E. Schultz, »The Origin of Lovecraft’s ›Black Magic‹ Quote«, in: CoC No. 48 (St John’s Eve 1987), S. 9–13. Ausführlicher zum Cthulhu-Mythos: Joshi, The Rise and Fall of the Cthulhu Mythos (Poplar Bluff, MO: Mythos Books, 2008).
59 Vgl. David E. Schultz, »From Microcosm to Macrocosm: The Growth of Lovecraft’s Cosmic Vision«, in: Schultz und Joshi, An Epicure in the Terrible, S. 12.
60 John Milton, Paradise Lost 1.26.
61 HPL an Duane W. Rimel, 23. Juli 1934 (SL V.10f.). In andere Richtungen weisen die Berichte einiger Kollegen Lovecrafts, die behaupteten, selbst gehört zu haben, wie Lovecraft den Namen aussprach. Donald Wandrei gibt ihn als K-Lütl-Lütl wieder (DW, »Lovecraft in Providence«, in: Cannon, Lovecraft Remembered, S. 313), R. H. Barlow bringt Koot-u-lew ins Spiel (RHB, On Lovecraft and Life, S. 14). Die einzige Aussprache, die wir definitiv ausschließen können – auch wenn viele sie weiterhin ungeniert verwenden –, ist Ka-thul-hoo. Wandrei berichtet, dass er den Namen anfangs in Lovecrafts Gegenwart auf diese Weise ausgesprochen und als Antwort nur einen verständnislosen Blick geerntet hätte.
62 Ausführlich zur Topographie der Stadtlandschaft in der Erzählung: Robert D. Marten, »The Pickman Models«, in: LS Nr. 44 (2004), S. 42–80.
63 HPL an AD, 25. Oktober 1926, Essential Solitude, Bd. 1, S, 44.
64 HPL an AD, 26. August 1926 und 27. September 1926, Essential Solitude, Bd. 1, S. 33, 37.
65 HPL an AD, 8. September 1926, Essential Solitude, Bd. 1, S. 36.
66 HPL an AD, 2. September 1926, Essential Solitude, Bd. 1, S. 34.
67 Frank Belknap Long gelang es, im Gegensatz zu Lovecraft, der Zeitschrift eine Geschichte zu verkaufen (»The Man Who Died Twice«[1927]), ebenso Lovecrafts späterem Kollegen und Freund, dem Conan-Erfinder Robert E. Howard.
68 HPL an Wilfred B. Talman, 21. Juli 1926 (SL II.61).
69 Talman, The Normal Lovecraft, S. 8.
70 HPL an FBL, 26. Oktober 1926 (SL II.79).
71 HPL an LDC, [15. September 1926] (Manuskript, JHL).
72 HPL an LDC, [15. September 1926] (Manuskript, JHL).
73 Es ist umso bedauerlicher, dass sich für den Artikel kein genaues Erscheinungsdatum ermitteln ließ, da mir nur ein undatierter Zeitungsausschnitt vorlag. Ich vermute, dass er im Frühjahr 1927 erschienen sein muss, obwohl Lovecraft ihn erst im Frühjahr 1928 von George Kirk erhielt, der ihn ein volles Jahr mit sich herumgetragen hatte.
74 HPL an FBL, 26. Oktober 1926 (SL II.87).
75 HPL an Fritz Leiber, 15. November 1936 (SL V.354)
76 HPL an den Gallomo-Korrespondenzzirkel, [April 1920] (SL I.106).
77 Kenneth W. Faig, Jr, »›The Silver Key‹ and Lovecraft’s Childhood« (CoC, St John’s Eve 1992), in: Ders., The Unknown Lovecraft, S. 148–82.
78 Der Name Benijah Corey ist möglicherweise aus den Namen zweier realer Bewohner von Foster zusammengesetzt: Der Besitzer der Farm, die gegenüber dem Haus lag, in dem Lovecraft während seines Besuchs wohnte, hieß Benejah Place, und Emma (Corey) Phillips war die Witwe von Walter Herbert Phillips, dessen Grab Lovecraft besucht haben muss.
79 HPL an AD, 26. November 1926, Essential Solitude, Bd. 1, S. 52.
80 HPL an AD, 26. Juli 1927, Essential Solitude, Bd. 1, S. 100.
81 HPL an AD, 4. August 1928, Essential Solitude, Bd. 1, S. 150f.
82 HPL an AD [2. August 1929], Essential Solitude, Bd. 1, S. 206.
83 HPL an FBL, 6. September 1927 (SL II.164).
84 HPL an AD, 6. November 1931 (SL III.433).
85 Vgl. S.T. Joshi, »Lovecraft and Dunsany’s Chronicles of Rodriguez« (CoC, Hallowmass 1992), in: Ders., Primal Sources, S. 177–181.
86 Als R. H. Barlow Lovecrafts Essay in der zweiten Ausgabe von LEAVES (1938) veröffentlichte, hielt er es für nötig, einige von Lovecrafts provokanteren – und nur halb-scherzhaften – politischen Anspielungen zu entschärfen. Gegen Ende des Textes bemerkt Lovecraft: »Der Stern der Katze ist, so glaube ich, gerade dabei zu steigen, während wir uns Stück für Stück aus den Träumen von Ethik und Demokratie lösen, die das 19. Jahrhundert vernebelt haben.« Barlow ersetzte »Demokratie« durch »Konformismus«. Kurz darauf schreibt Lovecraft: »Ob eine Renaissance von Monarchie und Schönheit unsere westliche Zivilisation wiederherstellen wird, oder ob die Kräfte des Zerfalls bereits zu mächtig sind, um selbst durch die faschistische Geisteshaltung in Schach gehalten zu werden, vermag heute noch niemand zu sagen …« Barlow ersetzte »Monarchie« durch »Kraft« und »die faschistische Geisteshaltung« durch »irgendjemand«. Doch trotz – oder vielleicht gerade wegen – solcher politisch äußerst unkorrekten Bemerkungen, ist »Cats and Dogs« ein Virtuosenstück, das Lovecraft auf der Höhe seines Esprits zeigt.
87 HPL an AD [Anfang Dezember 1926] (SL II.94).
* Und magst bei solchen Taten / Ein Abt oder Priester du sein, / Singst du kannibalische Gier / Auf jedem teuflischen Fest / Und zeigst der ganzen ungläubigen Welt ahnungsvoll das Zeichen des Tieres.