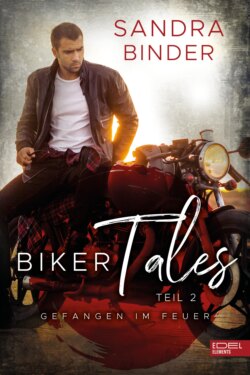Читать книгу Biker Tales: Gefangen im Feuer - Sandra Binder - Страница 8
Chapter 11 – Being Normal
ОглавлениеKaum hatte Bea die Tür hinter sich geschlossen, ließ sie sich auf den Fußboden im Flur ihres Elternhauses plumpsen, legte sich auf den Rücken und streckte ihre schmerzenden Glieder aus. Ihre Haut juckte vom Schweiß und dem feinen Sand in der heißen Luft, und ihre Lungen fühlten sich ebenfalls ganz rau an.
»Verdammte Wüste«, murmelte sie und holte keuchend Luft.
»Was soll das?«
Als Bea den Kopf drehte, konnte sie ihre Mutter durch die Wohnzimmertür auf der Couch sitzen sehen. Sie zog an einer Zigarette, als hinge ihr Leben davon ab, und blies den Rauch in einem Schwall wieder aus.
»Bist du betrunken?«, fragte sie.
»Nein. Du?« Bea rappelte sich so weit auf, dass sie ihren Rücken an die Wand lehnen und ihrer Mutter ins Gesicht sehen konnte. Wie so oft erschrak sie ob der aufgedunsenen Haut der Trinkerin, aber das war heute nicht das Schlimmste an ihrem Anblick. Rosemarys Augen waren total verquollen und rot gerändert.
»Bist verhaftet worden, hab ich gehört.« Ihre Stimme war ruhig, ihr Tonfall gleichgültig.
»War ein Missverständnis«, antwortete Bea schlicht.
»Was sonst.« Einmal mehr zog sie an der Zigarette und wandte den Blick von ihrer Tochter auf den Fernseher, woraus einige Frauenstimmen drangen, die heiter durcheinanderquasselten.
Was fanden die Leute nur an diesem blödsinnigen Frühstücksfernsehen?
Bea schüttelte schnaubend den Kopf und überlegte, wie solche Gespräche in normalen Familien abliefen. Allerdings war das hier nicht einmal für Rosemary Kramer ›normal‹. Früher hätte sie ihre Tochter geohrfeigt, grob beschimpft und aus dem Haus geworfen. War ihr jetzt etwa alles egal?
Tief durchatmend erhob sich Bea, stellte sich mit vor der Brust verschränkten Armen in den Türrahmen und musterte ihre Mutter, die sie geflissentlich ignorierte. »Ist das alles, was du dazu zu sagen hast?«
Träge hob Rosemary einen Mundwinkel, ohne den Blick vom Fernseher zu lösen. »Was willst du von mir hören? Ich wusste immer, dass du ein nichtsnutziges Gör bist, das nur Ärger macht.«
Am liebsten hätte Bea sie geschüttelt. »Kürzlich klang das alles noch viel leidenschaftlicher, Mom. Wo ist dein guter alter Hass hin?«
Endlich schaute ihre Mutter sie an, doch in diesem Moment wünschte Bea, sie hätte es nicht getan. Denn in ihren Augen sah sie lediglich dumpfe Leere.
»Weder die Entfernung noch die Jahre konnten ändern, was du bist. Ich habe alles versucht, aber ich sehe, dass es sinnlos war.« Sie drückte die Zigarette im Aschenbecher aus, stand vorsichtig auf und schwankte an Bea vorbei aus dem Zimmer, zur Treppe hinauf in den oberen Stock. »Ich bin mit dir fertig.«
Bea klammerte sich am Türrahmen fest, damit ihre weichen Knie nicht einknickten, und schaute Rosemary schockiert nach. Überraschend füllten sich ihre Augen mit Tränen.
Ihre Beziehung war vielleicht niemals die harmonischste oder gesündeste gewesen, die Mutter und Tochter haben konnten, doch an starken Emotionen hatte es zwischen ihnen nie gemangelt. Etwas in ihr berühren oder vielmehr auslösen zu können, egal in welche Richtung dieses Etwas ging, war für Bea immer der Beweis dafür gewesen, dass wenigstens ein winziger Teil in Rosemarys Herz für ihr einziges Kind schlug.
Es gab nur eines, das schlimmer war als Hass: Gleichgültigkeit.
Ihre Mutter hatte sie aufgegeben. Bea hätte niemals gedacht, dass sie dieser Umstand derart hart treffen würde. Ihre Mom endgültig zu verlieren, tat verdammt weh.
Höchste Zeit, von all diesem wirren Gefühlschaos Abschied zu nehmen und neu anzufangen.
*
Nachdem sie eine lange, kalte Dusche genommen hatte, fuhr Bea ins Büro. Hauptsächlich deshalb, weil sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte, und zu Hause allein mit ihren Gedanken verrückt geworden wäre. Davon abgesehen brauchte sie diesen Job. Mehr denn je.
Sie verspürte den unbändigen Drang, sofort die Stellen- und Wohnungsanzeigen zu durchforsten. Momentan wäre sie bereit, jeden Job anzunehmen, wenn er nur weit genug fort von hier wäre. Aber vermutlich sollte sie nicht überstürzt den Staat verlassen, nachdem sie gerade erst als Verdächtige in einem Mordfall verhaftet wurde. Verdammt. Wie das klang … Konnte ihr Leben denn nicht ein einziges Mal normal sein?
Wieso war es für sie nur so schwer, das zu erreichen, was der Großteil der Menschen mühelos schaffte? Sie wollte doch nur einen anständigen Mann heiraten, ihre Kinder liebevoll aufziehen und in einem netten Häuschen im Vorort leben, ohne Geldsorgen, ohne Streit und Drama oder leere Bierdosen und Whiskyflaschen im Garten. Sie wollte es besser machen als ihre Eltern. Doch stattdessen schien sie deren Chaos magnetisch anzuziehen.
Bea hielt auf dem Parkplatz vor dem Rathaus an, stellte den Motor ab und legte die Stirn aufs Lenkrad. »Was stimmt nur nicht mit mir?«, murmelte sie und seufzte. »Was mache ich falsch?«
Sie spulte all die gescheiterten Beziehungen in ihrem Kopf ab, das vermasselte Studium, die verlorenen Jobs, die teuren Autos, die sie zu Schrott gefahren hatte. Bisher hatte sie gedacht, ein gewöhnlicher Pechvogel zu sein. Doch allmählich kam es ihr vor, als steckte ein System dahinter. Je mehr sie sich bemühte, je härter sie an sich und ihrem Leben arbeitete, desto heftiger wurde sie zurückgestoßen. Es war, als fraß die Welt sie Stück für Stück auf, und alles Strampeln und Schlagen half nicht, dagegen anzukommen.
Allmählich war sie mit ihrem Latein am Ende. Was sollte sie denn noch alles versuchen? Sie fühlte sich so hilflos …
Noch nie war sie so weit von ›normal‹ entfernt gewesen wie heute. Sie hatte einen schlechtbezahlten Aushilfs-Job, liebte einen Outlaw, war eben aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden und schuldete einer kriminellen Vereinigung einen Riesenhaufen Geld. Wie zur Hölle konnte sie es nur so weit kommen lassen?
Ob sie sich letztendlich selbst im Weg stand? War sie es, die ihr Leben unterbewusst manipulierte? Seit sie aus Wolfville fortgegangen war, hatte Bea gegen diesen dunklen Teil in sich gekämpft. Doch er ließ sich nicht vertreiben, saß in ihrem Herzen wie ein hartnäckiger Tintenfleck und kam immer wieder zum Vorschein. Allmählich kam es ihr so vor, als sei es genetisch bedingt, dass sie nicht ›normal‹ leben konnte. Wie sollte sie diesen dunklen Fleck auf ihrer Seele nur jemals loswerden?
Sie stieg aus dem Wagen, schlug die Tür geräuschvoll zu und ging zum Rathaus. Es wäre vielleicht ein Anfang, sich wie eine zivilisierte Erwachsene zu verhalten und sich bei ihrer Chefin für die Verspätung zu entschuldigen.
Zielstrebig lief sie zum Büro von Mrs Sanchez hinauf, klopfte an die Tür und wartete brav, bis sie hereingebeten wurde.
»Miss Kramer.« Die Chefin schaute verwundert zu ihr auf, ehe ihr Blick zu der Analoguhr an ihrer Wand schweifte, die gerade einmal kurz nach zehn anzeigte. »Mit Ihnen hätte ich heute nicht mehr gerechnet.«
Bea legte die Hände aneinander und versuchte, so unschuldig wie möglich auszusehen. »Ich möchte mich in aller Form für meine Verspätung entschuldigen, Mrs Sanchez. Seien Sie versichert, dass so etwas nie mehr vorkommen wird.«
Sie hob die dünn gezupften Brauen. »Sie wollen also sagen, dass Sie von nun an nicht mehr verhaftet werden?«
Bea biss die Zähne zusammen und atmete durch. Für einen winzigen Moment hatte sie vergessen, dass sie hier in der Pampa war, wo sich Neuigkeiten wie ein Lauffeuer verbreiteten. »Nein, Ma’am, ich habe nicht vor, wieder verhaftet zu werden.«
Ihre Mundwinkel zuckten. »Na, das freut uns doch alle. Nun gehen Sie schon an die Arbeit.«
»Danke, Mrs Sanchez«, presste Bea zwischen zusammengebissenen Zähnen heraus, ehe sie das Büro verließ.
Im Flur schüttelte sie sich schnaubend. Musste sie sich von dieser Frau derart belächeln lassen? Heute fühlte sich das respektloser und demütigender an als je zuvor.
War das wirklich der Preis, den sie zahlen musste, wenn sie ›normal‹ sein wollte? Und fiel es anderen Menschen ebenso schwer, ihre Gedanken hinunterzuschlucken, des lieben Friedens willen?
Sie schüttelte den Kopf und schlurfte zu ihrem Arbeitsplatz, einem weiteren Merkmal dafür, wo sie in der Nahrungskette stand. Je kleiner der Schreibtisch, desto geringer der Wert des Menschen. Was für eine versnobte, ungerechte Gesellschaft das doch war!
Bea erwischte sich bei dem Gedanken, verstehen zu können, dass die Advocates in diesem System nicht mitspielen wollten und ihre eigenen Regeln machten.
Seufzend warf sie ihre Handtasche auf den Tisch und ließ sich in den Bürostuhl fallen.
»Du hast meine Anrufe ignoriert.« Mayas Kopf schob sich über die Trennwand, und ihre grünen Kulleraugen blickten Bea vorwurfsvoll an.
»Tut mir leid.«
»Seit wann bist du draußen?«
Bea stöhnte entnervt und warf den Kopf in den Nacken. »Weiß das etwa schon jeder?«
»Ja.« Maya lächelte geduldig.
»Schaut sie euch an, Beatrice Kramer, wie sie leibt und lebt.« Sie nahm einen Bleistift und schmetterte ihn gegen den Bildschirm. »Ein paar Leute werden sich diebisch darüber freuen, dass ihre Weissagungen korrekt waren. Bestimmt wurden nun auch einige fast verjährte Wetten gewonnen.«
»Scheiß drauf, was die Leute denken.« Maya verschränkte die Arme auf der Trennwand und legte den Kopf darauf ab. »Bist du echt das erste Mal in deinem Leben verhaftet worden?«
»Ist das so schwer zu glauben?« Bea warf ihr einen finsteren Blick zu, ehe sie zögerlich einlenkte. »Ich habe mich früher einfach nie erwischen lassen.«
Maya grinste. »Demnach kann dein neues Ich noch viel von deinem alten Ich lernen.«
Bea schaltete den PC ein und schüttelte den Kopf. Sie hatte das Thema fallenlassen und sich endlich mit Arbeit ablenken wollen, aber Maya hatte das Feuer in ihr neu entfacht. »Weißt du, das passiert, wenn man nur noch Herzchen in den Augen hat. Als ich hier ankam, hatte ich einen Plan, ein Ziel, wollte mich von Ärger fernhalten und schnellstmöglich verschwinden – stattdessen habe ich mich auf einen Kerl eingelassen, über dem ein riesiges, leuchtendes Neonschild mit der Aufschrift ›Gefahr‹ schwebt.« Ratlos hob sie die Hände. »Wie konnte ich das alles nicht sehen?« Sie stöhnte frustriert auf, als ihr noch mehr einfiel. »Und wie konnte ich all die Hinweise nicht verstehen? Tote Ratten, russische Ladys … Ich muss es schlichtweg ignoriert haben, denn so dumm bin ich sonst nicht. Also wieso?« Sie warf ihrer Freundin einen hilfesuchenden Blick zu. »Wieso habe ich es mitgemacht, wenn ich doch genau wusste, was los war?«
»Tote Ratten und russische Ladys?«, hakte Maya irritiert nach.
Bea winkte ab. »Tote Verräter und Kalaschnikows. Offensichtlich.«
»Offensichtlich.« Stirnrunzelnd nickte Maya, die ganz klar nicht mehr mitkam.
»Tja, und heute Morgen kam ich dann schließlich aus dem Knast.« Bea hob die Schultern. »Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Ich bin nicht einmal überrascht. Ich bin nicht einmal sauer über den Umstand, verhaftet worden zu sein. Viel schlimmer ist, von Charlie belogen worden zu sein. Ist das verrückt?«
»Na ja, so spektakulär war das ja auch nicht. Im Grunde ist überhaupt nichts passiert.«
Bea blinzelte ihre Freundin ungläubig an. »Ich. War. Im. Knast.«
»Für nicht einmal vierundzwanzig Stunden. Da kam schon Charlie auf seiner schwarzen Harley an wie der dunkle Märchenprinz und hat dich befreit.« Seufzend blickte sie zur Decke. »Das ist rohe, unverfälschte Romantik.«
»Das ist roher, unverfälschter Bullshit.« Bea musste sich ein Schmunzeln verkneifen. »Ohne diesen Märchenprinzen hätte ich nämlich nicht befreit werden müssen.«
»Ach, das ist doch wie die Sache mit dem Huhn und dem Ei …« Maya winkte ab, ehe ihr Blick hinter Bea glitt und ihr das Grinsen aus dem Gesicht wich. »Ups. Schätze, da ist jemand sauer auf dich.«
Vorsichtig wandte Bea sich um und sah Emma auf ihr Arbeitsabteil zumarschieren; die Augen zu zwei zornigen Schlitzen und die Lippen zu zwei dünnen, rosafarbenen Strichen verzogen.
An Beas Trennwand blieb sie stehen, verschränkte die Arme vor der Brust und fixierte sie von oben herab. »Was ist dein Problem?«
Bea runzelte die Stirn, holte Luft, schloss den Mund jedoch gleich wieder. War es nicht offensichtlich, wo ihr Problem lag? »Die Sache geht dich überhaupt nichts an, Emma.«
»Ist das so? Ich soll also still dabei zusehen, wie du einem meiner besten Freunde das Herz rausreißt und darauf herumtrampelst?« Sie legte eine Hand an die Stelle, unter der ihr Herz schlug. »B ist so etwas wie ein Bruder für mich. Ach, was rede ich denn, als ob du verstehen könntest, wie das ist.«
Bea erhob sich, um auf gleicher Höhe mit der Blondine zu sein, deren braungrüne Augen geradezu Funken sprühten. »Du kannst doch nicht einfach hier hereinstürmen und mir eine Szene machen. Charlie hat dich sicherlich auch nicht darum gebeten.«
»Nein, das hat er nicht, aber dir gehört einmal ordentlich der Kopf gewaschen, du Yankee-Ziege.« Emma trat näher, bis sie direkt vor Bea stand und lässig auf sie herabsehen konnte. »Hast du auch nur die leiseste Vorstellung davon, was du ihm antust? Der unerschütterliche Carl Hanson, der Typ, dem niemals die Finger zittern und der sonst immer Ruhe bewahrt, ist vorhin wie ein wildgewordener Irrer in den Courtroom gestürmt und hat die halbe Bar zertrümmert. Deinetwegen. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Es macht mir Angst, Bea.«
Bea spürte einen gewaltigen Stich im Herzen. Während sich ihre Gedanken in den vergangenen Stunden nur um sich selbst und das Chaos in ihrem Leben gedreht hatten, hatte sie nicht eine Sekunde lang an Charlies Gefühle gedacht. Am liebsten würde sie sich gerade in den Hintern treten für ihre Selbstbezogenheit.
»Wie ich sehe, erkennst du nun auch, dass du ein egoistisches Miststück bist«, fauchte Emma, die ihren Gesichtsausdruck leider richtig deutete.
»Hey, jetzt mach aber mal halblang.« Maya linste über die Trennwand, als sei diese ihr Verteidigungswall, und zeigte vage auf ihre Freundin. »Bea saß die ganze Nacht über im Knast. Seinetwegen. Da darf man schon mal die Contenance verlieren und seinen Freund rundmachen.«
Beinahe hätte Bea gelacht. Bei Maya klang die Sache so harmlos, als sei er lediglich zu spät zu einer Verabredung gekommen oder dergleichen. Ergeben hob sie die Hände. »Dann könnt ihr ja alle froh sein, wenn ich endlich verschwinde.«
»Nein!«, protestierten sie überraschenderweise unisono.
»Ich würde dir liebend gern beim Packen helfen, glaub mir«, Emma knuffte sie unsanft gegen die Schulter, »wenn ich es nicht so schäbig finden würde, wie du dich feige aus dem Staub machen willst.« Sie schüttelte ratlos den Kopf. »Ich verstehe es einfach nicht. Was willst du denn noch?«
»Ich will …« Bea blickte sich um, wodurch einige Schöpfe wieder hinter ihren Trennwänden verschwanden. Na toll, jetzt war sie nicht nur der Abteilungs-Knasti, sondern auch noch das ›egoistische Miststück‹, das in aller Öffentlichkeit angebrüllt wurde. Sie versuchte, so leise wie möglich weiterzusprechen: »Ich will ein normales Leben führen und nicht …«, in Ermangelung einer Erklärung deutete sie auf Emma, »… das da. Willst du mir etwa weismachen, dass du nie etwas Besseres für dich gewollt hast?«
Die Blondine legte den Kopf schief. »Nichts, wirklich gar nichts ist verkehrt an meinem Leben. Obwohl, oder vielmehr weil es nicht in deine beschissene kleine Schablone passt. Was ist denn bitte ›normal‹?« Ihre Brauen schoben sich finster zusammen und warfen düstere Schatten auf ihre Augen. »Es gibt nun einmal nicht nur schwarz und weiß – du lebst in einer Welt voller Grautöne, siehst du das nicht? Nichts ist nur gut oder nur schlecht. Und so vieles, das nach außen hin perfekt wirkt, ist im Inneren hässlich und verdorben.« Sie tippte so hart mit dem Zeigefinger gegen Beas Brust, dass es weh tat. »Du rennst etwas hinterher, das nicht existiert und übersiehst bei deiner sinnlosen Jagd nach Perfektion, was für ein verdammtes Glück du eigentlich hast.«
Bea wich automatisch einen Schritt zurück. »Glück? Ich? Du hast doch keine Ahnung von mir oder meinem Leben.«
Emma lachte humorlos auf. »Du siehst das nicht einmal!«
Täuschte sich Bea oder sammelten sich da Tränen in Emmas Augen?
»Du musst doch erkennen, wie reich du vom Leben beschenkt wurdest, weil du jemanden an deiner Seite hast, für den du das Allerwichtigste bist.« Emmas Stimme klang mit einem Mal viel sanfter und seltsam traurig. Wieso nahm sie diese Sache zwischen Bea und Charlie so sehr mit? »Wer hat sich wohl um deine Mutter gekümmert, nachdem du abgehauen bist? Wer hat dafür gesorgt, dass dein Vater anständig beerdigt wurde und sich deine Mutter danach nicht zu Tode gesoffen hat? Wer gibt Rosie jede Woche einen Scheck, ob sie zur Arbeit kommt oder nicht? Wer bitte, glaubst du, kümmert sich um dein Elternhaus und den Ärger mit Nachbarn und Stadt?« Sie deutete anklagend auf Bea. »Er tut all das für dich. Obwohl er nicht einmal gewagt hat, zu hoffen, dass du je wiederkommst. Er tut es, weil er dich liebt, bedingungslos und grenzenlos. Er hat dich immer geliebt und wird es immer tun. Und du trampelst eiskalt auf seinem Herzen herum.«
Bea schluckte. Nun stiegen ihr ebenfalls die Tränen in die Augen. Sie hatte all das gesehen, nur bisher nicht wahrnehmen wollen, was Charlie für sie und ihre Familie getan hatte.
»Andauernd redest du davon, fortzugehen und die Menschen, die dich lieben, zu verlassen. Du sagst ihnen, sie sind nicht gut genug und passen nicht in das hübsche kleine Spießerleben, das du dir wünschst. Niemals verwendest du auch nur einen Gedanken daran, wie es B, deiner Mom oder Maya damit geht, wenn du sie derart herabsetzt. Du bist eine herzlose Egoistin, ich hoffe, das weißt du.« Eine einzelne Träne rann über Emmas Wange. Fast trotzig wischte sie sie mit dem Handrücken fort und richtete erneut den Finger auf Bea. »Du hast alles: Einen Mann, der für dich sterben würde, eine Freundin, die dir zuhört, eine Mutter, die dich aufnimmt, wenn du in Schwierigkeiten steckst, eine Familie, die hinter dir steht.« Sie deutete auf ihr Shirt, auf dem die dämonische Fratze der Advocates prangte. »Du bist nicht allein, Bea. Nein, du nicht. So viele Leute wollen für dich da sein, aber du lässt sie einfach nicht. Du hast ein solches Glück und trittst es mit Füßen. Du bist wirklich der dümmste Mensch, der mir je begegnet ist.«
Ihre Worte bohrten sich regelrecht in Beas Herz. Es war niemals ihre Absicht gewesen, jemanden zu verletzen, aber bei aller Liebe und Freundschaft, die sie hier aufs Tablett brachte, schien Emma eine bedeutende Sache zu vergessen. »Ich wurde gestern in Handschellen abgeführt, weil ich der Beihilfe zum Mord verdächtigt wurde. Ich liebe Charlie, aber ich kann es nicht ertragen, ein Leben zu führen, in dem er oder wir beide mit einem Fuß abwechselnd im Knast oder im Leichensack stehen.«
»Du denkst zu viel über das nach, was sein könnte, als über das, was ist. Hör auf, alles zu überdramatisieren. Du warst eine Nacht im Knast – na, und?« Sie zuckte unbekümmert mit den Schultern. »Nichts ist geschehen, es war ein Missverständnis, und du bist frei.«
»Aber wie lange, wenn ich bleibe?«
Emma trat einen Schritt auf Bea zu, blickte ihr forschend in die Augen und schüttelte letztendlich abfällig den Kopf. »Manchmal muss man etwas riskieren für die Menschen, die man liebt. Wenn du dazu nicht bereit bist, sprich nicht von Liebe. B hat eine Frau verdient, die stark genug ist, um an seiner Seite zu stehen und den Mann zu lieben, der er wirklich ist. Aber du bist das offenbar nicht, Yankee.« Sie hob eine Braue, dann machte sie auf dem Absatz kehrt und marschierte davon.
Bea schnaubte, deutete auf die verschwindende Emma und blinzelte Maya ungläubig an. »Hat sie gerade gesagt, ich würde Charlie nicht genug lieben?«
»So etwas habe ich auch herausgehört, ja.«
Sie ließ sich in ihren Bürostuhl fallen und massierte sich die Schläfen, ehe sie erneut zu ihrer Freundin aufblickte. »Du nimmst es doch nicht persönlich, dass ich von hier verschwinden will?«
Maya zuckte hilflos mit den Schultern. »Ich muss gestehen, die Rede war ziemlich gut – ich fühle mich fast schon mitschuldig, obwohl ich nicht einmal etwas damit zu habe … Aber in einigen Punkten hat Emma gar nicht so unrecht.«
Bea sank noch tiefer in den Stuhl und legte sich die Hände übers Gesicht. Ewige Moralistin, die sie war, sprach sie ständig davon, ein besserer Mensch sein zu wollen, dabei war sie lediglich eine Egoistin, die die Leute, denen sie am Herzen lag, regelmäßig verletzte.
»Ich habe mich von dieser Stadt derart verarscht gefühlt, dass ich nicht nachgedacht habe, wie mein Hass auf meine Vergangenheit bei euch ankommt. Es tut mir leid.«
»Ich verstehe dein Dilemma.« Mayas Kopf verschwand hinter der Trennwand. Kurz darauf kam sie in Beas Abteil marschiert, setzte sich halb auf den Schreibtisch und bedachte sie mit einem ungewöhnlich ernsten Blick. »Du hast dir dein Leben anders vorgestellt, detaillierte Pläne geschmiedet und hohe Ziele gesetzt. Es ist schwer, einen solch durchstrukturierten Traum loszulassen, aber manchmal muss man sein Leben eben neu ordnen, wenn Faktoren hinzukommen, die es wert sind. Und ich schätze mal, die Liebe ist es wert, oder?« Sie tätschelte Beas Arm. »Alles andere liegt in deiner Hand. Du wirst nur dann wieder verhaftet, wenn du dich einer Straftat schuldig machst. Also schlage ich vor, du lässt das einfach sein.«
Bea konnte nicht anders, als zu lächeln. »Du bist eine sehr weise Frau, Maya.«
Sie zwinkerte ihr zu. »Besser eine späte Erkenntnis als gar keine.«
»Entschuldige mich bitte kurz.« Mit einem Seufzen erhob sich Bea, drückte ihrer Freundin die Hand und machte sich auf den Weg zur Teeküche. Sie spürte die Blicke der Kollegen auf sich, und da es in dem großen Raum mucksmäuschenstill war, konnte sie wohl davon ausgehen, dass die gesamte Abteilung die spontane Theatereinlage der drei Frauen verfolgt hatte.
Bea brauchte dringend einige Minuten für sich allein.
Nachdem sie den kleinen Aufenthaltsraum betreten hatte, schloss sie leise die Tür hinter sich, lehnte sich an die Küchenarbeitsplatte und atmete tief durch. Sie hatte das Gefühl, jeden Moment in Tränen auszubrechen und würde sich am liebsten auf dem Boden zusammenrollen und für den Rest des Tages nicht mehr aufstehen. Emma hatte ihr die Augen für eine völlig andere Sichtweise geöffnet und ihren Schuldgefühlen ordentlich Zunder gegeben.
Die Tür ging auf, doch Bea bewegte sich nicht, in der Hoffnung, der Eintretende bemerkte sie schlichtweg nicht. Sie stand direkt neben dem Eingang und sah ihn nur von hinten, erkannte Peters jedoch sofort an der schwarzen Haartolle und dem lachsfarbenen Poloshirt. Allerdings wirkte er heute nicht so dynamisch wie sonst, als er sich am Automaten Kaffee nachschenkte. Nachdem er sich umgedreht hatte, war ihr auch klar, wieso.
Ihr Boss sah ziemlich mitgenommen aus. Auf seiner sonst wohlgeformten Nase saß eine Schiene, und ungefähr die Hälfte seines Gesichts war blaugrün verfärbt. Außerdem war seine Unterlippe geschwollen und eingerissen. Das und seine Reaktion – er wich mit abwehrend erhobener Hand zurück – erzählten Bea den Rest der Geschichte.
Peters war der Zeuge, der sie angeschwärzt hatte. Natürlich. Immerhin hatte er sie aus Sanchez’ Büro kommen sehen und war daraufhin von seiner ›Untergebenen‹ bedroht worden. Das hatte er anscheinend nicht auf sich sitzen lassen können.
Bea legte den Kopf schief und verschränkte die Arme vor der Brust. Wenn sie ehrlich war, musste sie zugeben, dass er genau das bekommen hatte, was er verdiente. »Wieso hast du denn nicht auf mich gehört, Hal? Das hätte uns beiden eine Menge Ärger erspart.«
»Es tut mir leid, Miss Kramer.« Mit unwilliger Miene ging er auf die Knie und senkte den Blick zu Boden. »Ich bin eine inkompetente Pfeife und kann froh sein, Sie zu haben. Bitte verzeihen Sie mir. Es kommt nie wieder vor, dass ich Sie belästige oder mit meinen Lügen zur Polizei gehe.«
Bea schob irritiert die Brauen zusammen. »Wie bitte?«
Peters erhob sich schwerfällig und blickte vorsichtig zu ihr auf. »Sie sagen ihm doch, dass ich meinen Text aufgesagt und mich entschuldigt habe?«
»Wem?«
»Nun, Ihrem … Freund, diesem dünnen, tätowierten Kerl mit der Glatze. Bitte, ich will wirklich keinen Ärger mit Ihnen und Ihren … Freunden.«
»Smitty hat gesagt, Sie sollen vor mir niederknien und sich entschuldigen?« Beas Mundwinkel hob sich wie von selbst. Vermutlich war es falsch, dass sie sich derart gerührt fühlte, wenn ein Kerl ihretwegen verprügelt wurde, aber sie konnte nichts dagegen tun.
Mit einem Mal spürte sie am eigenen Leib, was Emma gemeint hatte. Die Jungs waren wie große Brüder, die für sie einstanden, sie beschützten. Da hatte sie eine ganze Familie bekommen, bei der sie sich sicher fühlen durfte, und es nicht einmal bemerkt.
Schmunzelnd schlenderte Bea auf den Ausgang zu.
»Miss Kramer?«, rief Peters ihr nach.
Sie drehte sich nicht um. Der überhebliche Kotzbrocken sollte ruhig ein wenig schmoren …