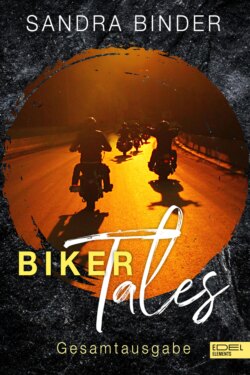Читать книгу Biker Tales - Gesamtausgabe - Sandra Binder - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prologue – Charlie
ОглавлениеWir alle treffen Entscheidungen. Jeden Tag. Manche sind leicht, andere kompliziert, und wieder andere bringen uns fast zum Verzweifeln. Aber das Schwierige ist nicht, sie zu fällen, sondern mit ihnen zu leben.
Niemand weiß, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat oder nicht, denn wir sind gezwungen, das Leben vorwärts zu leben, obwohl es erst rückwärts Sinn ergibt.
Ich habe in meinem Leben viele Entscheidungen getroffen, und vielleicht waren einige davon falsch, das mag stimmen. Aber ich hatte niemals Angst davor, meinen eigenen Weg zu gehen. Im Gegenteil. Ich selbst zu sein und zu dem zu stehen, was ich tue, ist die einzige Möglichkeit für mich, dem Kerl im Spiegel morgens in die Augen zu sehen.
Angst … Das ist ein Gefühl, das ich mir schon als Kind abgewöhnen musste. Mein Adoptivvater sah es nicht nur als Schwäche an, er nutzte meine Ängste dazu, mich stets an der schmerzhaftesten Stelle zu treffen. ›Abhärten‹, nannte er das. Oder ›impfen‹.
Als Kind hatte ich fürchterliche Höhenangst. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie er mich bei unseren Wanderungen ohne Sicherung von den höchsten und gefährlichsten Felsen klettern ließ und mich verprügelte, wenn er danach nur eine Träne in meinen Augen schimmern sah.
»Schlappschwanz!«, brüllte er mich dann an. »Du willst ein Mann werden – dann heul nicht.«
Die Zeit mit Rektor Brown hätte einen Psychopathen aus mir machen müssen, doch stattdessen lernte ich, jedwede Scheiße zu ertragen und dabei ruhig zu bleiben. Ich lernte, förmlich aus meinem Körper zu gleiten, kurzzeitig nicht mehr da zu sein, und so die Furcht zu umgehen. Manchmal tue ich das heute noch. Aber es gibt Situationen, in denen die Angst stärker ist und diesen Schutzschild niederreißt.
Meine Erinnerung mag mich trügen, ich glaube jedoch, bisher nur zwei Mal in meinem Leben richtige Panik gehabt zu haben. Eine von denen, die dir den Magen umdrehen, dich gedanklich lähmen und dir klarmachen, dass du nur verlieren kannst, egal, was du jetzt tust.
Das erste Mal war es an dem Tag gewesen, an dem ich den Advocates meine Loyalität beweisen sollte. Damals war ich noch Prospect beim Vegas-Chapter und bekam die Aufgabe, unserem Pres die Kutte eines Bribons zu bringen. Das hieß so viel wie: Knall einen unserer Feinde ab, damit wir wissen, dass du weder zu ihnen noch zu den Cops gehörst.
Die Clubs lagen zu der Zeit noch im Clinch, und es war nicht leicht, unbemerkt in ihr Territorium einzudringen, aber ich war schon immer ein guter Planer. Ich wählte einen von ihnen aus, brachte in Erfahrung, wo er lebte, arbeitete und welchen Weg er zu seinem Clubhaus nahm. Ich wusste genau, wie ich es anstellen musste, ohne bemerkt zu werden, doch auch der beste Plan funktioniert nicht, wenn man sich nicht daran hält.
Mein Verstand hatte irgendwo auf dem Weg von Vegas nach Reno ausgesetzt, vermutlich auf Höhe Wolfville, denn ich fand mich urplötzlich im Haus meines Adoptivvaters wieder. Ich war den halben Weg zum oberen Stockwerk hinaufgegangen, ehe ich wie aus einem Traum erwachte und die Glock in meiner einen sowie das Messer in meiner anderen Hand beäugte. Ich erinnerte mich zwar nicht mehr, wie ich hergekommen war oder das Haus betreten hatte, aber eines wusste ich in diesem Moment mit absoluter, schreckensklarer Sicherheit: Der Wichser musste sterben.
Hitze stieg in mir auf, und mein Herz klopfte heftig gegen meine Rippen, als ich den Weg ins Schlafzimmer fortsetzte. Es war noch nicht spät, aber ich kannte Brown gut genug, um zu wissen, dass er im Bett lag und las, anstatt wie der Großteil der Amerikaner vor der Glotze zu hocken. Es war ihm immer ein Bedürfnis gewesen, sich von den ›einfältigen Normalbürgern‹ abzugrenzen. Und das verlangte er auch von mir.
So kam es, dass ich bereits mit dreizehn Bücher wie Moby Dick, Krieg und Frieden und die Ilias gelesen hatte. Verstanden ebenso, denn er ließ mich jeden Sonntag ein Referat über meine Lektüre halten. Und war es nicht ausführlich genug, zog er mir einen Kochlöffel über den Schädel und ließ es mich noch einmal schreiben und vortragen.
Dieses Mal, so schwor ich mir, wäre er es, der etwas über den Schädel gezogen bekam. Dieser Sadist, der mich adoptiert hatte, um sein eigenes, formbares Spielzeug zu besitzen, würde nun die Quittung erhalten. Denn ich war nicht formbar. Und das würde er gleich erfahren.
Langsam schob ich die Tür auf. Er bemerkte mich sofort, bewegte sich jedoch keinen Millimeter, sondern blickte nur träge von seiner Lektüre auf und verzog die wulstigen Lippen.
»Was willst du jetzt tun, Junge?« Seine Stimme klang gelangweilt und einen Hauch belustigt. »Kommst hier an in deiner weibischen Lederkluft und meinst, du könntest einmal im Leben etwas zu Ende bringen?« Er lachte heiser auf und senkte den Blick auf sein Buch. »Bisweilen sind es doch die Gene und nicht die Erziehung, die einen Menschen ausmachen. Gott weiß, ich habe mein Bestes getan.« Er blätterte die Seite um und beachtete mich nicht weiter. Er dachte wirklich, er hätte rein gar nichts von mir zu befürchten.
Innerlich kochte ich, äußerlich blieb ich jedoch ruhig. Die Glock steckte ich zurück ins Holster, nahm stattdessen das Messer in die rechte Hand und ging zum Bett.
Brown blickte entnervt seufzend zu mir auf, als wollte er fragen, wieso ich seine Zeit verschwendete. Einen Herzschlag lang war es vollkommen still, die gesamte Welt hatte den Atem angehalten, dann stach ich das Messer direkt in seine Halsschlagader und zog es sofort wieder heraus. Ich sagte nichts – keine Abschiedsworte, keine Begründung, nichts, was man in den Filmen immer sieht. Ich verspürte kein Bedürfnis dazu.
Das Blut pumpte aus seinem Hals und durchtränkte die weißen Laken. Mein Adoptivvater blickte mit großen Augen zu mir auf. Er war überrascht, hatte nicht erwartet, dass ich tatsächlich diesen Mut aufbringen würde. Und während ich zusah, wie das Leben aus ihm wich, wunderte ich mich selbst darüber.
Mein Herz raste, meine Handflächen waren derart feucht, dass mir fast das Messer aus den Fingern rutschte, und Schweiß perlte auf meiner Stirn. Mir wurde unwiderruflich klar, dass ich damit eine Grenze überschritten hatte.
Ich hatte einen Menschen aus Rache getötet. Und ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, zu was für einen Mann mich das machen würde.
Ich wusste, dass diese Aktion mein gesamtes restliches Leben veränderte. Und als ob mir das nicht schon eine Scheißangst eingejagt hätte, kam noch hinzu, dass ich mich trotzdem frei und gerecht fühlte. Von einem Moment auf den nächsten war ein anderer Mann aus mir geworden, und ich hatte keinen Schimmer, welchen Weg dieser Kerl einschlagen würde.
Es war eine dieser Entscheidungen, die mich ins Ungewisse führte und meine Zukunft veränderte – und von der ich erst am Ende meines Lebens wissen werde, ob sie richtig war.
Inzwischen glaube ich, dass der Tod nicht unbedingt das Gefährlichste am Leben ist. Vielleicht habe ich mich allmählich an ihn gewöhnt. Es ist vermutlich wie bei allen harten Aufgaben im Leben; irgendwann bekommt man Hornhaut an den Stellen, die man oft benutzt und wird dort gefühllos. Vielmehr als den Tod fürchte ich das Leben. Das, was es einem nimmt und wiedergibt.
Ich schwöre, nicht einmal mein erster Mord ließ mich derart verzweifelt zurück wie mein Wiedersehen mit Bea.
Sie stand auf der anderen Straßenseite, sah mich nur an mit ihren unergründlichen braunen Augen, und ich wusste, diese Scheiße konnte ich nicht kontrollieren. Sie würde mich entweder ins Glück oder ins Verderben stürzen. Himmel und Hölle standen für uns offen, und ich musste einmal mehr eine Wahl treffen.
Ich habe mich entschieden, für uns zu kämpfen, auch wenn es mir eine Scheißangst machte, und auch wenn ich wusste, dass es mich umbringen konnte. Aber ich glaubte fest daran, dass es das wert wäre. Ich musste sie davon abhalten, mich noch einmal zu verlassen.
Scheiße, ich könnte alles verlieren. Alles. Aber nicht sie.