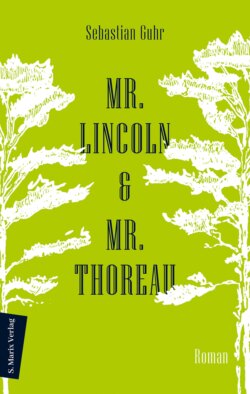Читать книгу Mr. Lincoln & Mr. Thoreau - Sebastian Guhr - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
RAUS
ОглавлениеHenry David Thoreaus Seele und Körper sind vor Kurzem ins Torkeln geraten. Sie stolperten und behinderten sich gegenseitig, seit sein Bruder John sich beim Rasieren in den Finger geschnitten hat und an den Folgen einer Tetanusinfektion starb.
Um sich vom Tod seines Bruders zu erholen, hatte Thoreau eine Kanufahrt den Sudbury hinauf gemacht. Er nahm eine Angel mit, um sich wie ein Indianer aus dem Wasser zu ernähren und briet den Fisch abends am Ufer, aber der Boden war trocken und das Feuer griff schnell auf das Laub der Umgebung über. Plötzlich stand Thoreau vor einer Feuerwand, die sich rasend ausbreitete, Eichhörnchen rannten davon und eine brennende Taube flatterte aus dem Qualm heraus. Er hörte Glocken läuten und hoffte, dass die Stadtbewohner hierher unterwegs waren. Er selbst würde das Ungeheuer, das er in die Welt gesetzt hatte, nicht mehr kontrollieren können.
Als der Besitzer des Waldstücks mit Helfern kam, saß Thoreau auf einer felsigen Anhöhe und beobachtete das Schauspiel. Er hatte kapituliert, er war wie paralysiert und schämte sich.
Und jetzt will Thoreau nur noch fort von den Menschen. An diesem Märztag des Jahres 1845 ist er früh aufgestanden, hat das Haus seiner Eltern verlassen und ist zur Schmiede gegangen. Er braucht Werkzeug, um sein Leben zu ändern, dringend, bevor er den Mut verliert.
Er sieht sich in der Schmiede um und zählt die Hufeisen, die an den ungeputzten Wänden hängen, fängt immer wieder von vorn mit dem Zählen an, um sich abzulenken, bis der alte Scudder aus der hinteren Werkstatt kommt und ihn fragend ansieht. »Eine Axt willst du?«
»Und einen Hammer und Nägel. Bitte. Und eine Säge.«
Der alte Scudder mag ihn nicht, er war damals mit im Wald, um das Feuer zu löschen. »Was hast du diesmal vor?«
Dreihundert Morgen sind durch Thoreaus Achtlosigkeit zerstört worden, darunter viel Jungwald, und dazu endgültig sein Ansehen bei den Bewohnern Concords. Sie schimpfen ihn Feuerteufel und spucken hinter seinem Rücken aus, aber deshalb will er sie nicht verlassen. Er kümmert sich nicht darum, was die Menschen von ihm denken. Es geht ihm um sein eigenes Leben, um seine Gesundheit, und um die Gesundheit seines Denkens. Ja, er will sich eine gesunde Umgebung für sein Nachdenken bauen.
»Nur geliehen«, sagt Thoreau und versucht zu lächeln. Geld, um sich eigenes Werkzeug zu kaufen, besitzt er nicht. Er hat alles verschenkt. Er glaubt nicht an Besitz, nicht daran, dass er mit Geld gesund leben kann.
»Aber wofür?« Scudder wischt sich seine Hände an einem Lappen ab, sein Interesse ist geweckt, auch wenn er ahnt, dass nichts Gutes dabei herauskommt.
»Um mein Leben von allem Nutzlosen abzuspalten.«
»Willst du dir eine Tonne als Zuhause zu bauen?«
»So ähnlich.« Er überlegt, wie viel er einem Stadtbewohner von seinen Plänen verraten darf. Er war zu lange viel zu offenherzig gewesen. »Einen Ort, wo ich ganz bei mir sein kann. Ich muss über mich nachdenken.« Er vergräbt seine Hände in den Taschen seines Baumwollhemds, ballt sie zu Fäusten, starrt auf den Lehmboden.
»In Gottes Namen, du meinst es wirklich ernst.« Scudder macht ein Kreuz mit der Hand, schüttelt den Kopf, holt Axt, Hammer und Nägel und wirft sie ihm vor die Füße. »Aber meine Säge bekommst du nicht.«
Thoreau packt das Werkzeug in den Rucksack und bedankt sich hastig. Halb hat er damit gerechnet, sich auf anderem Weg Werkzeug zu besorgen, nachts in einen der Höfe einbrechen zu müssen oder Schlimmeres. An Gesetze glaubt er schon lange nicht mehr. Zumindest nicht an das Gesetz der Stadt.
Als er aus der Schmiede tritt und die Kirche, das Gerichtsgebäude und das Postamt sieht, bekommt er keine Luft mehr. Sein Hals schnürt sich zu und er spürt, wie der Schweiß von seiner Stirn rinnt. Er hat genug von dieser kleinen, ordentlichen Stadt. Die meisten Menschen hier leben in stiller Verzweiflung, und sie sind ernsthaft überzeugt, es gäbe keine Wahl.
Er will ihnen zeigen, dass es eine Wahl gibt und beginnt zu rennen, an Geschäften und bürgerlichen Häusern vorbei, aus deren Fenstern sie ihm hinterhersehen wie einem Verrückten. In dieser Stadt wurde er geboren, seine Familie gehört zu den ältesten hier, und er hatte eine behütete Kindheit. Der Ärger begann, als er nach dem Studium hierher zurückkehrte und ein paar Reformen vorschlug. Eine Gemeinschaftskasse, eine Wohlfahrt für die Armen. Das haben ihm die weniger Armen verübelt.
Eine Tonne auf dem Marktplatz, wie Scudder meinte, wird es nicht werden, eher ein Kürbis draußen im Wald. Thoreau rennt immer noch, in Richtung Wald, und das schwere Gepäck auf seinem Rücken klappert mit jedem Schritt. Er spürt die Stadt hinter sich – hinter und über sich, wie schwebend. Die Meinungen, die Vorurteile, das Geschwätz, sie enden nicht an der Stadtgrenze, nein, sie verfolgen ihn. Sein Weg führt an Feldern und an einer Wassermühle vorbei, und bevor er den Pfad in den Wald hinein nimmt, dreht er sich noch einmal um. Nur noch der Kirchturm ist zu sehen und das Hämmern der Schmiede zu hören. Das helle, metallene Klirren, wenn der Hammer auf den Amboss trifft, stur und produktiv. Die Arbeit der Stadt wuchert nach innen und außen, auch davor flieht Thoreau. Die Stadt hat ihn zu einem von Krankheit befallenen Nervenbündel gemacht, das zwischen Zeit und Ewigkeit steht wie ein welkes Blatt. Ein welkes Blatt, das nur noch zitternd am Ast hängt.
Aber er muss aufpassen, sich nicht zu sehr aufzuregen. Dann kennt er keine Nuancen mehr, dann wird sein Denken zu einer Horde Büffel. Ständiges Ärgern über die Verhältnisse lässt einen das Beste in sich vergessen.
Er geht weiter, beginnt zu schlendern und blickt nach oben, wo die Baumkronen sich zu einem durchlässigen Dach verbinden. Das Wetter ist kühl für einen Frühlingstag, aber hier und da sprießen schon grüne Zweige. Dutzende Grüntöne, die er sieht und nochmal dutzende, die er noch nicht sieht, aber sehen lernen möchte. Er atmet tief ein. Der Schweiß auf seiner Stirn ist getrocknet. Allmählich bekommt er wieder Luft.
Sein Freund Ralph Waldo Emerson, der große Philosoph und berühmteste Sohn der Stadt, hat ein Waldstück gekauft und ihm erlaubt, dort eine Hütte zu bauen. In Harvard gehörten sie einem gemeinsamen Zirkel an, den Transzendentalisten. Waldo stammt aus einer reichen Familie, und Thoreaus Verhältnis zu ihm ist widersprüchlich. Einerseits hält er ihn für einen Snob, andererseits bewundert er seine Schriften. Thoreau trägt ein Buch von ihm mit dem Titel Natur im Gepäck, das er schon dreimal gelesen und mit vielen Anmerkungen versehen hat. Auch Thoreau wollte Schriftsteller werden, damals, in glorreichen Harvard-Zeiten, aber seine Buchprojekte hat er aufgegeben, nachdem seine Aufsätze von sämtlichen größeren Ostküsten-Zeitschriften abgelehnt wurden. Margaret Fuller, ebenfalls Transzendentalistin und Herausgeberin der Zeitung Dial, hat ihm fehlende Stringenz in seinen Texten vorgeworfen. Es stimmt schon, sein Denken ist wild. Aber was gibt es Schöneres, als das natürliche, urwüchsige Denken?
Durch Baumstämme hindurch erscheint der Waldensee und eine Lichtung, wo junge Tannen und Walnussbäume wachsen. Noch ist das Eis auf dem See nicht geschmolzen, aber es gibt schon einzelne offene Stellen. Thoreau weiß nicht warum, aber er muss plötzlich weinen. Ist das der Ort, den er gesucht hat? Tränen kullern ihm die Wangen hinab, und er nickt und lächelt, als ob er dem See einen guten Morgen wünscht. Das Einzige, was er hier in den kommenden Monaten machen möchte, ist wandern, nachdenken, lesen und körperlich arbeiten. Er möchte die Essenz des Lebens in sich aufsaugen, um alles in sich auszurotten, was nicht lebendig ist. Die toten, ungesunden Elemente wie Kieselsteine ausspucken.
Er lässt den Rucksack fallen und legt sich der Länge nach hin, vergräbt sein Gesicht im Nadelboden und riecht die Erde. Man muss offenbar nicht weit in die Wildnis hinausgehen, um so einen Ort zu finden. Ganze drei Meilen haben genügt.
Da es erst Mittag ist, fühlt er sich frisch und bereit für die Arbeit. Zunächst bestimmt er den Ort für die Hütte und das kleine Feld, das er anlegen möchte. Dann kommt Scudders Axt zum Einsatz. Thoreau ist handwerklich begabt, im Gegensatz zu Waldo mit seinen zwei linken Händen. Waldo hat zwar ein Buch über die Natur geschrieben, hält es aber keinen halben Tag in der Natur aus. Dieser Gedanke belustigt Thoreau, er kichert vor sich hin, während er das Unterholz lichtet.
Der erste Baum fällt nach drei Stunden. Vorher ist Thoreau auf ihn geklettert und hat nach Vogelnestern gesucht, die er auf andere, weiter entfernt stehende Bäume umsiedelte. Jetzt benutzt er die Axt als Fällkeil und lehnt sich gegen den Stamm, bis dieser knackend nachgibt und auf den Waldboden niederrauscht. Vögel flattern davon, ihr Kreischen hallt durch den Wald wie durch eine Kathedrale.
Mehr schafft er heute nicht. Er kehrt am nächsten Tag zurück, um weiter Holz zu schlagen und zu bearbeiten, und am Tag darauf, bis eine Woche vergangen ist. Da der Boden sich als steinig erweist, sammelt er die größeren Brocken auf einem Haufen, aus dem er später einen Backofen bauen möchte. Bis dahin isst er mittags sein Butterbrot, auf einem Baumstumpf sitzend. Die Sonne wärmt ihm die Stirn. Seine Finger kleben vom Harz und auch das Brot schmeckt nach Wald. Er liest die Zeitung, in die seine Mutter das Brot eingepackt hat, und er stellt fest, dass es nichts Neues in der Welt gibt. Ein paar Landgewinne im Krieg gegen Mexiko, die die Grenze der Sklavenhalterstaaten weiter nach Süden verschieben. Und der Norden schweigt wie immer dazu. Thoreau seufzt und knüllt die Zeitung zusammen. Die ewige Dummheit der Menschen. Das ist nichts, womit er sich hier draußen beschäftigen möchte.