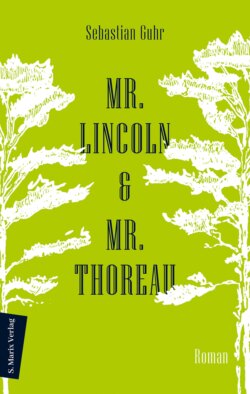Читать книгу Mr. Lincoln & Mr. Thoreau - Sebastian Guhr - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
GRÜN
ОглавлениеEs ist nicht leicht, eine Hütte im Wald zu bauen. Die Natur ist oft betörend, aber manchmal wird sie zum Gegner. Eine Windböe wirft das Gerüst um, und Thoreau muss die Arbeit von vorn beginnen. Spätestens bis zum Winter muss er sich um die grundlegenden Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Obdach, Kleidung und Heizung gekümmert haben. Und erst wenn diese Dinge sicher sind, kann er sich den wahren Problemen eines Lebens in Freiheit widmen.
Während seine Hände so viel zu tun haben, liest er wenig. Trotzdem spürt er das unausrottbare Bedürfnis nach Schrift. Der kleinste Fetzen Papier, der auf der Erde liegt und ihm als Untersetzer oder Tischtuch dient, unterhält ihn so großartig wie Homers Ilias. In einem Tagebuch protokolliert er seine Erlebnisse.
Als er an einem Sommernachmittag zur Quelle hinübergeht, weil ihm das Seewasser zu warm ist, kommt Scudder den Waldweg hinab. Der Schmied grüßt nicht, blickt nur misstrauisch und sagt, dass er sein Werkzeug zurückhaben will.
»Noch zehn Tage, Scudder. Ich bin noch nicht ganz fertig.«
»In der Stadt erzählt man sich, du würdest hier eine neue Kirche gründen. Eine Art Sekte oder so. Nicht mit meinem Werkzeug.«
Thoreau muss lachen und deutet in Richtung Hüttengerüst. »Sieht das nach einer Kirche aus? Ich will hier nur in Ruhe leben.«
Scudder spuckt auf den Boden und sieht zur Baustelle hinüber. »Gut, eine Woche. Nicht länger.« Dann stapft er wieder den Waldweg hinauf in Richtung Concord.
Thoreau denkt, dass er es in einer Woche schaffen kann. Er verkürzt seine Pausen, während er einen Kamin mauert und ein Feld von zweieinhalb Morgen anlegt, auf dem einmal Bohnen, Kartoffeln, Mais und Rüben wachsen sollen. Seine silberne Taschenuhr tauscht er gegen die alte Baracke eines Eisenbahners, mit deren Brettern er die Seitenwände seiner Hütte verkleidet. Dabei haut er sich auf den Daumen und schreit so laut, wie er es in der Stadt nie getan hätte. Der Schrei hallt vom anderen Seeufer zurück, Thoreau antwortet ihm, und so geht es eine Weile hin und her, bis seine Stimme heiser ist. Er kann sich hier draußen gut mit sich selbst unterhalten.
Am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag, zieht er in seine Hütte ein. Es ist sein persönlicher Unabhängigkeitstag, an dem Ralph Waldo Emerson ihn besucht. Sein Freund trägt einen weißen Anzug, weiße Handschuhe aus Satin und ein Moskitonetz am Hut. Der gefeierte Schriftsteller erzählt gern von seinen Vortragsreisen und lästert über Leserbriefe. Er hat einen mitgebracht, aus dem er vorliest, bevor er ihn ins Feuer wirft. Als Waldo das Leben hier draußen als transzendentalistisches Projekt bezeichnet, will Thoreau widersprechen. Das Wort »Projekt« gefällt ihm nicht, es beinhaltet etwas Unechtes. Aber zu widersprechen würde bedeuten, noch mehr reden zu müssen, und deshalb schweigt Thoreau.
Zusammen heben sie die Tür in die Angeln, die letzte Arbeit an der Hütte, die noch getan werden muss. Waldo stellt sich dabei so ungeschickt an, dass es eher eine symbolische Geste ist als wirkliche Hilfe. Und als sich der Philosoph einen Splitter einhandelt, tanzt er vor der Hütte einen kurzen Tanz des Schmerzes, bevor er sein Notizbuch zückt, um das Erlebnis festzuhalten. Er sagt, er plane eine Fortsetzung seines Naturbuchs, aber Thoreau, der die eingesetzte Tür prüfend öffnet und schließt, hört nicht mehr zu.
Danach sammeln sie Pilze, und als Waldo beim Pflücken seine Handschuhe nicht ausziehen möchte, wird Thoreau ungehalten. »Bist du nicht Transzendentalist, weil du über deine Sinne Gottes Schöpfung erfahren willst?«
»Der Splitter war sehr sinnlich!«
»Konzentriere dich darauf, was du hörst und riechst und siehst. Vergiss deine Konzepte!«
Er hält dem Freund einen Pilz unter die Nase. Waldo hebt das Moskitonetz an und riecht kurz daran. »Muffig.«
»Was noch?«
»Unanständig. Nach …« Er geht weiter und spricht von einem Aufsatz, den er über die soeben gemachte Erfahrung schreiben möchte. Thoreau seufzt und hat keine Lust, weiterzureden.
Als Waldo einen Grasfleck auf seinem Anzug entdeckt, sorgt er sich um sein Aussehen bei der Rückkehr in die Stadt, und letztlich ist Thoreau froh, als sein Freund ihn wieder verlässt. Waldo hat nicht wirklich verstanden, um was es ihm hier geht.
In seiner ersten Nacht streift ein Bär um die Hütte, schnauft und kratzt an der Tür wie liebestoll. Thoreau schreckt aus dem Schlaf auf und greift nach dem Hammer, haut damit auf den Hüttenboden und macht Lärm. Kurz verstummt der Bär, aber bald darauf wirft er sich mit Wucht gegen die Bretterwand, sodass die ganze Hütte wackelt. Thoreau hat keine Angst, im Gegenteil, in seiner Brust kribbelt es, wie wenn man in eiskaltes Wasser springt. Er kann das feuchte Fell des Bären riechen, und er baut sich aus der Axt und einem morschen Kartoffelsack eine Fackel, die er mit einem Zündholz in Brand setzt. Damit bewaffnet, reißt er die Tür auf und springt auf den Bären zu. Dessen schwarze Augen funkeln im Schein der Flamme. Die Natur hat Augen, denkt er und wedelt mit der Fackel, treibt das Tier vor sich her, bis es sich in den Wald zurückzieht.
Außer Atem steht Thoreau auf der Lichtung, hört das aus der Dunkelheit kommende Schnaufen und entschuldigt sich bei dem Bären. Nach einer Weile wird es still. Meister Petz hat ihn als Nachbar akzeptiert. Aber als er wieder in seinem Bett liegt, hört er aus der Ferne eine Eisenbahn rattern. Die kann er nicht so einfach mit einer Fackel vertreiben, sie ist die Fackel, die ihn vertreiben will. Es muss der Nachtzug über Boston nach New York sein. Er hätte nicht gedacht, dass man den bis hierher hört. Er ist eben doch nur wenige Meilen in den Wald hineingegangen. Thoreau dreht sich murrend auf die Seite, presst seine Arme gegen die Ohren und fragt sich, ob er den Menschen wirklich jemals entkommen kann.
Am Morgen ist das Beet zerwühlt, allerdings nicht von Bärenpfoten, sondern von Murmeltierkrallen. Thoreau hadert nicht, er baut ein Gatter um das kleine Feld und steckt neue Samen in die Erde. Später sucht er in Büschen nach Vogelnestern, deren Eier er bis auf eines entnimmt. Aus dem zurückgelassenen Ei soll der Vogel schlüpfen, der ihn im nächsten Jahr versorgt.
Am Abend brät er sich einen Fisch und isst, auf einem Baumstumpf am See sitzend, wilde Beeren. Obwohl er den ganzen Tag mit niemandem gesprochen hat, fühlt er sich nicht einsam. Die Natur, die für manche Menschen eine nackte und grässliche Einöde ist, ist für ihn eine süße und bekömmliche Gesellschaft. Er hört ein Plätschern und sieht einen Reiher krächzend über das Wasser tapsen wie eine verirrte Seele.
Die Toten, sind sie um ihn herum? Hier im Wald erinnert ihn wenig an seinen Bruder. Die Stadt, die Häuser der Menschen halten die Erinnerungen wach, und damit die Wehmut und den Blick zurück. In der Natur kann er besser im Jetzt leben; was verbrannt ist, ist verbrannt. Trotzdem ruft er sich nun, am Seeufer, Anekdoten mit John in Erinnerung, wie ihren gescheiterten Versuch, eine Reformschule in Concord zu gründen oder ihr Werben um dieselbe Frau. Sie hieß Ellen Sewall. Dieser Reinfall ist nun zwei Jahre her. Freiheit heißt für ihn auch, sich keine Frau mehr suchen zu müssen.
Er möchte hier draußen unabhängig und intensiv leben. Und er will sich mit sich selbst beschäftigen, in sich hineinhören, nicht gehetzt und nicht mit Sorgen belästigt werden. Hier draußen hat er sich einen Rückzugsort dafür gebaut, der wenig komfortabel ist. Aber mit Komfort konnte er noch nie etwas anfangen. Lieber sitzt er auf einem Baumstamm, der ihm allein gehört, als gedrängt auf einem Samtkissen. Er möchte sich, wenn er stirbt, nicht eingestehen müssen, nie wirklich gelebt zu haben.
Es ist merkwürdig, wie leicht er in eine Routine gerät. Er wohnt erst fünf Tage am See, und schon haben seine Füße zum Ufer hin einen Pfad ausgetreten.
Alles in allem ist er mit seiner Hütte zufrieden. Fünfzehn Quadratmeter für sich, dazu ein Vorratskeller und ein winziger Dachboden. Ein Tisch, ein Bett, ein Schreibpult und drei Stühle. Den ersten Stuhl für die Einsamkeit, den zweiten für die Freundschaft und den dritten für die Gesellschaft, auf die er allerdings auch gut verzichten kann.
Der Schornstein muss noch gemauert werden, aber das kann warten, solange Sommer ist. Auch die Ritzen müssen verputzt werden, wenn im Winter nicht der Wind durch sie hindurchpfeifen soll. Seine Hütte ist luftig, zur Aufnahme eines reisenden Gottes bereit, und gerade als er das denkt, klopft es an die Tür.
Es ist ein vorsichtiges, menschliches Klopfen, kein Göttliches. Und es kommt vom Knöchel des Reverend Channing. Als Jugendlicher hat Thoreau seine Predigten in der unitarischen Kirche Concords gehört, bis es zu einem Streit über die Auslegung einer Bibelstelle kam. Seit fünf Jahren ist er nun in keinem Gotteshaus mehr gewesen.
Er lässt den weißhaarigen Mann mit dem bestickten Umhang nicht rein, öffnet die Tür nur einen Spalt breit. Er ahnt – nachdem, was Scudder über die Gerüchte in der Stadt erzählt hat –, weshalb der Geistliche hier ist. »Reverend Channing, was führt Sie her?«
»Haben Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich?«
Thoreau nickt in Richtung See und fordert ihn auf, sich zu bedienen.
»Sie besitzen immer noch Ihren ganz eigenen Humor, Henry David.«
»Wie kann ich Ihnen sonst noch helfen?«
»Kehren Sie in unsere Gemeinschaft zurück. Hier draußen, wo soll das hinführen?«
»Aber Reverend, in der Natur bin ich meinem Schöpfer näher als in Ihrer Kirche! Der Wald ist meine Kathedrale.«
»Das sind Ideen, die ich ablehne. Aber diesmal geht es mir nicht um einen Glaubensstreit, sondern um Ihre Familie. Ihre Mutter macht sich Sorgen.«
»Wurden Sie von ihr geschickt?«
»Von ihr und anderen, die es gut mit Ihnen meinen. Wir wollen nicht, dass Sie hier draußen verwildern. Im Wald ist man verführbarer als in der Stadt. Wir denken, dass Sie Hilfe brauchen, nach allem, was passiert ist. Nach dem Waldbrand und ihrer überstürzten Flucht.«
Das ist es. Man will ihm verzeihen. Die Gemeinschaft streckt die Hand nach ihm aus! Aber er will die Hand nicht ergreifen, und er schlägt dem Reverend die Tür vor der Nase zu. Aufgebracht geht er in der Hütte auf und ab. »Verschwinden Sie!« ruft er in Richtung Tür. Verführbar? Die Natur ist nicht hinterhältig, sondern die Menschen sind es. Sogar in ihrer Brutalität ist die Natur ehrlich.
Zwei Stunden später erscheint seine Mutter mit einem vollgepackten Picknickkorb im Wald. Sie trägt eine schwarze Haube und immer noch den Trauerschleier von Johns Beerdigung. Er sieht sie durchs Fenster und fragt sich, ob nacheinander die halbe Stadt vorbeikommen wird, um ihn zur Rückkehr zu überreden. Warum macht es ihnen so eine Angst, wenn jemand sich von ihnen abwendet?
Er möchte nicht, dass seine Mutter ihn sieht. Sein Bart, den er sonst nur am Hals und unter dem Kinn wie eine fusselige Krause stehen lässt, beginnt nun auch auf den Wangen zu sprießen, und seine Kleidung hat er noch nicht gewaschen, seitdem er hier draußen lebt. Er verriegelt die Tür, versteckt sich unter dem Bett und hofft, dass seine Mutter den Korb bloß abstellt und dann verschwindet.
Sie rüttelt an der Tür und ruft ihn, während er mit geschlossenen Augen unter dem Bett liegt und sich nicht regt. Wahrscheinlich ist es ihr als Vorsitzender des Frauenvereins schlicht peinlich, dass er sich für ein Leben als Waldgeist entschieden hat. Sie wünscht sich, dass er wieder Lehrer wird, oder dass er wieder in der Bleistiftfabrik seines Vaters arbeitet. Auch wenn seine neuartigen Ideen die Fabrik damals fast in den Bankrott getrieben haben. Immer sind es seine Ideen, die sich schnell zu Manien auswachsen, die ihn und andere in Schwierigkeiten bringen. Er stopft sich seine Fingerspitzen in die Ohren und erinnert sich, dass er als Kind stolz auf den guten Ruf seiner Familie war. Jeder kannte den jungen Thoreau, dessen fehlgeschlagene Projekte mit der Zeit nur leider immer öfter zum Stadtgespräch wurden. Und nun sein seltsames Leben draußen am See.
Nach einer Weile verstummt das Rufen und Klopfen seiner Mutter. Er kriecht aus seinem Versteck hervor und schleicht zum Fenster. Er ist wieder allein.
Vor der Tür steht der Picknickkorb, darin Portwein, Brot und Käse. Vergesst mich doch einfach, denkt er und hat ein schlechtes Gewissen.