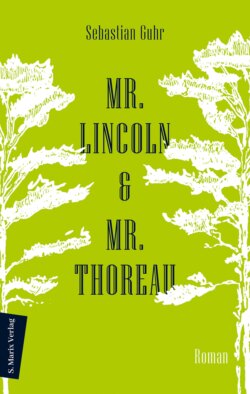Читать книгу Mr. Lincoln & Mr. Thoreau - Sebastian Guhr - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SCHWARZ
ОглавлениеSeit Tagen regnet es. Lincoln sitzt mit Mr. Stuart an einem schwierigen Fall, aber er ist abgelenkt und hört nicht zu. Er denkt an Miss Owens, bereut seinen Brief und fühlt sich verlassen. Wie ein armer Geist unter einem Stein fühlt er sich, ohne Hoffnung, jemals wieder geliebt zu werden.
»Mr. Lincoln, hören Sie mir überhaupt zu?«
»Entschuldigung. Die Auflösung meiner Verlobung nimmt mich etwas mit.« Auflösung, denkt er, was für ein passendes Wort. Er löst sich gerade auf wie Zucker in einem Glas Wasser.
»Aber Sie wollten diese Frau doch gar nicht heiraten.«
»Es ist dumm, ich weiß. Möglicherweise war ich doch ein wenig in sie verliebt.«
Nein, das stimmt nicht. In Wahrheit sehnt er sich einfach nach einem liebevollen Brief. Auf seinen letzten hat Miss Owens nicht geantwortet, was er ihr nicht verdenken kann. Stattdessen kam ein Telegramm ihres Vaters, darin das böse Wort »Auflösung«.
»Sie sind wirklich komisch.« Der kleine Mr. Stuart schüttelt den Kopf und beugt sich über eine Akte.
Lincoln fröstelt, seine Kleidung ist klamm. Der Regen macht die Brandmauer vor dem Fenster noch schwärzer als sonst. Vor dem Regen gibt es sogar im Büro kein Entkommen, denn Wasser dringt durch ein Loch im Dach und durch die Zimmerdecke, an der sich eine schwere, dunkle Beule gebildet hat. Lincoln hat einen Eimer darunter gestellt, aber das metallene Klacken, das entsteht, wenn ein Tropfen in den Eimer fällt, geht ihm auf die Nerven.
»Wenn wir uns gestritten hätten, wäre es etwas anderes«, jammert er. »Mein Brief war zweideutig, das gebe ich zu. Aber gar nicht darauf zu antworten? Das gibt mir das Gefühl, sie hätte schon vorher an mir gezweifelt.«
Er blickt zum Fenster. Manchmal hat er den Impuls, Anlauf zu nehmen und durch die Scheibe zu springen. Er würde gegen die Brandmauer klatschen, dann zwei Meter in die Tiefe fallen. Tot wäre er dann bestimmt noch nicht. Oder? Er zweifelt einfach zu schnell an allem.
Um sich zu beruhigen, schreibt er Briefe, den ersten an seine Stiefmutter, darin lobt er seine Unterkunft und die Kanzlei in höchsten Tönen. Obwohl sie ihn mit Robinson Crusoe und den Geschichten aus Tausendundeiner Nacht bekannt gemacht hat, kann sie nur schlecht lesen und nicht schreiben. Wenn er ein wenig Geld übrighätte, würde er es nach Hause schicken. Der zweite Brief geht an Ralph Waldo Emerson, der einmal einen Vortrag in Springfield gehalten hat. Die halbe Stadt war dagewesen und hat sein Buch Natur gekauft. Auch Lincoln hat es gelesen, ohne besondere Begeisterung. Er ist in der Natur aufgewachsen, er sieht keinen Sinn darin, sie zu verklären. In dem Brief spricht er Fragen der Verfassung und das Problem der Sklaverei an, und er hofft, in einen intellektuellen Austausch mit dem Philosophen zu treten.
Da klackt es wieder metallisch, und Lincoln sieht zum Eimer hinüber. »Wie soll man sich bei diesem Lärm konzentrieren?«
Mr. Stuart scheint das nicht zu stören, aber er sagt trotzdem, dass er sich darum kümmert. »Sie können ruhig nach Hause gehen. Wir machen morgen weiter, Mr. Lincoln.«
Er steht auf, sagt etwas Versöhnliches zu Stuart und zieht seinen Mantel an. Er muss aufpassen, es sich nicht mit ihm zu verscherzen. Zum Abschied versucht er zu lächeln, was ihm nur halb gelingt. Er bräuchte ein dauerhaftes, stabiles Lächeln, das er zwischen sich und die Welt stellen kann.
Er geht den kürzesten Weg nach Hause, betritt die Kammer, wo es feucht und muffig wie in einer Bärenhöhle riecht. Eine Frau, die er nicht kennt, zieht gerade ihre Strumpfbänder fest, sie ignoriert ihn. Joshua begrüßt ihn und schlüpft hüpfend in seine Unterhose. Er hat den gedrungenen, muskulösen Körper eines Boxers. »Abe, du kommst früh heute.«
»Mr. Stuart hat mich nach Hause geschickt, mir geht’s nicht gut.«
Als die Frau gegangen ist, öffnet Lincoln das Fenster. Draußen hat der Regen nachgelassen. Ein Hund bellt, und ein Schuhputzer packt auf der zerwühlten Straße sein Handwerkszeug aus.
»Lass dich von der Lady in Kentucky nicht runterziehen«, sagt Joshua.
»Du hast ständig neue Freundinnen.«
»Wenn es das ist, geh ins Bordell!«
»Das ist es nicht. Außerdem weiß ich nicht, ob ich das könnte.«
Er lässt sich aufs Bett sinken, fühlt sich müde. Es ist eine Schlaffheit, wie er sie von manchen Sonntagen aus seiner Kindheit kennt. »Wie heißt die Frau von eben?«
»Clarissa. Gefällt sie dir?«
Joshua lässt sich aufs Bett fallen, Lincoln wird kurz angehoben. Nachts liegt er oft wach, während der Gemischtwarenhändler neben ihm immer gut schläft.
»Ich mach’ mir Sorgen um dich.« Joshuas Bein und ein Arm ragen auf Lincolns Bettseite hinüber. Ein Geruch nach Kümmel und frischem Schweiß, vielleicht nach Sex, weht zu ihm herüber.
Joshua ist nicht der Mensch, mit dem er gut reden kann. Sie sind sehr verschieden. »Ich brauche eine feste Bindung, um den Alltag zu bewältigen. Und wenn es nur eine Brieffreundin ist.«
Joshua stützt seinen Kopf auf den Unterarm, sieht zu ihm herüber und betrachtet ihn wie eine seltene Fledermausart. »Wollen wir ringen? Hab’ gehört, du bist ein guter Ringer.«
Lincoln seufzt. Er gibt sich einen Ruck und springt aus dem Bett. »Du hast recht.«
Er versucht, seine Müdigkeit abzuschütteln, bindet sich seine Fliege um und nimmt seinen Hut vom Haken. »Ich werde es tun. Einfach, um es gemacht zu haben.«
»Was?«
»Das Bordell.«
Ein wenig Streicheln, eine Umarmung, mehr verlangt er nicht. Aber schon draußen auf der Straße kommen ihm Zweifel. Was, wenn er sich lächerlich macht oder ein Parteifreund ihn sieht? Oder wenn er sich die Syphilis holt.
Seine Schritte schmatzen im Schlamm, funzliges Licht brennt hinter niedrigen Fenstern. Der Schuhputzer und andere Passanten folgen ihm mit ihren Blicken, als wüssten sie, wohin er geht.
Drei Mädchen sind gerade frei. Die plüschige Atmosphäre und die roten Samtvorhänge im Empfangszimmer erinnern ihn an Weihnachten. Er wählt Crystal, die sich vor ihm um die eigene Achse dreht. Allerdings ist im schummrigen Licht nicht allzu viel zu erkennen.
Sie nimmt seine Hand, führt ihn in ein freies Zimmer, und wahrscheinlich sieht sie ihm an, dass er unerfahren ist. Völlig unerfahren. Sie schließt die Tür und zupft die Träger von ihren knöchrigen Schultern, ihr Kleid fällt wie ein nasser Lappen, entblößt ein kleines Bäuchlein und rotes Schamhaar. »Voilà!«
Als sie ihn küssen möchte, riecht er ihren Schnapsatem. Ist sie betrunken? Er weicht aus, aber das ist nichts, was Crystal nicht schon hundertmal erlebt hätte und persönlich nehmen würde.
»Dann begebe ich mich mal südwärts«, flüstert sie, und er wundert sich, dass sie noch nicht über die Bezahlung gesprochen haben.
Crystal knöpft seine Hose auf, greift hinein und blickt ein wenig enttäuscht zu ihm hoch. »Gefalle ich dir nicht?«
»Ich war abgelenkt.«
»Du gehörst zu den Schüchternen, hm?«
»Was kostet …«
»Ich hauche ihm Leben ein, ja?« Sie gluckst bei vollem Mund, er streicht ihr übers Haar und fragt sich, welche Krankheiten sie hat. Waren ihre Zähne faulig?
»Was kostet das eigentlich?«
»Sechs Dollar.«
Sein Bauch und sein Becken verkrampfen. »Ich hab’ nur vier.«
Crystal blickt zu ihm auf. »Macht nichts. Willst du nicht deinen Hut abnehmen?«
Er stößt sie weg, so derb, dass sie nach hinten kippt. Obwohl er sich sofort entschuldigt, springt Crystal davon und versteckt sich hinter einer spanischen Wand, unter der ihre nackten Füße hervorschauen.
Er zieht seine Hose hoch. »Tut mir leid, Madam, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich kann mir das einfach nicht leisten.«
»Das fällt dir jetzt ein?« Sie ruft um Hilfe, und es ist nur eine Frage von Sekunden, bis der Rausschmeißer kommt.
Lincoln stürzt aus dem Zimmer, springt die Treppenstufen hinunter und in den Matsch hinaus. Auf der Straße rennt er weiter, mit einer Hand seinen Hut festhaltend, bis er nicht mehr kann.
Am Unabhängigkeitstag nimmt Joshua ihn auf ein Fest der Demokraten mit. Er fühlt sich deplatziert, im Gegensatz zu Joshua, der Politik gern mit den verschiedenen Angelhaken in seinem Laden vergleicht. »Einige sind für Karpfen, andere für Forellen geeignet. Ich verkaufe sie alle.«
»Zum Glück denkt nicht jeder wie du.«
»Diese Nacht werde ich nicht in unserer Kammer schlafen.« Joshuas Augenbrauen tanzen anspielungsreich, er wirft eine Weintraube in die Luft und fängt sie mit dem Mund auf. Als Joshua die nächste Weintraube in die Luft wirft, schnappt Lincoln sie ihm weg. »Benimm dich.«
»Entspann dich, Abe!«
Eigentlich ist er nur mitgekommen, weil Mary Todd, die Tochter eines Bankiers aus Lexington, hier sein soll. Sie ist kürzlich nach Springfield gezogen, wo sie bei ihrer Schwester und deren Ehemann Ninian Edwards wohnt. Seit Mary Todds Ankunft kennen Springfields Junggesellen nur ein Thema.
»Viel Glück bei Miss Todd«, flüstert Joshua und geht einer jungen Frau hinterher.
Allein am Buffet fühlt sich Lincoln zu keiner spontanen Regung fähig. Sogar die Länge seiner Atemzüge misst er ab, nur um nicht aufzufallen. Er nimmt ein gebratenes Täubchen und reißt mit den Zähnen ein Stück Brustfleisch heraus, das ihm wie feuchte Wolle im Mund liegt. Der Ballsaal ist mit rot-blauen Girlanden geschmückt, auf einer Bühne spielt ein kleines Orchester. Und davor tanzt Miss Todd mit einem älteren Mann.
Tagsüber gab es einen Umzug der Veteranen aus den Unabhängigkeitskriegen, da ist ihm Mary schon einmal begegnet. Sie stand am Straßenrand mit einem Sonnenschirm in der Hand, und er wollte sich ihr vorstellen, hat sich durch die Reihen der Veteranen geschoben, aber als er auf der anderen Straßenseite ankam, war sie verschwunden.
Ein Zwinkern von ihr würde ihm Mut machen, aber sie konzentriert sich ganz auf ihren Tanzpartner, den demokratischen Abgeordneten Mr. Johnson. Sie tanzt wie ein Wirbelwind, die Luft um sie herum dreht sich und zieht Menschen und Dinge in ihren Sog. Lincoln bewegt sich zu ihr, ohne dass er es beschlossen hätte. Er stößt gegen Schultern und entschuldigt sich, jemand spricht ihn von der Seite mit schriller Stimme an. »Guten Abend Mr. Lincoln! Sie hätte ich hier am Wenigsten erwartet!«
Unwillig wendet er sich James Shields, Illinois’ neuem Schatzmeister, zu, gibt ihm die Hand und verliert Mary aus den Augen. »Guten Abend, Mr. Shields.«
»Ich muss schon sagen, ihr Whigs habt uns ein schlimmes Chaos hinterlassen!«
Lincoln nickt, ohne zuzuhören. Er spürt, wie sich im Planetensystem des Ballsaals etwas verändert, wie er – ja, er! – ins Zentrum rückt, weil Miss Todd ihn auf einer immer kleiner werdenden Umlaufbahn umtanzt. Lincoln folgt ihr mit seinem Blick, verdreht sich fast den Hals, und sie lächelt ihm tatsächlich zu, ein Spiel, das Mr. Shields verdrießt. Nach zwei Umrundungen lässt Mary Todd ihren Tanzpartner los und fängt Lincoln ab, umarmt ihn und flüstert: »Partnertausch.«
»Ich bin ein schlechter Tänzer.«
»Entspannen Sie Ihre Schultern und fragen Sie sich, wo sich Ihre Mitte befindet.«
»Meine Mitte?«
»Wie kann man so formlos leben! Wir lassen es einfach so aussehen, als ob Sie führen.«
»Sie haben Mr. Johnson einfach stehenlassen, das war nicht nett.« Sein Rachen kratzt. Wenn er jetzt hustet, stößt er sie von sich fort und alles ist zerstört. Deshalb lässt er seinen Atem flach werden, bis ihm schwindlig wird.
»Ich finde Mr. Johnsons politische Ansichten langweilig.«
»Ich bin übrigens …«
»Ich weiß wer Sie sind, Mr. Lincoln. Sie arbeiten in der Kanzlei meines Cousins John Stuart, Sie sind ein Whig und Sie vertreten politische Ansichten, die ich mag. Sie haben für das Infrastrukturgesetz gestimmt, nicht wahr? Besonders für den Ausbau der Wasserwege, denn da kennen Sie sich aus, seit Sie Baumstämme über den Mississippi transportiert haben.«
Er ist verblüfft. »Das stimmt.« Aber weiß sie auch von der missglückten Verlobung mit Miss Owens?
»Sie sind eigentlich nicht so formlos, wie ich dachte. Sie brauchen bloß einen passenden Rahmen.«
Er spürt ihre zierlichen Arme auf seinen Schultern, die Wärme, die von ihrem Kopf neben ihm ausgeht. Um sie herum dreht sich die Welt schneller, zieht sich zu Fäden auseinander, schmilzt.
»Mein Schwager, Ninian Edwards, empfängt immer dienstags zu einer politischen Runde. Er würde sich bestimmt freuen, wenn Sie kämen.«
»Wirklich?«
Da endet das Lied und Miss Todd löst sich von ihm. Sie macht einen Knicks und kehrt ihm den Rücken zu. Er blickt ihr nach, euphorisiert, aber auch ein wenig wehmütig.
Als ihm Ninian Edwards am Dienstag die Haustür öffnet, scheint niemand mit ihm gerechnet zu haben. Hat Mary ihn nicht angekündigt? Kurz wirkt Mr. Edwards brüskiert, aber er ist zu höflich, den Armenanwalt abzuweisen. Er führt Lincoln in den Salon, wo bereits ein paar Gäste sitzen, und platziert ihn neben den Kamin, am äußersten Rand der Runde. Auch Mr. Johnson ist da, er scheint ihm den gestohlenen Tanz noch zu verübeln. Lincoln rutscht unsicher auf seinem Stuhl hin und her, fragt sich, ob es ein gemeinsames Essen mit den Damen des Hauses geben wird. Eigentlich ist er nur wegen Mary hier.
Ninian bietet seinen Gästen Zigarren an, bevor er sich selbst in einen Sessel sinken lässt. Er resümiert die aktuellen politischen Kämpfe und streicht sich beim Reden über seinen Bart. »Die Verfassung garantiert die Eigentumsrechte der Individuen, also auch der Sklavenbesitzer. Niemand darf in diesem Land enteignet werden.«
»Auch Sklaven sind Individuen«, wirft Lincoln ein. Alle Köpfe wenden sich zu ihm. Offenbar ist man überrascht, dass er es wagt, sofort zu widersprechen. »Und man enteignet sie andauernd, nämlich von ihrer Freiheit.«
»Ach, seien Sie doch still«, ruft Mr. Johnson. »Sie haben mit Ihrem Infrastrukturgesetz wenig Weitsichtigkeit bewiesen! Der arme Mr. Shields muss jetzt das Haushaltsloch stopfen, das Sie geschaffen haben.«
»Bestimmt geht auch Mr. Shields lieber auf gepflasterten Straßen als im Schlamm, und bestimmt zieht er ein funktionierendes Abwassersystem dem Gestank vor.«
»Woher wollen Sie das wissen? Die Menschen sind verschieden.«
»Die Menschen leben zusammen, bilden Gesellschaften, Mr. Johnson! Wir müssen schon ein wenig Geld in diesen amerikanischen Boden stecken, wenn diese junge Nation von Dauer sein soll.«
Die anderen Gäste widersprechen, fallen sich gegenseitig ins Wort und verschaffen Lincoln dadurch eine Verschnaufpause. Eigentlich möchte er sich in Marys Haus gar nicht streiten. Warum hat sie ihn überhaupt in dieses Fegefeuer gelockt? Um ihn zu testen?
Derweil redet sich Mr. Johnson in Rage. »In diesem Staat genügt es, unverschämt zu sein, um sich den Ruf eines Reformers zu verleihen! Jeder Bauer darf hier Politik betreiben!«
Als Lincoln beginnt, erst den einen Hemdärmel aufzuknöpfen, dann den anderen, verstummt Mr. Johnson. Nicht, dass Lincoln ein Raufbold ist, aber wer zwischen Bauernjungen aufwächst, weiß um die Wirkung solcher Signale.
»Gentlemen, wir wollen nicht persönlich werden.« Ninian reicht seinen Gästen Cognacgläser, und Lincoln beschließt, kein Wort mehr über Politik zu verlieren.
Er wird still, die gewohnte Schwermut überflutet ihn. Er raucht eine Zigarre nach der anderen, bis ihm übel wird. Er hatte wirklich gehofft, Mary zu treffen, und natürlich traut er sich nicht, Ninian nach ihr zu fragen. Da er nah am Feuer sitzt, schwitzt er stärker als die anderen. Hält man ihn für betrunken? Was für ein vergeudeter Abend.
Er beschließt zu gehen, lässt sich Hut und Mantel bringen, verabschiedet sich mit einem Murmeln und trottet über den Kiesweg, als Mary hinter einem Fliederstrauch hervortritt. Sie ist blass im Gesicht und trägt nur einen Schlafrock über ihrem Nachthemd. Ihre Augen wirken wund. Hat sie geweint? Hat sie sich wegen ihm gestritten?
»Ich muss mich entschuldigen, weil ich Sie hierhergelockt habe. War es sehr schlimm?«
»Nicht sehr.«
»Ich habe gelauscht und möchte Ihnen sagen, dass ich Ihre Widerworte wichtig fand. Sie hätten auch einfach schweigen können, um keinen Ärger zu provozieren.«
»So bin ich nicht.«
»Das beruhigt mich. Vermutlich wollen Sie nächsten Dienstag trotzdem nicht wiederkommen?«
»Eher nicht.« Er hört die Frösche vom Fluss her quaken und riecht den Flieder. Oder ist es Mary, die so duftet? »Aber morgen werde ich den ganzen Tag in der Kanzlei sein. Vielleicht möchten Sie Ihrem Cousin ja einen Besuch abstatten.«
Sie nickt und zieht sich den Schafrock bis zum Hals, als spüre sie erst jetzt die Kälte.
Am Morgen geht er zum Barbier, lässt sich rasieren und die Haare schneiden, sogar einem Spritzer Parfüm ist er nicht abgeneigt. Später in der Kanzlei wartet er ungeduldig auf Miss Todds Besuch.
Vormittags ist er noch gut gelaunt, kippelt auf seinem Stuhl und plaudert mit den Klienten. Aber als sie am Nachmittag immer noch nicht gekommen ist, wird er ungehalten und beschimpft einen Dieb, weil er sich nicht an das Gesetz gehalten hat. Worauf, wenn nicht auf Gesetze, soll sich eine Gesellschaft denn sonst verlassen? Er empfiehlt dem Mann, sich einen anderen Anwalt zu suchen – was ihm einen vorwurfsvollen Blick von Mr. Stuart einbringt.
Er sucht nach Ähnlichkeiten zwischen Mr. Stuart und Mary, immerhin sind die beiden verwandt. Der breite Mund vielleicht?
Mr. Stuart kommt zu ihm an den Tisch. »Mr. Lincoln, geht es Ihnen wieder schlecht? Wollen Sie vielleicht nach Hause gehen?«
Er schüttelt den Kopf. Allmählich glaubt er, dass Stuart lieber ohne ihn arbeitet. Zweifel steigen in ihm auf, Zweifel an Marys Verlässlichkeit und an seiner Fähigkeit, menschliche Absichten zu erkennen. Hat er sich das, was zwischen ihm und ihr passiert ist, nur eingebildet? Er wäscht sich am Waschbecken die Pomade aus dem Haar und bereut die zwanzig Cent, die der Barbier gekostet hat.
Er geht im Büro auf und ab, setzt sich kurz hin, nur um fünf Minuten später wieder aufzuspringen. Am Abend, kurz vor Schließung der Kanzlei, stößt er gegen den Eimer mit dem Tropfwasser und wirft ihn um.
»Mr. Lincoln, passen Sie doch auf!« Mr. Stuart holt einen Lappen, während Lincoln auf seinen Stuhl sinkt, den Kopf wie ein störrisches Kind auf beide Fäuste gestützt. Alles ist Betrug! Auf niemanden kann er sich verlassen! Das muss er doch inzwischen wissen. Jeder denkt nur an sich.
Sein Blick verschwimmt, aber dann dringen plötzlich Stimmen zu ihm wie durch Nebel. Er spürt eine Hand auf seiner Schulter und sieht auf. Es ist Mary.
»Mr. Lincoln, wie schön, Sie hier zu treffen!«
»Ja, ich bin … oft hier«, stottert er. Mary nickt, als ergäbe das, was er sagt, irgendeinen Sinn.
»Eigentlich wollte ich nur bei meinem Cousin vorbeischauen. Ich komme selten hierher und ich muss sagen, das Büro ist in einem liederlichen Zustand.«
Sie fährt mit einem Finger über ein Regal und schüttelt tadelnd den Kopf. »Gibt es noch dieses Loch? Ah ja, da ist es!« Die Hände gegen die Hüften gestemmt, blickt sie zur Decke hinauf.
Mr. Stuart, von der Situation nicht weniger überfordert als Lincoln, tänzelt um sie herum, fragt, was er für sie tun kann und ob sie länger zu bleiben gedenke.
Endlich rafft Lincoln sich auf. »Miss Todd, es wäre mir eine Freude, Sie nach Hause zu begleiten.«
»Eine gute Idee«, sagt Mr. Stuart und schiebt die beiden zur Tür. »Eine junge Dame sollte im Dunkeln nicht allein sein.«
Mary kichert über diese ungeschickte Bemerkung und Lincoln wird rot. Sie gehen auf die Straße hinaus, wo ein Coupé mit Kutscher wartet. Als Mary seinen überraschten Blick bemerkt, lacht sie auf, ein Lachen wie ein Regen aus Mohnblüten, der weich auf Lincoln niederfällt. Er ist wie benommen. Er reicht ihr seine Hand, hilft ihr in die Kutsche und steigt dann selbst ein.
»Was für ein schöner Abend, Mr. Lincoln.«
Mehr, als ihr zuzustimmen, fällt ihm nicht ein. Er überlegt sich einen Rahmen, eine Veranstaltung, auf deren Bühne er spricht, und bald kommen ihm die Wörter wie von selbst. »Ihr Auftritt in der Kanzlei war äußerst souverän.«
»Meinen Sie, mein Cousin hat mir den Zufallsbesuch abgekauft?«
»Bestimmt.«
Er weiß nicht, wohin sie fahren. Sie haben die Stadt verlassen, in der Dämmerung leuchtet der Himmel violett, die Wolken hängen flach über der Prärie. Mary sitzt neben ihm, blickt aus dem Fenster und erlaubt ihm, sie von der Seite zu betrachten. Ihre Ohren sind klein und haben einen sanften Flaum. Er will ihr Haar küssen, ihre Schläfe, den sanften Schwung ihrer Wange, ihren Mundwinkel, wo er auch einen kleinen Flaum entdeckt. Aber ihm fällt kein Rahmen ein, der ihm dabei helfen könnte. Stattdessen fragt er sie, ob sie sich inzwischen eingelebt hat.
»Springfield ist eine Provinzstadt, schmutzig und stupide. Mein Schwager gestattet mir nur wenige Freiheiten und meine Schwester betet von morgens bis abends. Ich dagegen möchte politisch aktiv sein.«
»Sie sollten Artikel für die Zeitung schreiben!«
»Glauben Sie, ich könnte das?«
»Wir könnten zusammen einen bissigen Leserbrief für das Sangamo Journal verfassen, natürlich unter Pseudonym.« Er kann sich das nicht wirklich vorstellen, es sollte bloß ein Kompliment sein, aber als Mary ihn anstrahlt, weiß er, dass sie es versuchen sollten. »Als Pseudonym schlage ich Uranius Squatpump vor.«
»Zu düster. Wie wär’s mit Rebecca Kissfellow?« Sie sieht ihm in die Augen. Jetzt könnte er sie wirklich küssen, ganz von sich aus, weil er und sie es beide wollen. Aber da hält die Kutsche.
Sie sind einen großen Umweg gefahren, um schließlich vor Ninian Edwards Haus anzukommen. Als der Kutscher die Wagentür öffnet, zögert Mary. Sie legt ihre Hand auf seine, drückt kurz zu. »Der Kutscher fährt Sie nach Hause.« Dann springt sie hinaus und geht zügig, mit gerafftem Rock, zum Haus ihres Schwagers.
Lincoln lehnt sich zurück und schließt seine Augen, kneift sie zusammen, als ob er in etwas Bitteres beißt. Er hat es nicht geschafft, sie zu küssen.