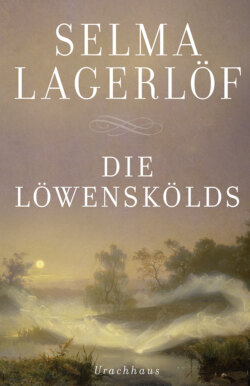Читать книгу Die Löwenskölds - Selma Lagerlöf - Страница 11
Achtes Kapitel
ОглавлениеEs mochten wohl dreißig Jahre seit jenem merkwürdigen Würfelspiel vor dem Brobyer Thinghaus vergangen sein, da saß an einem Herbsttag Marit Erikstochter auf der kleinen Vortreppe zum Vorratshaus des Olsbyer Hofes, wo sie ihre Wohnung hatte, und strickte Kinderfäustlinge. Sie wollte ein schönes Muster mit Streifen und Vierecken stricken, damit das Kind, dem die Handschuhe zugedacht waren, eine rechte Freude daran habe; aber sie konnte sich an kein bestimmtes Muster mehr erinnern.
Nachdem sie lange nachgedacht und mit einer Stricknadel Figuren auf die eine Stufe der Treppe gezeichnet hatte, ging sie ins Haus hinein und öffnete ihre Kleidertruhe, um irgendein Stück hervorzusuchen, nach dem sie stricken könnte. Schließlich fand sie ganz unten in der Truhe eine Zipfelmütze, die mit vielen verschiedenen Feldern und Streifen kunstfertig gestrickt war, und nach einigen Augenblicken des Zögerns nahm sie die Mütze mit hinaus auf die Vortreppe.
Während dann Marit die Mütze hin und her betrachtete, um sich über das Strickmuster klar zu werden, sah sie, wie viele Löcher die Motten hineingefressen hatten. »Ach, du lieber Gott, das ist wohl nicht verwunderlich!«, dachte sie. »Es ist ja mindestens dreißig Jahre her, seit diese Mütze im täglichen Gebrauch war. Es ist gut, dass ich sie jetzt einmal aus der Kleidertruhe herausgenommen habe und nun sehe, wie es darin aussieht.« Die Mütze war mit einer großen schönen bunten Troddel versehen, und in dieser schienen die Motten hauptsächlich gehaust zu haben, denn als Marit die Mütze schüttelte, flogen die Fäden wirbelnd nach allen Seiten hin. Ja, auch die Troddel selbst machte sich los und fiel ihr in den Schoß. Marit nahm sie auf, um zu sehen, ob sie so zerstört war, dass man sie nicht mehr befestigen konnte, und dabei sah sie etwas zwischen den Fäden glänzen. Sie zupfte sie eifrig auseinander, und was fand sie da: einen großen goldenen Siegelring mit einem roten Stein darauf, der mit grobem Leinenfaden in die Troddel hineingenäht war.
Die Troddel und die Mütze fielen ihr aus der Hand. Sie hatte den Ring noch nie gesehen; aber sie brauchte gar nicht den königlichen Namenszug anzusehen, noch die Inschrift auf der Innenseite des Ringes zu lesen, um zu wissen, was für ein Ring das war und wem er gehörte. Sie lehnte sich gegen das Geländer zurück, schloss die Augen und saß regungslos da, still und bleich wie eine Sterbende. Ihr war, als müsste ihr das Herz brechen.
Dieses Ringes wegen hatten ihr Vater, Erik Ivarsson, ihr Onkel, Ivar Ivarsson, und ihr Bräutigam Paul Eliasson den Tod erleiden müssen. Und jetzt hatte sie diesen Ring, in die Troddel von Paul Eliassons Zipfelmütze eingenäht, gefunden.
Wie war er da hineingekommen? Wann war er da hineingekommen? Hatte Paul gewusst, dass er sich da befand?
Nein, sie sagte sich sofort, es sei ganz unmöglich, dass er es gewusst haben könnte.
Sie erinnerte sich, wie er die Mütze geschwenkt und sie hoch in die Luft hinaufgeworfen hatte, als er glaubte, sowohl er als auch die beiden alten Ivarssöhne seien freigesprochen.
Sie sah das Ganze vor sich, als sei es gestern gewesen. Die große Volksmenge, die im Anfang hasserfüllt und feindlich gegen sie und ihre Nächsten gewesen war, schließlich aber doch an deren Unschuld geglaubt hatte. Sie erinnerte sich auch an den prachtvollen tiefblauen Herbsthimmel sowie an die Zugvögel, die wild und irrend über dem Thingplatz hin und her geschwirrt waren. Paul hatte nach ihnen geschaut, und in dem Augenblick, da sie sich an ihn lehnte, hatte er ihr zugeflüstert, seine Seele würde nun auch bald da oben umherirren wie ein kleiner verirrter Vogel. Und er hatte sie gefragt, ob er herkommen und unter der Dachrinne des Olsbyhofes sein Nest bauen dürfe?
Nein, Paul Eliasson hatte nicht wissen können, dass in der Mütze, die er zum herrlichen Herbsthimmel emporwarf, Diebesgut verborgen gewesen war.
Ein anderer Tag kam heran. Ihr Herz krampfte sich jedes Mal zusammen, sooft sie an ihn dachte; aber jetzt musste sie es doch tun. Von Stockholm war die Entscheidung gekommen, das Gottesurteil müsse so gedeutet werden, dass alle drei Angeklagten gleich schuldig seien und alle drei durch den Strick hingerichtet werden sollten.
Sie, Marit, war anwesend gewesen, als das Urteil vollstreckt wurde, damit die Männer, die sie liebte, wussten, dass es noch einen Menschen gab, der an sie glaubte und um sie trauerte. Aber deswegen hätte sie kaum zum Galgenhügel zu gehen brauchen, denn alle Leute waren seit dem letzten Male anderen Sinnes geworden. Alle, die vor der Sperrkette der Soldaten um sie her standen, waren sehr gut gegen sie gewesen. Die Leute hatten die Sache unter sich beraten und waren zu der Überzeugung gekommen, das Gottesurteil hätte so gedeutet werden müssen, dass alle drei Angeklagten unschuldig wären. Der alte General hatte sie alle den höchsten Wurf tun lassen. Das konnte nichts anderes bedeuten, keiner von den dreien habe den Ring genommen.
Als die drei Männer herausgeführt wurden, war ringsum lautes Wehklagen entstanden. Die Frauen hatten geweint, die Männer hatten mit geballten Fäusten und zusammengebissenen Zähnen dagestanden. Man sagte, das Kirchspiel Bro werde zerstört werden wie einst Jerusalem, weil unschuldigen Männern hier das Leben genommen werde. Die Leute hatten den Verurteilten Trostworte zugerufen und die Büttel verhöhnt. Und viele Flüche hatten den Rittmeister getroffen. Es hieß ja, er sei in Stockholm gewesen, und er sei schuld daran, dass dieses Gottesurteil zum Nachteil der Angeklagten gedeutet worden sei.
Und diese allgemeine Teilnahme, die bewies, dass alle Leute ihr Vertrauen und ihren Glauben teilten, war es jedenfalls gewesen, die ihr über jenen Tag hinweggeholfen hatte. Und nicht nur über jenen Tag allein, sondern auch die ganze Zeit her bis jetzt. Wenn die Menschen, mit denen sie zusammentraf, sie für die Tochter eines Mörders gehalten hätten, ach, dann hätte sie das Leben nicht ertragen können.
Paul Eliasson war der Erste gewesen, der den kleinen Bretterboden unter dem Galgen betreten hatte. Er hatte sich erst auf die Knie geworfen und zu Gott gebetet, dann hatte er sich an den neben ihm stehenden Geistlichen gewendet und eine Bitte an ihn gerichtet.
Dann hatte Marit gesehen, wie der Geistliche ihm die Mütze vom Kopf nahm, und als alles vorüber war, hatte er Marit die Mütze als letzten Gruß von Paul übergeben und dabei gesagt, Paul sende sie ihr als Zeichen, dass er in seinem letzten Stündchen an sie gedacht habe.
Sollte sie nun jemals glauben können, Paul hätte ihr die Mütze zum Andenken geschickt, wenn er gewusst hätte, dass gestohlenes Gut sich darin befände? Woher konnte nur Paul diese Mütze gehabt haben? Nein, wenn irgendetwas auf Erden gewiss war, dann auch das, dass er nicht gewusst, was in der Mütze verborgen war, nämlich der Ring, der am Finger eines toten Mannes gesteckt hatte.
Marit Erikstochter beugte sich hastig vor, sah die Mütze genau an und betrachtete eifrig das Muster. »Woher kann Paul die Mütze gehabt haben?«, dachte sie. »Paul liebte solchen Putz sehr. Er freute sich nie, wenn wir graue Kleider für ihn webten. Er wollte immer Farben hineingewoben haben. Und seine Mützen sollten womöglich rot sein, mit einer großen Troddel daran. Diese hier hat ihm sicherlich gut gefallen.«
Sie legte die Mütze nieder, lehnte sich an das Treppengeländer zurück und schaute hinein in das Vergangene. An jenem Morgen, als Ingilbert zu Tode erschreckt worden war, hatte sie sich auch im Wald befunden. Sie sah, wie Paul zusammen mit ihrem Vater und ihrem Oheim über die Leiche gebückt stand. Dann hatten die beiden Alten bestimmt, Ingilbert solle ins Dorf hinunter getragen werden, und sie waren zwischen die Bäume gegangen, um Zweige für die Bahre abzuhauen. Paul hatte einen Augenblick gezögert, um Ingilberts Mütze näher zu betrachten. Sie stach ihm so in die Augen, weil sie mit blauem, rotem und weißem Garn in den verschiedensten Mustern gestrickt war, und da hatte er dem Verlangen nicht widerstehen können. Er hatte nichts Böses damit gemeint, hatte sie vielleicht nur für ein Weilchen behalten wollen. Seine eigene Mütze, die er Ingilbert hinlegte, war sicher ebenso gut gewesen, nur nicht so vielfarbig und nicht so kunstfertig gestrickt.
Ingilbert aber hatte den Ring in die Mütze hineingenäht, ehe er von daheim fortging. Er hatte vielleicht gedacht, er könne verfolgt werden, und deshalb den Ring recht gut zu verstecken gesucht. Und als er dann zu Boden gestürzt war, wie sollte da jemand auf den Gedanken kommen, den Ring in der Mütze zu suchen! Paul Eliasson weniger als irgendein anderer.
So musste also alles zugegangen sein. Marit hätte darauf schwören können; man kann aber doch seiner Sache nie sicher genug sein.
Sie legte nun den Ring in die Truhe, und mit der Mütze in der Hand ging sie in den Stall, um mit der Stallmagd zu reden. »Komm heraus ans Tageslicht, Märta!«, rief sie in den dunklen Viehstall hinein, »und hilf mir bei einem Muster, das ich nicht herausbringen kann.«
Als die Stallmagd sich zeigte, reichte sie ihr die Mütze. »Ich weiß, du bist recht geschickt im Stricken, Märta«, begann sie, »und ich möchte gern diese Felder abstricken, komme aber nicht ganz zurecht damit. Du bist in dieser Kunst besser bewandert als ich.«
Die Stallmagd nahm die Mütze und warf einen Blick darauf; dann sah sie ganz betroffen aus. Sie trat aus dem Schatten der Stallmauer heraus und betrachtete die Mütze noch genauer.
»Woher hast du sie?«, fragte sie Marit.
»Sie hat seit vielen Jahren in meiner Truhe gelegen«, antwortete Marit. »Warum fragst du danach?«
»Weil ich diese Mütze meinem Bruder Ingilbert im letzten Sommer, wo er lebte, gestrickt habe«, sagte die Stallmagd. »Ich habe sie seit jenem Morgen, wo er von zu Hause wegging, nicht mehr gesehen«, fuhr sie fort. »Wie kann sie denn jetzt hier sein?«
»Sie ist ihm vielleicht vom Kopf gefallen, als er von den Knechten im Wald gefunden und hierher gebracht wurde. Wenn aber so traurige Erinnerungen für dich damit verknüpft sind, wirst du vielleicht das Muster nicht gern für mich abstricken.«
»Wenn du sie mir eine Weile überlässt, kannst du das Muster haben«, versetzte die Stallmagd.
Sie nahm die Mütze und ging in den Stall zurück; aber Marit hörte, dass ihre Stimme von Tränen verschleiert war.
»Nein, du darfst es nicht tun, wenn es dir schmerzlich ist«, sagte sie.
»Nichts ist mir schmerzlich, was ich für dich tun kann, Marit.«
Marit war es nämlich gewesen, die an Märta Bårdstochter gedacht hatte, als diese nach dem Tod ihres Vaters und Bruders ganz allein droben im Wald zurückgeblieben war, und so hatte sie ihr angeboten, Stallmagd auf dem Olsbyhof zu werden. Märta vergaß ihr das nie und wurde nicht müde, ihr ihre Dankbarkeit zu bezeugen, weil Marit sie dadurch wieder mit anderen Menschen zusammengebracht hatte.
Marit kehrte auf die Treppe des Vorratshauses zurück. Sie nahm ihr Strickzeug wieder in die Hand, hatte aber keine rechte Ruhe zum Arbeiten. Sie lehnte den Kopf wie vorher an das Geländer und überlegte, was sie nun tun müsse.
Wenn jemand im Olsbyhof gewusst hätte, wie Frauen auszusehen pflegten, die das Leben hinter sich gelassen hatten, um ins Kloster zu gehen, hätte man wohl gesagt, Marit sehe jetzt einer solchen gleich. Ihr Gesicht war gelblich weiß und ganz ohne Runzeln. Einem Fremden wäre es fast unmöglich gewesen, zu sagen, ob sie jung oder alt sei. Es lag etwas Friedfertiges und Ruhiges über ihr, wie über jemand, der aufgehört hat, für sich selbst etwas zu wünschen. Man sah sie nicht oft froh, doch auch nie tief betrübt.
Nach dem schweren Schlag hatte Marit deutlich das Gefühl, dass das Leben nun für sie zu Ende sei. Sie hatte von ihrem Vater den großen Hof geerbt, wusste aber nur zu gut: Wenn sie ihn behalten wollte, dann müsste sie heiraten, damit der Hof einen Herrn bekäme. Um dies zu vermeiden, hatte sie das ganze Anwesen einem ihrer Geschwisterkinder ohne Bezahlung unter der Bedingung überlassen, dass sie, solange sie lebte, dort freie Wohnung und Kost hätte.
Sie war zufrieden mit dieser Lösung und hatte sie nie bereut. Es herrschte keine Gefahr, dass ihr aus Mangel an Arbeit die Zeit lang würde. Die Leute setzten großes Vertrauen in ihre Klugheit und Güte, und sooft jemand krank war, schickte man sofort nach ihr. Die Kinder schlossen sich auch sehr an sie an. Meist war Marits Wohnung ganz voll von dem kleinen Volk. Sie wussten ja, dass Marit immer Zeit hatte, ihnen bei ihren kleinen Sorgen beizustehen und zu vermitteln. Während nun Marit so überlegte, was sie jetzt mit dem Ring tun solle, stieg heißer Zorn in ihr auf. Sie überlegte sich, wie leicht der Ring hätte gefunden werden können. Warum hatte der General nicht dafür gesorgt, dass er gefunden wurde? Er hatte ja die ganze Zeit gewusst, wo er sich befand; das verstand sie jetzt wohl. Aber warum hatte er es nicht so eingerichtet, dass Ingilberts Mütze untersucht wurde? Stattdessen ließ er drei Unschuldige um des Ringes willen den Tod erleiden. Dazu hatte er die Macht gehabt, nicht aber dazu, den Ring ans Tageslicht kommen zu lassen.
Im ersten Augenblick hatte Marit daran gedacht, mit ihrem Erlebnis zum Propst zu gehen und ihm den Ring zu übergeben; doch nein, das wollte sie nicht. Es war nämlich so; wo immer Marit sich zeigte, in der Kirche oder bei einem Gastmahl, wurde sie stets mit großer Achtung behandelt. Unter der Verachtung, die auf der Tochter eines Missetäters zu ruhen pflegte, hatte sie nie zu leiden gehabt. Die Leute waren der festen Überzeugung, es sei damals ein Unrecht begangen worden, und sie wollten es wiedergutmachen. Selbst die Herrschaften pflegten zu ihr hinzugehen, wenn sie Marit auf dem Kirchenplatz sahen, und ein paar Worte mit ihr zu wechseln. Sogar die Familie auf Hedeby – nicht der Rittmeister selbst, aber seine Frau und Schwiegertochter – hatte wiederholt den Versuch gemacht, sich Marit zu nähern. Ihnen gegenüber aber hatte sie sich immer abweisend verhalten. Seit jenem Rechtsverfahren hatte sie mit keinem von ihnen jemals ein Wort gesprochen.
Sollte sie nun hingehen und zugeben, dass die Hedebyer gewissermaßen recht gehabt hatten? Der Ring war ja tatsächlich im Besitz der Olsbymänner gewesen. Vielleicht würde man sogar kommen und sagen, sie hätten gewusst, wo der Ring sich befand, und hätten das Gefängnis und die Verhöre nur in der Hoffnung, freigesprochen zu werden, ertragen, um den Ring später verkaufen zu können.
Jedenfalls sagte sich Marit, wenn sie den Ring jetzt hinbrächte und erzählte, wo sie ihn gefunden hatte, so würde das als eine Rechtfertigung für den Rittmeister und auch für dessen Vater angesehen werden. Marit aber wollte nichts tun, was gut und vorteilhaft für die Löwenskölds war.
Der Rittmeister Löwensköld war jetzt ein Mann von achtzig Jahren, er war reich und mächtig, geachtet und geehrt. Der König hatte ihn zum Baron gemacht, und kein Unglück hatte ihn je getroffen. Er hatte vortreffliche Söhne, und auch diese waren in guten Verhältnissen.
Dieser Mann hatte Marit alles genommen, alles, alles. Durch seine Schuld war sie ohne Hab und Gut, ohne Mann, ohne Kinder. Viele Jahre lang hatte sie gewartet und gehofft, irgendeine Strafe werde ihn treffen; aber nichts, nichts davon war eingetroffen.
Plötzlich fuhr Marit aus ihrem tiefen Sinnen empor. Sie hörte kleine Kinderfüße rasch durch den Hof daherlaufen, und da wusste sie gleich, dass sie auf dem Weg zu ihr waren.
Und richtig, es waren zwei Jungen von zehn bis elf Jahren. Der eine war Nils, der Sohn des Hauses, den andern aber kannte sie nicht. Sie waren wirklich gekommen, sie um etwas zu bitten.
»Marit«, sagte Nils, »dies ist Adrian von Hedeby. Wir haben drüben auf der Straße miteinander Reifen gespielt, dann aber haben wir uns gestritten, und ich habe Adrian seine Mütze zerrissen.«
Marit sah Adrian nachdenklich an. Es war ein hübscher Junge mit etwas Freundlichem und Sanftem in seinem Wesen. Sie griff nach ihrem Herzen. Immer empfand sie Schmerzen und eine Art Angstgefühl, wenn sie einen Löwensköld sah.
»Wir sind jetzt wieder gut miteinander«, fuhr Nils fort, »und da möchte ich dich fragen, ob du mir nicht Adrians Mütze flicken willst, bevor er heimgeht?«
»Ja«, sagte Marit, »ja, ich will es tun.«
Sie ließ sich die zerrissene Mütze geben, stand auf und ging ins Haus.
»Das muss ein Wink des Himmels sein«, murmelte sie.
»Spielt jetzt ein Weilchen hier draußen, ich werde bald damit fertig sein«, sagte sie zu den Jungen.
Sie machte die Haustür hinter sich zu und saß allein drinnen, während sie die Löcher in Adrian Löwenskölds Zipfelmütze ausbesserte.