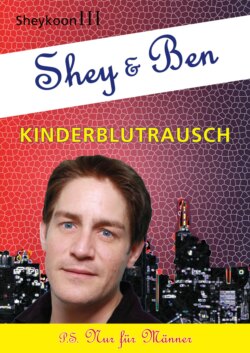Читать книгу Kinderblutrausch - Shey Koon - Страница 5
Familientragödie
ОглавлениеDer Flug war geschwind vorbei und wir stiegen in den Abendstunden am Jomo Kenyatta International Flughafen aus, dort besorgten wir uns den Bus für die Fahrt in den Aberdare National Park. Wir wählten die A2 nach Thika, wollten im Tuskys Supermarket unseren Bus bis oben hin mit den gelben Früchten beladen. Außerdem benötigten wir reichlich Wasser und Nahrung, da ich davon ausging, dass wir im Park übernachten würden. Jedenfalls verspürte ich nicht gerade das Bedürfnis, mir das Wasser des Flusses Ewaso Ng‘iro abzuschöpfen, auch wenn die Quelle direkt in Aberdare Range, einer Bergkette im Nationalpark, entsprang, und mit dem frischen Nass des Gletschers vom Mount Kenia Massiv gespeist wurde. Ich rief mir die Bilder der Krokodile wach, die sich herzhaft an den Leichen der Sklavenhändler labten, sich zufrieden ihre Bäuche vollschlugen und das Flusswasser mit dem Blut rot einfärbten.
Bevor wir uns auf dem Weg begaben, rief ich zuhause an, flirtete mit meinen Engeln, berichtete ihnen, dass wir wohlbehalten gelandet waren. Sie schnurrten zufrieden ins Telefon.
„Mein Junge, ich glaube wir haben uns getäuscht. Kein Streit, kein Scherengeklapper, kein Gequake im Hintergrund.“
Ben schmunzelte und drehte die Musik bis zum Anschlag auf. Rhythmische Trommeln und kenianische Stimmen durchdrangen die Ohren, wir wippten bald schon im Gleichtakt mit. Ich betrachtete meinen Jungen und Stolz erfüllte mein Herz. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Wort über den grausigen Fund gesprochen. Und das war bedenklich. Damit Ben das Scheußliche verarbeiten konnte, war es unausweichlich, darüber zu sprechen.
Zum Anfang der Laufbahn gelang es beinahe jedem Jäger, die Grauenhaftigkeiten eine gewisse Zeitspanne von sich fernzuhalten, doch an irgendeinem Punkt überflutete es die Seele.
Manch ein Jäger hatte sich daraufhin das Leben genommen. Zu der Zeit, als sich die Auftraggeber zuhauf bei mir meldeten, dass der psychische Druck auf die Jäger zu hoch sei, und schon mehrere unter dem Stress zusammengebrochen waren, richtete ich unverzüglich drei Teams von Psychologen ein, die sich weltweit um die Jäger kümmern sollten. Der Erfolg trat schlagartig ein und die Auftragsbücher der psychologischen Teams waren mehr wie ausgelastet.
Wir erreichten den Supermarkt gerade noch rechtzeitig, bevor er schloss, und kauften die Bananenbestände restlos auf. Ich besorgte mir Zigaretten, während Ben die Stauten in den Bus verfrachtete, denn ich verspürte wirklich Lust, genüsslich eine zu rauchen. Nachdem er die letzten Bananen in den Bus gedrückt hatte, war es beinahe Mitternacht, daher beschloss ich kurzerhand eine Rast einzulegen. Wir streunten durch die staubigen Straßen der Stadt, auf der Suche nach einem Restaurant. Wir entschieden uns für das Eton Hotel. Auch wenn das Hoteleigene Restaurant eher an eine Kantine erinnerte, mit kaltem Fliesenboden und einfachen Holzmöbeln, doch für unsere Pause reichte es allemal. Außerdem gab es einen Raucherraum, da in Kenia das öffentliche Rauchen verboten war, war das ein Glücksgriff.
Ich speiste mit meinem Jungen einen Snack, rauchte mit ihm eine Zigarette und schwärmte über das afrikanische Land. Ich war jedes Mal aufs Neue von der bunten Kleidung fasziniert, die die Vielfalt der farbigen Bevölkerungsgruppen in diesem Land widerspiegelten. Wir schwelgten in Träumereien, die Stunden flossen dahin. Es war Zeit zum Aufbrechen.
Gemächlich fuhr ich weiter auf die Thika-Gatura Rd C 67, die uns direkt in den Nationalpark führen sollte. Ich drehte die Musik leiser.
„Ben, wir sollten darüber sprechen! Du kannst nicht ewig davon wegrennen.“, triggerte ich ihn an.
„Über was willst du sprechen? Bei mir ist alles in bester Ordnung.“ Ben blickte aus dem Fenster, überspielte die Frage. Diese Marotte hatte er bereits als Kleinkind.
„Die gequälten Kinder im Laster, das waren harte Bilder. Glaubst du etwa, das geht spurlos an mir vorbei. Mein Junge es gab eine Zeit, da bin ich unter dem Druck der fürchterlichen Wahrheit zusammengebrochen.“
Ben drehte sich zu mir. „Welche Wahrheit meinst du?“
Ich blickte zum Mond. „Die Welt ist eine Hölle. Hie und da blitzt ein wenig Liebe auf, doch letztendlich ist die Welt ein abgrundtiefes Inferno.“
Ben kullerten Tränen über die Wangen, seine Schutzblase löste sich in Luft auf. Ich bremste ab und nahm ihn in den Arm, er heulte bitterlich. Ich drückte ihn an mich und streichelte seinen Wuschelkopf.
„Wenn es dir lieber ist, mit einem Psychologen zu sprechen statt mit mir, dann ist das vollkommen okay. Tu das was dir hilft.“
Ben beruhigte sich. „Paps, ich werde noch Schlimmeres sehen. Davon gehe ich jetzt aus. Versprich mir, dass es eines Tages vorbei sein wird.“
Ich blickte ihn fragend an.
„Wie meinst du das?“, hackte ich verblüfft nach.
„Das eines Tages das Böse restlos ausgerottet ist und wir in Frieden leben können.“
Ich drückte ihn noch fester.
„Eines Tages, in ferner Zukunft wird dieses Wunder geschehen. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben dürfen, aber unsere Kindeskinder.“
Ben setzte sich aufrecht, nahm eine kriegerische Haltung ein, während er lächelte.
„Gut, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als ein Teil dieses, wie bezeichnest du es, weltumspannendes Immunsystems zu sein.“
Wir gaben uns High Five und ich drückte aufs Gas. Wir verspeisten dreieckige süßliche Maandazi und tranken dazu reichlich Stoney Tangawizi, eine köstliche Ingwer-Limonade. Ben drehte den Musikregler abermals bis zum Anschlag, wippte mit seinem Körper zum Takt. Ich war froh, dass wir seinen besten Freund besuchen würden, auch wenn dieser mittlerweile beinahe tausend Kilo wog. Insgeheim hatte ich von vornherein beschlossen, dass wir mindestens zwei Tage bei Jo bleiben würden, damit Bens Wille mit Zuneigung getränkt wurde. Ich liebte meinen Jungen aufrichtig und freute mich für ihn, dass er schon bald seinen besten Freund kuscheln würde. Die Fahrt ermüdete mich nicht.
Wir fuhren in den Aberdare National Park ein und ich hupte wie ein rasender Bote, während ich unseren Bus direkt zum Fluss steuerte. Ben rüttelte an mir, seine Aufregung sprühte ihm aus die Augen, sein Körper bebte vor Erregung. Er liebte seine Elefantenfamilie, als ob es seine eigene war. Kurz vor dem Ziel lag schon der erste Elefant auf dem Boden, döste vor sich hin. Ich lärmte was das Zeug hielt, Ben lehnte sich aus dem Fenster und pfiff schrill, doch der Dickhäuter blieb unbeeindruckt und regungslos. Neben dem grauen Koloss lagen noch zwei weitere Elefanten.
„Schlafen die einen Rausch aus, oder warum bewegen sie sich nicht?“, scherzte ich.
Ich hielt in gebührenden Abstand an, letztendlich zwecklos, Ben sprang mit einem Satz aus dem Bus und rannte brüllend zu den Elefanten hin.
„Mensch Junge, pass doch auf!“, schrie ich warnend hinter her.
Doch plötzlich blieb er stehen, hielt sich die Hände vor das entsetzte Gesicht und schwieg. Er blickte sich nach allen Seiten um. Ich folgte ihm. Mit offenen Augen verschlug es mir die Sprache. Es dauerte einen Augenblick bis ich mich gefasst hatte.
„Verdammter Fuck. Elfenbeinjäger. Sie haben hier gewildert.“
Ich streichelte die toten faltigen Körper. Friedlich lagen sie da, ihre Rüssel waren abgetrennt, ihre Gesichter mit Äxten abgeschlagen worden, das Elfenbein wurde mit brachialer Gewalt herausgebrochen. Ich drehte mich zum Fluss, da lagen die Fleischklumpen der Krokodile, denen sie die ledrige Haut vom Körper gezogen hatten. Wir waren von Tierkadavern umgeben.
„Ein Blutbad. Sie haben meine Freunde wegen ihrer Stoßzähne niedergemetzelt. Ich fass es nicht.“
Ben lief an den Fluss, betrachtete die zerlegten Krokodilleiber, stolperte zu mir zurück.
„Jo ist nicht dabei. Vielleicht haben wir Glück und er lebt noch. Paps, lass ihn uns bitte suchen.“
Wir spurteten zum Bus zurück, ich drückte das Gaspedal durch und flehten unsere Stoßgebete zum Himmel. Der Bus rumpelte, ich raste über Stock und über Stein, Panik hatte mich ergriffen. Meine Sinne trübten ein, ich schüttelte meinen Kopf, um wieder wach zu werden. Die Situation war wie in einem schlechten Film. Ich hatte nicht aufgepasst, ein Stimmgewirr hallte durch das Seitenfenster, plötzlich winkte uns ein afrikanischer Wildhüter herbei, der in einem Pulk von aufgeregten Kollegen stand. Ich stoppte und fuhr an ihn ran. Mit seinem Gewehr im Anschlag befahl er uns auszusteigen, durchsuchte den Bus, fragte uns nach dem Grund unseres Aufenthaltes. Ich antwortete knapp, wollte wissen, warum wir aufgehalten wurden. Er deutete rechts neben uns. Ein getötetes Nashorn lag niedergestreckt auf dem Boden, das Horn war tief aus dem Gesicht abgesägt worden, eine Blutlache tränkte den Boden. Wir wurden gebeten nach den räuberischen Banditen Ausschau zu halten, und sofort zu melden, wenn wir etwas Auffälliges gesichtet hätten. Ich gab ihnen mein Wort und sie ließen uns unbehelligt weiterziehen.
„Ben, wir haben keine Wahl. Wir fahren solange durch den Park, bis wir Jo finden. Wenn die Wilderer es auf Horn und Elfenbein abgesehen haben, dann töten sie so viele Nashörner und Elefanten, wie sie nur können.“
Wir fuhren kreuz und quer, rauf und runter, hielten unsere Augen auf. Unsere Suche blieb erfolgslos. Wir stiegen aus und streckten unsere Glieder. Ben verhielt sich ganz ruhig, er stand unter Schock. Ich bot ihm eine weitere Zigarette an.
„Papa, du weißt, ich nehme regelmäßig mein Immunsuppressiva ein, damit ich die Leber nicht abstoße. Die Kippe wird mir doch keine Probleme verursachen, oder?“
Ich schüttelte meinen Kopf und warf ihm das Plastikfeuerzeug zu. Ich ging in die Hocke und lehnte mich mit dem Rücken gegen den Bus, rauchte Zug um Zug, bis es mir den Kopf drehte. Als ich nur noch den Stummel zwischen den Fingern hielt, zündete ich mir noch eine an. Ben tat es mir gleich. Wir verloren für einen Moment jegliches Gefühl, rauchten und ließen den Geist ruhen. Nachdem ich die Zweite fertig geraucht hatte, stand ich auf, klopfte mir den Staub von der Kleidung und staunte nicht schlecht.
Der Bus wackelte. Ich untersuchte die Beschaffenheit des Bodens, doch der schien fest zu sein. Ich tippte meinen Jungen an und wir liefen um den Bus herum und trauten unseren Augen nicht.
„Jo, verdammt Jo.“ rief Ben freudestrahlend aus, rannte auf seinen Freund zu. Jo blickte ihn genauso überrascht an, trampelte erregt auf der Stelle und trötete vor Glücksgefühl. Ben umarmte ihn, legte seinen Kopf gegen den dicken Bauch und kraulte ihm das Vorderbein. Jo hatte bereits kleine Stoßzähne bekommen.
„Du lebst. Dem Himmel sei Dank du lebst.“
Jo legte seinen Rüssel um Bens Schultern, drückte sich mit seinem Gewicht gegen meinen Jungen Ben, der sich nur mit aller Kraft dagegenstemmen konnte.
„Ruf deine Familie, ich habe eure Lieblingsdelikatesse dabei. Los, mach schon!“
Unweit von uns stand eine Gruppe von grasenden Dickhäutern. Ich bemerkte sofort, dass etliche aus dem Familienverband fehlten. Wir öffneten die Bustür, Jo blieb an Bens Seite kleben und bekam die erste geschälte Banane, und die zweite und die dritte. Wir hievten die Stauten aus dem Gefährt und verteilten sie Stückweise an die hungrigen Mäuler. Ein großer Elefant, bestimmt an die 5 Tonnen schwer, spielte mit seinem Rüssel in meinem Gesicht herum, ich blieb starr stehen und fürchtete um meine Gesundheit. Ben lachte mich aus. Ich fand das nicht wirklich witzig. Nachdem die gelbe Ladung zur Hälfte verfüttert war, legten wir eine Pause ein. Ich war geschafft.
„Paps, wir müssen weiter. Die Elefanten brauchen frisches Wasser. Wir begleiten sie flussaufwärts, an eine Stelle, wo kein Blut das Wasser verschmutzt.“
Ich kniff meine Augen zusammen.
„Du kannst wohl Elefantianisch, oder woher weißt du das?“, erwiderte ich fassungslos.
„Nein, rede doch keinen Blödsinn. Elefantianisch. Du veräppelst mich. Jo hat es mir angedeutet. Nichts weiter.“, gab mein Junge zurück und setzte sich auf seinen Sitz, schlug die Türe zu und Jo kuschelte mit ihm durch das Fenster.
„Passt auf den Lack auf! Dein Dicker zerkratzt ihn mit den Stoßzähnen.“
Ich schwang mich auf dem Fahrersitz und fuhr langsam an, behielt die Geschwindigkeit im Elefantenlaufschritt. Die Leitkuh führte uns an, während der Pulk uns in die Mitte nahm. Ben wand sich mit dem Oberkörper durchs Fenster und schmuste während der Fahrt mit Jo, der nach wie vor seinen tollpatschigen Gang beibehalten hatte. Allem Anschein nach war das ein angeborener Lauffehler.
Ich hielt nach Gefahren Ausschau. Die Wilderer konnten sich überall aufhalten und meist waren sie mit Maschinengewehren und Macheten ausgestatten und schreckten auch vor Mord nicht zurück. An einem geeigneten Fleck hielt der gesamte Tross an. Löwen und Leoparden stillten unweit von uns ihren Durst, da wir schützend von den schweren Leibern eingekreist waren, konnten wir uns gefahrlos aus dem Bus begeben. Wir befanden uns anscheinend an der wilden Tränke, denn nur ein paar Meter weiter dösten behäbige Krokodile in der Sonne und Büffel erfrischten sich an dem fließenden Nass. Die Elefanten tranken riesige Mengen an Wasser, sie spritzten durch die Gegend, Ben und ich gingen in Deckung, beobachteten die Truppe beim Planschen. Für einen trügerischen Augenblick war die Welt friedlich und heil.
„Papa, wie bist du zum Jäger geworden?“, fragte mein Junge unvermittelt.
„Ich habe das Spiel erfunden. Da lag es also nahe, dass ich ein Jäger werden würde.“
Ben blickte mich verdutzt an. Er griff sich die Schachtel Zigaretten, bot mir eine an, lupfte sich eine hervor und schnappte sich das Feuerzeug.
„Das ist doch keine Antwort.“ Er zündete sich den Glimmstängel an und reichte mir das Feuerzeug rüber. „Nein, ich wollte wissen, wie kamst du darauf, durch die Welt zu jetten und gegen Bezahlung Verbrecher zu töten? Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein normaler beruflicher Werdegang.“
Er zog den Rauch langsam ein und blies ihn in Ringen wieder aus, während sich Jo zu unseren Füßen legte.
„Es begann mit einem Wutgefühl in meinen Magen, das sich durch mich hindurch fraß, ja, das war wohl der erste Impuls. Ganz ehrlich, du warst der zündete Funke. Wie du weißt, ich wünschte mir nie ein Kind, alleine aus dem Grund, dass ich nicht dumm sein wollte. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen ein kleines Geschöpf auf unserer kranken Welt großziehen. Die Erde ist einfach kein guter Nährboden für das Entwickeln von Freude und Glück. Du siehst ja mit eigenen Augen, was für eine perverser Mist um uns geschieht.“ Ich verzog lächelnd meine Mundwinkel, denn Jo spielte mit seinem Rüssel an Bens Füßen. „Als die Sache mit dem Video geschah und deine Mutter alle Register zog, um uns beide zu trennen, spazierte ich eines Tages traurig durch die Frankfurt City. Ich sah den Schmutz der Stadt mit offeneren Augen, als je zuvor. Ich lief durch die dreckigen Straßen des Rotlichtmileus, passierte das Bahnhofsviertel mit seinen heruntergekommenen Dealern, der faulige Geruch der Heroin- und Crackabhängigen durchsetzte meine Nase und dieses Elend solltest du eines Tages sehen. Dieser Gedanke war unerträglich. Wer konnte mir die Garantie geben, dass du nicht auch einer dieser Zombies werden könntest. Aber es hielt mich nicht davon ab, mich selbst dem Opiumrausch hinzugeben. Ich war verloren und hasste die Welt, noch mehr als jemals zuvor. Dann, an einem grauen Herbsttag, eine alte Frau setzte mir gerade einen Schuss in die Halsvene, sah ich, wie zwei Zuhälter ein blondes Mädchen vom Straßenstrich, nicht älter als du, auf offener Straße verprügelten und sie in einen dunklen Hauseingang zogen. Ich eilte hin, wollte ihr helfen, doch die verabreichte Dosis des Rauschmittels lähmte mich. Der eine hielt ihr den Mund zu, während der andere sie brutal vergewaltigte. Mit geschwollenem Gesicht, blauen Augen und aufgerissener Lippe wurde sie geschändet in ihren zerfetzten Klamotten liegengelassen. Ich werde ihren verängstigten Blick nie mehr vergessen können. Ich krabbelte mit meiner letzten Kraft zu ihr hin und hielt sie tröstend in meinem Arm. Das Heroin war so stark, ich döste ein, und wie ich wieder zu mir kam, war sie bereits verschwunden. Tage später torkelte ich an einem Kiosk vorbei, erspähte ihr Gesicht auf der Titelseite. „Selbstmord als Flucht.“ Ich drückte die Glut aus. Ben hörte gespannt hin. „An diesem Tag schwor ich mir und dem Himmel, dass ich all meine Kraft einsetzen werde, die Bösen aus ihren Dreckslöchern zu scheuchen und auszulöschen, wo immer ich ihnen begegnete. Ich jagte die zwei Zuhälter und tötete sie, entwendete ihr Geld, ihren Schmuck, ihre Autos und ihre Wohnungseinrichtung. Durch den Verkauf häufte sich schnell ein hübsches Sümmchen an, sozusagen mein Startkapital. Daraufhin jagte ich gezielt den brutalen Zweig der Verbrecher und meine Idee wuchs, wurde mächtiger und schlagkräftiger, wurde zu dem, was es heute ist. Eine erfolgreiche Firma, wenn du es genau nehmen willst.“ Ich legte meine Hand auf seine Schulter. „Dir kann ich keine perfekte Welt bieten. Leider.“
Ben krabbelte zu Jo, umarmte ihn, Jo wickelte seinen Rüssel um seinen Arm, in dieser Stellung döste Ben lächelnd vor sich hin. Ich hielt Wache, betrachtete meinen Kleinen, denn es erfreute mich nach wie vor, dass er in meiner Nähe war. Wir hatten in den vergangenen Monaten unglaublich viel erlebt. Ein Abenteuer jagte das nächste. Unsere zugeschnittene Leber erholte sich mehr und mehr, und Ben hatte sich zu einem stattlichen Jugendlichen entwickelt.
Die Zeit flog dahin, ich rauchte noch eine, bevor ich ihn zum Essen weckte. Wir aßen die restlichen Maandazi und tranken den Rest Ingwer-Limonade. Die Elefanten wanderten gemeinsam los, wir folgten ihnen fahrend hinterher. Stunden später rasteten sie, Ben nutzte die Gelegenheit, um die andere Hälfte der Bananenstauden zu verfüttern. Selbstverständlich spannte mein Junge mich ein und so schälte ich Banane um Banane. Als wir endlich die letzte Frucht im Maul von Jo verschwinden sahen, verschwand mittlerweile die Sonne und der Mond erschien grüßend am Himmel.
Ich legte mich auf die harte Ladefläche und schlief vor Erschöpfung auf der Stelle ein. Ben wich seinem Freund nicht mehr von der Seite. Der Schlaf tat gut, kein ekelhafter Alptraum, der mich heimsuchte. Erst gegen frühen Morgen rüttelte Ben mich wach.
„Du liegst auf den Zigaretten. Ich will noch eine rauchen.“
Ich rieb mir die Augen und streckte mich.
„Hast du Lust auf einen Kaffee? Komm wir fahren nach Nyeri, essen etwas und decken uns mit Lebensmittel ein.“
Bens Augen strahlten. „Bedeutet das, wir bleiben noch eine Nacht?“
Ich zwinkerte ihm zu und nickte, zündete uns noch eine an.
„Das wird die letzte sein. Jetzt langt es mit dem Sündigen.“
Ben zuckte mit den Schultern und wir machten uns auf dem Weg. Wir tranken frisch gebrühten Kaffee, kauften uns afrikanische Leckereien und Wasserflaschen, hielten uns nur kurz auf, denn Ben drängte, sein Freund wartete schließlich. Damit der Speiseplan keine Langweile aufbot, besorgte wir nun Rüben und Äpfel. Mein Smartphone läutete.
„Was treiben unsere zwei Reisenden so ganz alleine, fragen wir uns. Mein Prinz, wir vermissen dich, das Bett ist ganz kalt. Wann kommst du zu deinen Luxus-Ladys zurück? Wir brauchen Liebe.“ Eve schnurrte ins Telefon, Melanie kicherte im Hintergrund.
„Morgen Mittag fliegen wir zurück. Dann bin ich nur für euch da. Stellt schon mal den Champagner kalt.“
Ich lachte ins Telefon. Melanie war am anderen Ende.
„Nimmt Ben auch seine Medikamente ein? Ich lege euch übers Knie, wenn er die vergisst.“
Ich versprach meinen Hotties auf ihn aufzupassen. Ich wollte um jeden Preis verhindern, dass meine Krankenschwestern einen Grund hatten, wütend auf uns zu sein. Ich kaufte noch vier Decke und zwei Kissen, denn die kommende Nacht wünschte ich mir weicher gebettet zu verbringen. Mit frischen Tatendrang kehrten wir zurück.
„Guck mal! Dein Dicker rennt wie der größte Tollpatsch auf Erden. Ich find den echt putzig.“
Ben blickte hoch, doch das Lachen verging mir schnell. Jos Ohr blutete fürchterlich.
„Halt an! Halt an!“, forderte Ben mich schreiend auf.
Ich bremste knallhart runter, wir sprangen zeitgleich aus dem Bus und rannten auf Jo zu. Er war aus der Puste, sein Ohr war von drei Kugeln durchschossen worden. Ben küsste ihm auf den Rüssel. Ich packte meinen Jungen.
„Die Wilderer haben zugeschlagen. Wir müssen zu den anderen. Schnell, sie brauchen unsere Hilfe.“
Mit Wut trat ich aufs Gaspedal.
„Nicht Bens Freunde, nicht Bens Freunde.“, raste es mir durch meinen Kopf.
Jo rannte, was das Zeug hielt. Ich sah rot, hörte kein Geräusch mehr, vor mir eine Gruppe Männer, sie waren über einen toten Elefanten gebeugt, einer hackte gegen den großen Schädel, ich hielt direkt auf ihm zu und knallte mit dem Bus gnadenlos gegen seinen Körper. Die Axt flog ihm hohen Bogen davon. Die anderen rannten in Deckung, feuerten mit ihren Maschinengewehren auf uns. Doch wenn es bei mir durchknallte, dann gab ich erst Ruhe, wenn alles um mich herum brannte und jeder blutende Bastard tot vor mir lag. Ich wendete den Bus, rauschte wie in einem schlechten Drogenfilm durch den Wald, drückte aufs Gas und fuhr mit aller Wucht gegen einen Baum, der sich nach vorn bog. Jo und seine Familie trampelten rasend heran, die Männer feuerten, killten zwei weitere Elefanten, ich riss die Tür auf, sprang mit großen Schritten auf einen der Angreifer zu, schlug ihm hart ins Gesicht. Er fiel um, ich trat gegen seinen Kopf, als ob es ein Fußball war. Ich schnappte mir seine Waffe, zerrte sie ihm aus den Händen und knallte ihn ab. Plötzlich pfiffen Schüssen an mir vorbei. Hinter mir hatte mich einer der Verbrecher aufs Korn genommen. Ich drehte mich, Ben stand mit der Axt neben dem Killer und hackte auf seinen Hals ein. Blut spritzte, Ben hieb nochmal zu, der leblose Körper sackte nach vorne. Ben ergriff sich die Waffe und wir scheuchten die Bestien auf und brachten sie Mann für Mann zur Strecke. Erst als sie allesamt blutüberströmt vor mir lagen, besänftige ich mich. Ben lief die acht Leichen ab und verpasste jedem einen Schuss zwischen die Augen.
„Nehmt. Ihr werdet keinen meiner Freunde mehr töten.“
Die überlebenden Elefanten tobten, zerrten die Toten über den steinigen Boden, stampften die Leichen in Grund und Boden. Erst als sie sich abreagiert hatten, kümmerten sie sich um ihre erschossenen Familienangehörigen. Sie stupsten sie an, wie in der Hoffnung, dass sie gleich wieder aufstehen könnten, rollten die Rüssel über ihre tonnenschweren Artgenossen. Jo verabschiedete sich betrübt von seinen geliebten Beschützern. Die Elefanten trauerten mit uns über ihre Toten. Mir zerriss es das Herz. Wir warteten ab bis die Dickhäuter zurück an ihre Wasserstelle trotteten. Wir untersuchten Jos Ohr, doch die Blutung hatte mittlerweile gestoppt, nur drei rissige Löcher blieben zurück.
Nachdem sie ihren Durst gelöscht hatten, verfütterten wir unsere mitgebrachten Gaben, und nicht nur an die Elefanten, es wagten sich auch Waldschweine und schwarz-weiße Affen an die Futtervergabe heran. Ben war ganz in seiner Welt.
Den restlichen Tag und die Nacht über trennte nichts und niemand mehr die beiden. Ich beschäftigte mich mit meinen Gedanken, dachte an meine Ladys, dankte dem Himmel für mein unbeschreibliches Glück. Sah ich doch, dass das Familienglück so zerbrechlich sein konnte, innerhalb einiger Stunden zerstört für alle Ewigkeit. Doch ich hatte nun einmal geschworen, dem Bösen die Stirn zu bieten. Was für ein Glück sollte ich auf dieser Erde finden, solange die Hölle mit ihrem schrecklichen Terror unsere Leben und unsere Träume vergiftete.
Am nächsten Morgen wurde es Zeit für uns aufzubrechen. Ben verabschiedete sich von Jo und seiner Familie. Ein wuchtiger Elefant löste sich von der Gruppe, der, der schon einmal mit seinem Rüssel mein Gesicht abgetastet hatte und stellte sich vor mich hin. Er rückte keinen Meter zur Seite, ich klopfte ihm gegen den Rüssel, als ob eine unsichtbare Macht mich in ihrem Griff hatte. Er beugte sich nach vorne, stupste mich mit dem Kopf, ich tätschelte ihm gegen die Stirn. Es war seine Geste des Dankes.
„Wir besuchen euch, sobald wir den bevorstehenden Auftrag hinter uns haben. Jo, ich bringe alle mit. Ganz fest versprochen.“
Ben drückte seinen Jo, wir setzten uns in den verbeulten Bus, winkten zum Abschied und fuhren zum Flughafen. Mit dem nötigen Scheinen fragte niemand nach dem Unfall. Wir konnten ohne weitere Probleme nach Hause fliegen. Wir sprachen über das grausame Vorgehen der Wilderer und das brutale Geschäft mit den Tieren. Wir erinnerten uns an den Voodoomarkt zurück, an die getrockneten Hufen, die bunten Felle, die Hände und Füße der Affen, die dort feilgeboten wurden.
Meine Ladys erwarteten uns aufgeregt in der Ankunftshalle am Frankfurter Flughafen. Sie stöckelten auf uns zu, küssten mich, zwickten mir kess in den Hintern und busselten meinen Jungen von oben bis unten ab.
„Du bist für heute ausgebucht.“, flüsterte mir Eve ins Ohr.
„Hast du deine Medikamente schön artig eingenommen.“, erkundigte sich Melanie bei Ben.
Er bejahte die Nachfrage, wusste er doch was passieren konnte, wenn sich mein Engel um seine Gesundheit sorgen musste. Diesen Ärger ersparte er sich lieber, was ich gut verstehen konnte. Ben erzählte sogleich, was wir in Afrika erlebt hatten. Eve und Melanie blickten wütend zu mir rüber.
„Hey, was habe ich angestellt. Ich habe die Tiertöter nicht bestellt. Wir haben getan, was getan werden musste.“
Eve und Melanie nahmen mich in die Zwickmühle, ich spürte ihren Groll.
„Du hättest uns Bescheid geben können.“
Ich wand mich raus.
„Damit ihr euch unnötige Sorge macht? Das kann doch nicht euer Ernst sein.“ Ich blickte reumütig auf den Boden. „Ihr habt ja Recht, ich hatte nicht nachgedacht.“ Das Lächeln legte sich wieder in die Gesichter meiner Hotties. „Außerdem haben wir geraucht. Fast eine ganze Schachtel.“
Ich rannte davon, sie jagten mir hinterher, doch ich war schneller. Aber letztendlich würden sie mich irgendwann sowieso erwischen, also blieb ich stehen und erwartete die Strafe. Sie drehten mir rechts und links die Ohren um.
„Mitkommen!“, befahlen sie mir schroff.
„Lasst Paps in Ruhe!“
Ben schnappte meinen Arm und zog an mir, Eve zog an dem anderen Arm und Melanie behielt mein Ohr fest im Griff. Keiner der drei ließ nach, ich verzog unter Schmerzen mein Gesicht, doch ich schrie nicht auf. Erst als die Nähte meiner Hemdärmel aufplatzten, ließen sie von mir ab. Wir standen eingefroren da, Ben begann als erstes zu lachen, bevor wir alle losprusteten. Wir hielten unsere Hände und verließen als Familie die Flughalle.
Der Bugatti stand frech im Halteverbot. Eve chauffierte uns heim, ich freute mich auf unser zuhause, vermisste die Asagis und Steve. Eve blieb vor der Einfahrt stehen.
„Warum fährst du nicht die Einfahrt hoch?“, fragte ich erstaunt.
Melanie winkte mich aus dem Wagen. Eve hielt Ben zurück.
„Mein Prinz, gib mir einen Kuss. Ich fahr mit Ben zu Thorsten. Melanie wünscht sich, dass er sich untersuchen lässt, ob mit seiner Leber noch alles in Ordnung ist.“
Ich drehte mich zu Melanie, hob meine Augenbrauen und gab nach. Ich küsste Eve und zog dieses Mal an ihrem Ohr.
„Bis nachher mein Engel. Ich sollte dir deinen Hintern versohlen.“, flüsterte ich ihr ins Ohr.
„Ich freu mich schon drauf.“, konterte sie keck.
Melanie drückte sanft meine Hand, unbändige Liebe strömte durch meinen Körper. Sie schmiegte sich an meinem Arm, klammerte sich an mir fest. Wir legten uns zusammen ins Bett, küssten uns, stupsten uns mit den Nasen. Ihr feiner Duft liebkoste mich, ich wünschte mir sehnlichst mehr Arme zu haben, damit ich sie enger hätte umarmen können. Wir entkleideten uns Stück um Stück, flüsterten uns schmusige Worte ins Ohr, liebten uns, als ob es kein Morgen mehr geben würde. Unsere Körper klebten aneinander, ich biss ihr in den Nacken, spritzte meinen Saft in ihre weiche Pussy. Sie zitterte erregt und schnurrte überglücklich.
Eve öffnete die Tür, schlich sich zu uns rüber, küsste uns.
„Aufstehen, auch wenn es euch schwerfällt meine Liebeshäschen. Keine Ahnung wie er das in Erfahrung brachte, dass ihr eingetroffen seid, aber Djan ist bereits auf dem Weg zu uns. Er ist im Besitz von Neuigkeiten.“
Melanie und ich verzogen mürrisch unsere Gesichter, versuchten Eve zu uns ins aufgeheizte Bett zu ziehen.
„Wir sind inmitten des Auftrags, mehr Haltung meine Profis.“ Dann packte sie mich, drückte mich aufs Bett und versohlte lachend meinen Po. „Für das Rauchen, du Mistkerl.“
Melanie half ihr und lachte schallend mit.
Erst unter der Dusche kam ich zur Luft. Ich rasierte mich, nahm mir vor am nächsten Tag mit Ben bei Horst vorbeizuschauen und hüllte mich in Givenchy. Ich fühlte mich wohl in meiner Haut, streifte mir acht rote Diamantblingringe über meine Finger und begab mich zu den Asagis. Ben war gerade dabei, unsere Kois zu füttern und den Teich zu säubern.
„Alles in Ordnung mit unseren Wunderfischen?“
Ich ging in die Hocke und kraulte die zutraulichen Fische. Ben antwortete nicht, schien in Gedanken versunken.
„Hey, alles klar bei dir? Was hat Thorsten gesagt?“, hakte ich besorgt nach.
„Ach, mir geht es bestens. Ich mache mir eher Sorgen um Jo. Was ist, wenn ihm etwas passiert? Wahrscheinlich sind bereits die nächsten Elfenbeinjäger auf dem Weg zu seiner Familie, und beim nächsten Besuch ist er überhaupt nicht mehr da.“
Ich wuschelte meinem Jungen durch seine Locken.
„Dein Herz ist schwermütig. Das vernebelt deine Gedanken. Willst du ihn herholen? Wir bauen einfach an.“, scherzte ich, wenn auch ernsthaft gemeint.
„Paps, lass die Späße. Mir ist echt nicht danach zumute.“
Ich überlegte nur kurz.
„Ben ich betrachte die Gefahr von weiter weg, als du. Mein Kopf ist klarer. Lass uns etwas abmachen.“ Ben spitzte seine Lauscher. „Sobald unser Brasilien-Auftrag erledigt ist, fliegen wir alle zu deinem Freund, suchen nach einem Team von Kriegern, die deine Zweitfamilie beschützen werden. Was hältst du davon? Geld hast du ja dann genug verdient.“
Ben sprang auf, warf sich auf mich drauf und knuddelte mich.
„Danke! Danke! Danke! Du bist der beste Papa der ganzen Welt.“
Ich drückte ihn, ja wahrlich, das wollte ich sein. Der beste Papa der ganzen Welt. Genau in diesem Augenblick raste ein Aston Martin One-77 vor unser Tor und bremste mit quietschenden Reifen ab. Djan stieg aus.
„Seid ihr feste im Training, ihr Unruhestifter.“, feixte er zu uns rüber und wartete darauf begrüßt zu werden.
Ben rannte mit einem breiten Lächeln zum Tor und schüttelte Djan respektvoll die Hand. Ich ging auf meinen Auftraggeber und Freund zu, umarmte ihn herzlich und geleitete ihn ins Haus.
„Du wirst schon voller Spannung erwartet. Da haben wir wohl ein wenig zu viel gezündelt.“
Djan klopfte mir auf die Schulter.
„Ihr habt in ein wirklich dreckiges Netz hineingegriffen. Dazu gleich mehr.“
Djan umarmte meine Ladys überschwänglich.
„Zwei stolze Kriegerinnen. Shey, du hast das Götterglück gepachtet.“
Ich pflichtete ihm bei. Röhrend hielt der 488 GTB Ferrari, wir lauschten, schon stürmte Steve durch die Türe, presste mich und Ben an sich ran.
„Ist auch Zeit geworden, dass ihr endlich da seid. Das nächste Mal fliege ich mit, damit ihr gleich Bescheid wisst.“
Wir setzten uns an dem runden Mahagonitisch, Eve und Melanie bereiteten guten jamaikanischen Blue Mountain Kaffee zu.
„Wie ich bereits sagte, euer nächtlicher Einsatz wird nicht grundlos unter der Decke des Schweigens gehalten. Was ich euch jetzt berichten werde, haut euch glatt von den Socken.“
Djan setzte eine Pause der Spannung an.
„Los, sagen Sie schon! Warum spannen Sie uns so unter die Folter?“ Ben fiel es schwer sich zurück zu halten.
Djan ließ sich von einem pubertierenden Jungen nicht aus der Fassung bringen und wartete mit Absicht noch länger ab, grinste Ben mit verkniffenen Augen an. Ben schmollte.
„Die Kinder waren anscheinend für eine ganz besondere Party zugerichtet worden. Ein geheimer Milliardärsclub hatte die Bestellung in Auftrag gegeben. Die Unschuldslämmer waren als Höhepunkt des Festes gedacht. Ein Informant erzählte mir, dass die Kinder zuerst für die abartigsten sexuellen Spiele gequält und missbraucht werden, bevor sie in einer Arena hungrigen Raubtieren als Abendmahl vorgesetzt werden. Ein einzelnes zugerichtetes Kind kostete ihnen gerade einmal 20.000 Euro. Dafür wird es bis vor die Haustüre geliefert.“
Mir grauste vor dem Gehörten. Natürlich war mir bekannt, dass die Syndikate die Drecksarbeit für diejenigen erledigten, die die Bestellungen aufgaben. Trotzdem erschreckte mich der Gedanke, dass die erfolgreichen Geschäftsleute in der Öffentlichkeit aufgrund ihres Einsatzes gelobt und honoriert wurden, während sie dann als Bestien über die hilflosesten Menschen herfielen und sie aus reiner Lust zerfleischten.
„Natürlich blitzten jetzt die Fragen auf. Warum gerade in Deutschland solch eine Lieferung unbehelligt auf den Straßen unterwegs sein konnte? Andererseits, wer stoppte diese grausame Fracht?“, ergänzte Djan.
Wir rollten alle mit unseren Augen, spielten die Unwissenden.
„Djan hast du die Spuren beseitigt?“, fragte Eve nach.
Er nickte. Melanie pustete erleichtert auf. Steve klopfte auf dem Tisch.
„Gut, dann würde ich sagen, wir fliegen die Tage nach Brasilien. Keine Ruhe aufkommen lassen.“
Djan verabschiedete sich herzlichst von uns, nur Ben schüttelte er knapp die Hand.
Es war bereits Mitternacht, wir beschlossen allesamt joggen zu gehen. Unter dem Licht des Mondes schwatzten wir Belangloses, beruhigten unsere Gemüter. Noch in derselben Nacht holte ich mein Versprechen nach und versohlte Eve ihren knackigen Po, bevor ich ihn voller Lust leckte und vögelte. Melanie küsste und fingerte Eves Muschi, bis meine russische Schönheit vor Ekstase weinte. Friedlich kuschelnd schliefen wir ein.