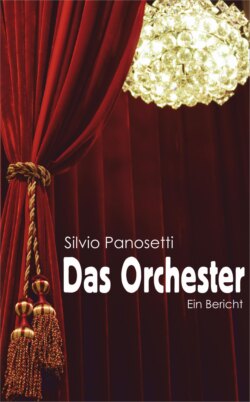Читать книгу Das Orchester - Silvio Panosetti - Страница 3
Kapitel 1
ОглавлениеDieser Bericht hätte vor einigen Jahren nur unter größten Schwierigkeiten veröffentlicht werden können. Es gab damals nämlich eine breite Öffentlichkeit, die eine ganz andere Sicht der Dinge vertrat, ein Phänomen, das aus dem kulturellen Leben eines großen Teils unserer Gesellschaft nicht wegzudenken war. Bis heute ist es allerdings ungeklärt, ob es sich dabei letztlich nicht um eine Täuschung gehandelt hat. Doch die hier zur Sprache kommende Sache hat sich so oder so zu einem Mythos verfestigt. Ob das seine Richtigkeit hat, lässt sich allerdings nicht beantworten.
Jetzt kann es sein, dass einige Leute versuchen werden, mich als Verfasser dieses Berichts der Komplizenschaft eines gewissen Martin Rivaldis zu bezichtigen. Darauf darf ich mit gutem Gewissen antworten, dass diese Annahme falsch ist, denn ich interessiere mich für den besagten Mann nur im Zusammenhang mit den im folgenden Bericht geschilderten Geschehnissen.
Natürlich musste ich, um genauere Informationen auch von dieser Seite zu erhalten, mit Rivaldi persönlich in Kontakt treten. Ich fühle mich mit ihm – oder mit dem, was er früher vertrat – nicht solidarisch und bin ausschließlich an der Darstellung von Ereignissen interessiert, wie sie mir eben von betroffenen und in die Geschehnisse verwickelten Personen geschildert wurden.
Wo Martin Rivaldi heute lebt und was er tut, soll mit dem Thema hier nichts zu tun haben. Dies gehört zu einer Vereinbarung, die ich mit ihm treffen musste. Er hat sich sowieso nur ungern dem Sog der damaligen Geschehnisse ausgesetzt.
Meine anfänglichen Befürchtungen, bei meinen Recherchen auf Widerstand zu stoßen, haben sich nicht bestätigt. Sicher war es nicht immer einfach, sich durchzufragen, vor allem wenn es um private Zusammenhänge ging. Ansonsten bin ich jedoch niemandem begegnet, der etwas gegen den hier vorgestellten Bericht gehabt hätte. Man kam mir in der Regel mit freundlichem Wohlwollen entgegen und half mir gerne.
Einige Leute habe ich getroffen, die die Hoffnung hegen, durch meinen Bericht konnte in Vergessenheit Geratenes wieder zum Leben erweckt werden. Mir liegt es jedoch fern, eine fest verankerte Legende, die dies ohnehin nicht nötig hat, zu nähren. Ich bin ein Berichtender, im Netz von verschiedensten Aussagen positioniert, die ich möglichst exakt wieder zu geben versuche.
Ich will damit beginnen, einige Namen aufzuzählen, die zusammen einen weiteren Namen ergeben, der noch weitaus mehr mit einer bestimmten Magie behaftet ist.
Diese Namen sind: Jules von Spree, Karl-Friedrich Papst, Dieter Hübsch und Kasimir Manera, vier Musiker, die als DAS ORCHESTER international berühmt wurden.
(Auf die Tatsache, dass vier Musiker in der Regeln ein Quartett bilden und ganz sicher kein Orchester, komme ich später zurück.)
Fünfzehn Jahre lang beherrschte DAS ORCHESTER alle großen Bühnen, sei es in Berlin, Mailand, Paris, London, New York, Tokio oder wo auch immer auf der Welt. Ihre Konzerte waren ausverkauft, die Sonne des Ruhmes prangte mit unverminderter Intensität über den begabten Köpfen dieser vier Musiker.
Wer kennt DAS ORCHESTER also nicht! Und wer kennt nicht die berühmtesten Kompositionen dieser Musiker, wie zum Beispiel: Der Schattenflieger, oder Der Liebe Sprung will wärmend sein, oder das lustige Kuckuckseier brüten schnell, ganz zu schweigen von ihrem Der Verstand in der Nebelwand.
Wenn man damaligen Musikkritikern glauben darf, so fanden sie fast alle übereinstimmend: »Das musikalische Ereignis des Jahrhunderts.« Und das Publikum bezeugte durch ihre oft grenzenlose Bewunderung einstimmig dieselbe Meinung.
Nun möchte ich aber nicht vorgreifen, sondern systematisch dort einhaken, wo alles angefangen hat. Den Anfang einer Sache zu bestimmen ist ja nicht immer einfach, doch in unserem Fall wird er garantiert in den jungen Jahren der Musiker Jules von Spree, Karl-Friedrich Papst, Dieter Hübsch und Kasimir Manera zu finden sein.
So weiß der ehemalige Nachbar der Familie Papst zu berichten, dass Karl-Friedrich seine ersten Kontrabassspielversuche als kaum sechsjähriger an einem mit Draht bespannten Gartenzaun unternommen haben soll.
Solcherlei Angaben sind natürlich schwer nachzuprüfen, und ich hege nicht die Absicht, Zeit mit solch plakativen, aber wenig aussagekräftigen Episoden zu verlieren. Ich betone dies bloß, weil der ehemalige Nachbar der Familie Papst inzwischen über neunzig Jahre alt ist und fast eine halbe Stunde brauchte, um sich überhaupt an Karl-Friedrich zu erinnern. Er ist aber eher eine Ausnahme und leidet offenbar altersbedingt an einem schlechten Gedächtnis.
Und was gibt es aus der Jugend der anderen drei Musiker zu berichten?
Dass der Kesselpaukist Kasimir Manera irgendwelche leeren Benzinfässer bearbeitet haben soll, ist mir nie zu Ohren gekommen. Lassen wir also diese in manchen Biografien für zwingend erachteten Schilderungen, um uns ernsteren Dingen zuzuwenden.
Jules von Spree am Klavier oder Flügel, Karl-Friedrich Papst am Kontrabass, Dieter Hübsch an der Posaune und Kasimir Manera an den Kesselpauken – DAS ORCHESTER in seiner legendären Besetzung.
»Bis auf das Klavier sind dies alles typische Instrumente, die Kindern zu elementarem Ausdruck verhelfen können«, schrieb ein angesehener Psychologe in einer Fachzeitschrift und ergänzte einige Zeilen später: »Dass sich DAS ORCHESTER nach fünfzehn erfolgreichen Jahren in seiner Formation auflöste, lag nicht – wie einige spitzfindige Köpfe vielleicht behaupten könnten – am aufrührerischen und vollkommen ungerechtfertigten Benehmen eines gewissen Martin Rivaldis, sondern vielmehr an der Tatsache, dass Jules von Spree im Gegensatz zu seinen Mitmusikern Papst, Hübsch und Manera beim Klavierspiel keine unsublimierten Tätigkeiten wie Zupfen, Blasen und Schlagen ausüben musste.«
Natürlich habe ich versucht, mit möglichst vielen Leuten zu sprechen, die die einzelnen Mitglieder des ORCHESTER’s privat oder beruflich persönlich gekannt haben.
Ich muss jedoch gleich hinzufügen, dass dies nicht einfach war, denn selbst nach der Trennung des berühmten Quartetts scheint das Management von Carlos Szaloky noch immer seinen Einfluss geltend zu machen, in dessen Bereich offenbar auch die Abschirmung aller Verwandten und Bekannten der Künstler gehört.
Oft blieb mir nichts anderes übrig, als mich auf Aussagen abzustützen, die in Zeitungen und Zeitschriften oder bei Interviews durch Radio und Fernsehen bereits schon einmal veröffentlicht worden waren. Es bleibt jedoch zu bedenken, dass auch dahinter die Filtration des harten Managers Szaloky steckt, der an dem grandiosen Erfolg des ORCHESTER’s stark beteiligt war. Aber dieses Thema soll zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen werden.
In Fachkreisen – vorwiegend bei Musikkritikern und Journalisten – ist immer wieder darüber diskutiert worden, wer der Kopf des ORCHESTER’s war, wobei meistens der Name Jules von Spree fiel. Jedenfalls gilt er offiziell als Gründer des berühmten Quartetts.
Ein wichtiger Punkt in seinem Leben war die Begegnung mit Dieter Hübsch, eine Schulfreundschaft, die anfangs unter einem schlechten Stern stand. Hübsch soll von Spree angeblich mit Masern angesteckt haben, worauf dieser ihn nach seiner Genesung verprügelte. Dabei sei Hübsches erster Posaunenkoffer zu Bruch gegangen. Das Instrument blieb unbeschädigt.
Jules von Spree und Dieter Hübsch versöhnten sich aber bald und trafen sich nach dem Schulunterricht öfters. Zuerst bestand ihr Interesse mehrheitlich darin, die umliegenden Wälder zu durchstreifen, Äpfel zu stehlen und verschiedene, meistens ältere Leute zu ärgern. Von Spree, damals zehn jährig, und Hübsch, damals neun, nahmen das Musizieren nicht so ernst, obwohl insbesondere der autoritäre Vater, Hermann von Spree, großen Wert darauf legte, dass sein Sohn Jules die Klavierstunden einhielt und in seiner Freizeit fleißig übte.
Dieter Hübsch spielte in der örtlichen Knabenmusik, und erlebte dort einen Schock, der ihn noch Jahre beschäftigte.
In seiner Klasse gab es ein Mädchen, das ihm sehr gefiel und in das er sich bald unsterblich verliebte. Um ihr zu imponieren, lud er sie zu einem Konzert der Knabenmusik ein und achtete darauf, dass sie ganz in seiner Nähe neben der Bühne saß. Das Unvermeidliche geschah. Als Hübsch den angesammelten Speichel aus dem Instrument auf den Bühnenboden entleerte, fühlte sich die Angebetete angeekelt und distanzierte sich darauf von ihm. Später hänselte sie ihn zusätzlich mit dem Vorwurf, er habe aufgeblasene Lippen, die zum Küssen vollkommen ungeeignet seien.
Hübsch fing an, seine Posaune zu hassen und beneidete seinen Freund Jules von Spree, der in eleganter Haltung am Klavier sitzen konnte, seine schlanken Finger über die Tastatur gleiten ließ und dabei nichts in den Mund zu nehmen brauchte. Dazu kam, dass Hübsch die Ursache seines Schandmals oft mit sich herumtragen musste, wenn inzwischen auch in einem neuen und wesentlich moderneren Posaunenkoffer. Sein Freund hingegen kam bloß mit einem Stapel Noten unter dem Arm heran stolziert und klappte den Klavierdeckel mit einer lässigen Bewegung auf. Bei so viel Demütigung fasste Dieter Hübsch den Entschluss, schnellstens mit dem Posaunenspiel aufzuhören.
Jules von Spree war es, der Hübsch wieder dazu brachte, die Posaune vom Dachboden zu holen. Hübsch meinte später, sein Freund habe dies nur getan, um ihn bei den Mädchen unbeliebt zu machen und so selber größere Chancen bei ihnen zu haben.
Wie dem auch war, jedenfalls überredete er Dieter Hübsch dazu, wieder zur Posaune zu greifen. Von Spree, dem fantasielosen Gedudel, die ihm seine Klavierlehrerin diktierte, müde, hatte eine erste Eigenkomposition geschrieben, die er mit Hübsch zusammen spielen wollte. Von Spree’s Vater verbot jedoch diese »grauenhafte Katzenmusik« sofort und ordnete gängigere und vor allem »musikalischere« – wie er sich ausdrückte – Kompositionen an.
Die beiden Knaben sahen darin einen Wink des Schicksals, sich in ihrer Freizeit wieder weniger musischen Tätigkeiten zuzuwenden. Allerdings musste Jules von Spree weiterhin streng im Schatten einer unerbittlichen Lehrerin das Klavierspielen üben.
Dieter Hübsch, keinem solchen Druck ausgesetzt, trat erneut aus freiem Willen der Knabenmusik bei. Er achtete aber peinlichst darauf, bei öffentlichen Auftritten seinen Speichel möglichst unauffällig aus der Posaune zu entleeren.
Etwa zur selben Zeit hatte Kasimir Manera seine erste Begegnung mit seinem zukünftigen Instrument, den Kesselpauken.
Es ist wichtig, in diesem Zusammenhang die sozialen Verhältnisse zu erwähnen, aus denen der Musiker entstammt.
Die Maneras sind brasilianische Einwanderer und lebten lange Zeit in einer kleinen, feuchten Wohnung. Der Vater, José Manera, hatte sich als Bergmann versucht, doch seine übermäßige Trinkerei kostete ihn bald den Arbeitsplatz. Als Kasimir sieben Jahre alt war, verstarb sein Vater unerwartet an Herzversagen.
Von da an hatten Frau Manera und ihre vier Söhne ein äußerst schwieriges Auskommen. Oft hungerte die ganze Familie, denn was die stolze und übrigens auch sehr schöne Mutter Manera als Putzfrau bei einer wohlhabenden Familie verdiente, reichte kaum für das Nötigste. Der älteste Sohn, Luis, suchte sich deshalb auf dem Bau eine Arbeit, obwohl er noch ein halbes Kind war.
Was nun das erste Interesse von Kasimir Manera an den Kesselpauken betrifft, so beruht es auf einem Irrtum.
Die wohlhabenden Leute, bei denen Frau Manera sauber machte, luden den kleinen Kasimir eines Tages in ein Konzert ein. In seinen ärmlichen Kleidern muss der arme Spross wohl ziemlich deplatziert gewirkt haben. Und da kam es zu dem besagten und vielleicht alles entscheidenden Irrtum.
Kasimir hielt den Kesselpaukisten für einen Koch, der da in zwei riesigen Kochkesseln Unmengen von Essen umrührte. Der Blick des hungrigen Knaben fraß sich an dem Mann ganz hinten im Orchester regelrecht fest. Die Musik entschwand dadurch seinen Sinnen. Kasimir wollte einzig seinen leeren Magen füllen.
Groß war natürlich die Enttäuschung am Ende des Konzerts, als es nichts zu essen gab und man sich einfach wieder auf den Nachhauseweg machte.
Von da an lag Kasimir seiner Mutter täglich mit dem Wunsch in den Ohren, wieder »zum Koch« gehen zu dürfen, womit er das Opernhaus meinte. Wenn jemand solche Kessel voll Essen kochte, dachte der Knabe, warum sollte er davon nichts abgeben wollen! Leider anerboten sich die wohlhabenden Leute nicht mehr dazu, den Sohn ihrer Putzfrau in ein Konzert mitzunehmen. Und Mutter Manera selbst wusste nicht einmal, wie das Opernhaus von innen ausschaute.
Kasimir hingegen half sich selbst. Eines Nachmittags ging er ganz allein in die Stadt. Sein Entschluss war klar: er wollte »zum Koch«. Nach einigem Umherirren fand der knapp zehnjährige Junge das Opernhaus, dessen vordere Eingänge aber verschlossen waren. Kasimir lief um das protzige Haus herum und schlüpfte durch den Bühneneingang ins Innere.
Jetzt gibt es verschiedene Versionen darüber, was sich dann im Opernhaus abgespielt haben soll. Kasimir Manera selbst hat einmal gesagt, und ich zitiere ihn hier wörtlich: »Zuerst war ich über den Geruch in diesen Räumen erstaunt. Was ein Opernhaus war, wusste ich damals nicht, ich hielt das Gebäude eher für eine Art Hotel, obwohl ich auch nicht genau wusste, was ein Hotel war. Dass ich bei meinem ersten Konzertbesuch nun Musik gehört haben sollte, daran kann ich mich nicht erinnern. Kochgeschirr kann ja auch die verschiedensten Klänge von sich geben. Aus einem dunklen Raum heraus, den ich, mich fürchtend, durchschritten hatte, betrat ich plötzlich eine große Bühne. ›He, was suchst du da?‹, rief mir jemand zu. Es war ein Bühnenarbeiter. Doch meine Augen hatten schon die Kesselpauken, die auf einem zusätzlichen Podest standen, entdeckt.«
An dieser Stelle weichen nun Maneras Aussagen wesentlich von denjenigen des Bühnenarbeiters ab. Manera leugnet nämlich eine weitere Verbindung zu seinem Hungergefühl und seinem früheren Glauben, in dem Instrument zwei monströse Kochkessel gesehen haben zu wollen.
Er fährt fort, wobei ich ihn wieder wörtlich zitiere: »lch spürte einen enormen Drang, dieses Podest zu erklettern. Mein Herz schlug heftig, es gab mir gewissermaßen den Rhythmus vor, der tief in mir steckte. Obwohl ich kaum viel größer als die Kesselpauken war, schaffte ich es, sie mit den beiden Schlegeln zu bearbeiten. Ich fieberte einen Rhythmus aus mir heraus, der mit ohrenbetäubendem Schall in den großen Konzertsaal hinaus drang, und der für mich die ganze Welt auszufüllen schien.«
Soweit also Kasimir Maneras Aussage zu dem Vorfall.
Da ich im Zuge meiner Recherchen mit dem erwähnten und heute bereits pensionierten Bühnenarbeiter gesprochen habe, will ich seine Aussage ebenfalls wortgetreu wiedergeben: »Ja, aus diesem verrückten Bengel ist ein berühmter Musiker geworden. Wenn ich das damals gewusst hatte! Aber was will man machen? Der Junge hatte doch keine Ahnung von Kesselpauken, ich meine damals, und er hielt diese für Riesentöpfe voll Kartoffelpuffer oder so was. Richtig gewehrt hat er sich und um sich geschlagen, wie ich ihn vom Podest herunterholte. ›Hunger, ich habe Hunger!‹, brüllte er, und seine kleinen Hände umklammerten die Schlegel, die er für Umrührkellen oder Schopflöffel hielt. So war das gewesen.«
Jedenfalls schaffte es Kasimir Manera, sich in der folgenden Zeit öfters ins Opernhaus zu schleichen. Die Musiker des SinfonieORCHESTER’s fanden Gefallen an dem zerzausten Jungen und machten aus ihm eine Art Maskottchen. Die Frau des Dirigenten Enno Schneiderhahn brachte allerlei Süßigkeiten mit, und einmal wurde Kasimir sogar in das Haus des Orchesterleiters eingeladen.
»Der Pudding im Hause Schneiderhahn«, sagte Manera Jahrzehnte später in einem BBC-Interview, »schmeckte abscheulich. Sonst unterhielten wir uns gut. Aber mehr konnte ich mit Enno nicht anfangen. Sein Gefühl für den linearen Kontrapunkt war genauso abscheulich wie der erwähnte Pudding.«
Das sind fragwürdige Äußerungen, vor allem, wenn man bedenkt, dass Manera damals keine zehn Jahre alt war. Soviel mir bekannt ist, hat Manera in späteren Jahren Enno Schneiderhahn nur noch ein einziges Mai getroffen, bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Helsinki. Ganz deutlich zeichnen sich hier einige Unklarheiten ab, die ich aber nicht auf die Goldwaage legen mochte.
Seltsamerweise gibt es sehr wenige Anhaltspunkte aus der Kindheit von Karl-Friedrich Papst. Seine Eltern – beide im Lehrerberuf tätig – zerstritten sich unversöhnlich, als ihr einziges Kind achtjährig war. Karl-Friedrich kam zu einer Pflegefamilie, bei der er bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr blieb. Bis heute weiß niemand, wer diese Leute waren.
Als DAS ORCHESTER die ersten Erfolge verbuchen konnte, äußerte sich der leibliche Vater Karl-Friedrich Papsts einmal einer Zeitung gegenüber: »Er (also Karl-Friedrich) war der Grund der Trennung von meiner damaligen Frau. Ohne ihn wäre alles anders verlaufen.« Eine Erklärung zu dieser angeblichen Schuld seines Sohnes kam nie zustande. Und die leibliche Mutter Karl-Friedrichs, die in Helgoland mit einem Kapitän zusammenlebt, hat sich nie mehr gemeldet.
Wie nun Karl-Friedrich als Achtzehnjähriger seine Pflegeeltern verließ, hatte er bloß einen alten Koffer und einen Kontrabass bei sich. So tauchte er plötzlich auf, aus dem Nirgendwo, wenn man so will, und sein erstes Ziel, das er ansteuerte, war das Opernhaus, in dem Enno Schneiderhahn damals als Dirigent wirkte.
Er wollte sich an der Abendkasse eine Eintrittskarte für den auf dem Programm stehenden Rosenkavalier kaufen, doch der Mann am Schalter zeigte auf den unübersehbaren Kontrabass und wies ihn darauf hin, dass Musiker den Bühneneingang zu benutzen hätten.
Karl-Friedrich befolgte diese Anweisung und gesellte sich zu den Musikern von Enno Schneiderhahn.
»Wir bemerkten den jungen Mann zuerst nicht«, erzählte mir Franz Barth, ein ehemaliger Fagottist aus Schneiderhahns Orchester. »Im Gegensatz zu unseren schwarzen Anzügen trug er zwar einen braunen Regenmantel, und da war noch so ein Koffer, teils mit Draht zusammengehalten, den er, nebst dem Kontrabass, bei sich hatte. Die Sache flog eigentlich nur auf, weil kurz vor der Aufführung die Jetons für den Kaffeeautomaten verteilt wurden, bei deren Rationierung der junge Mann natürlich nicht berücksichtigt worden war.«
Karl-Friedrich Papst musste kurzerhand das Opernhaus verlassen und stand somit mit Koffer und Kontrabass wieder auf der Straße.
Schon am nächsten Morgen nahm Papst einen zweiten Anlauf. Nachdem er sich längere Zeit durch heftiges Klopfen an der Tür zum Bühneneingang bemerkbar gemacht hatte, öffnete ihm schließlich eine Frau vom Reinigungspersonal. Karl-Friedrich stürzte an ihr vorbei.
»Da stand plötzlich ein junger Mann im Regenmantel, in der einen Hand einen Koffer, in der anderen Hand einen Kontrabass, in meinem Büro«, erinnert sich der damalige Direktor des Opernhauses. »Er wollte sofort in unser Orchester aufgenommen werden. Ich fühlte mich überrumpelt und ärgerte mich, weil ihn vom Personal niemand aufgehalten hatte, fragte ihn aber trotzdem nach seiner Ausbildung, die er natürlich nicht hatte. Ich meine, er war so oder so viel zu jung. Dazu kam, dass er den Kontrabass ohne Schutzhülle mit sich herumtrug – man muss sich das vorstellen! Er beharrte darauf, mir etwas vorspielen zu dürfen, und in einer wilden Manie entlockte er seinem Instrument haarsträubende Klänge. Schlussendlich mussten zwei gerade im Haus anwesende Statisten eingreifen, um den Verrückten aus unseren Räumen zu entfernen.« Auf die Frage, wie er denn dazu stehe, dass aus Karl-Friedrich Papst trotzdem ein berühmter Kontrabassist geworden sei, antwortete er nur: »Ja, das stimmt.«
Jetzt wurde immer wieder behauptet, Karl-Friedrich Papst und Kasimir Manera hätten sich durch Enno Schneiderhahn im Opernhaus kennen gelernt. Diese Behauptung kann nicht aufrecht erhalten werden, wenn man eine Bemerkung Maneras berücksichtigt, die er bei einer Party im Sheraton Hotel in New York von sich gegeben hat: »Ich glaubte, da liegen zwei und treiben es mitten im Park!«
Diese »zwei« waren Karl-Friedrich Papst und sein Kontrabass, die auf dem Rasen lagen. Als Manera näher kam, entdeckte er den Irrtum. Der junge Mann und das Instrument erweckten sein Interesse. Denn Manera, nun auch knapp achtzehn, hatte es vor drei Jahren geschafft, als Trommler in der Knabenmusik aufgenommen zu werden, und zwar genau in derselben, in der Dieter Hübsch Posaune spielte. Obwohl die beiden schon zu alt für diese Mitgliedschaft waren, machte die permanente Unterbesetzung ihre Mitwirkung weiterhin möglich.
Kasimir Manera nahm den obdachlosen Karl-Friedrich mit zu sich nach Hause. Mutter Manera und ihre Familie begutachteten den Fremden zuerst kritisch, fanden ihn dann aber in Ordnung und ließen ihn bei sich wohnen. Kasimir war arbeitslos, und so verbrachten er und Karl-Friedrich die Tage zusammen. Der Kontrabass blieb dabei zuerst einmal liegen, und an einem kalten Wintermorgen wäre beinah das Unheil geschehen: Mutter Manera wollte das Instrument im Ofen verheizen. »Wenn Karl (sie soll ihn bloß beim ersten Namen genannt haben) hier schon kostenlos wohnen und essen kann«, kommentierte sie ihre Absicht, »so soll er auch seinen Beitrag leisten!« Nur der Überredungskunst Kasimirs war es zu verdanken, dass der Kontrabass nicht im Ofen landete.
Die Idee, Karl-Friedrich in die Knabenmusik einzuführen, scheiterte an der Tatsache, dass dort keine Kontrabassisten gebraucht wurden. Karl-Friedrich zog es sowieso mehr zum Opernhaus hin, wo man ihn natürlich schon an der Tür abwies. Dass Kasimir Manera im Opernhaus auch seine Erfahrungen gemacht hatte, wusste Papst zu diesem Zeitpunkt nicht.
Die Bande schienen geknüpft zu sein. Das Schicksal hatte seine Fühler ausgestreckt und fing, wenn auch noch zögernd, zu ordnen an. Oder wie könnte man es sonst nennen, dass ausgerechnet diese vier Musiker zueinander fanden?
»Eine Art Vorbestimmung muss hier ihr Werk getan haben«, bemerkte ein Kritiker dazu. »Anders kann ich mir ein so dichtes Konzentrat an schöpferischem Potential nicht erklären.«
Längst war es aber noch nicht soweit. Doch der Weg schien vorher bestimmt zu sein, und unaufhaltsam rückte das näher, was Jahre später in die Musikgeschichte einging.