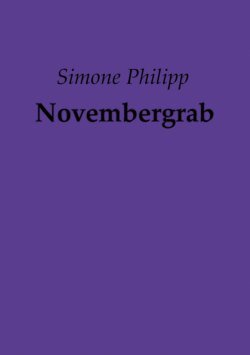Читать книгу Novembergrab - Simone Philipp - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TÖTEN – I. Teil
Оглавление„Nun beeil dich doch bitte ein bisschen!“, drängelte Anna ungeduldig und zappelte aufgeregt mit Armen und Beinen. „Die ersten Gäste kommen bereits.“
Das junge Mädchen schob den Vorhang vor ihrem Fenster beiseite und spähte neugierig in den Hof der Burg hinab, in dem gerade ein kunstvoll verzierter Wagen vorgefahren war. „Vielleicht ist Judith sogar schon da.“
„Herrgott noch mal, immer dasselbe mit Euch!“, schimpfte Maria, während sie sich damit abmühte, ihrer Herrin ein blaues Kleid anzulegen. „Haltet endlich einmal still!“ Sie zerrte den Vorhang wieder vor das Fenster. „Wollt Ihr, dass man Euch von unten halb nackt betrachten kann?“
Vor Wut zog die Dienerin so heftig an den seitlichen Bändern des Gewandes, dass dem Mädchen schier die Luft wegblieb.
„Aua!“ Anna wand sich. „Macht es dir eigentlich Freude, mich immer derart zu quälen?“, fragte sie mit einem nahezu bösen Gesichtsausdruck.
„Ein wenig“, nuschelte die Frau frech. Endlich hatte sie dem Mädchen das Gewand angelegt. Sie zupfte an dem Stoff und glättete die Falten. „Sehr hübsch“, meinte sie anschließend. „Es steht Euch so gut. Ganz zu schweigen von den Stickereien.“ Maria strich beinahe ehrfürchtig über den perlenverzierten Einsatz auf der Vorderseite des Kleides. „Ihr seid wirklich eine Künstlerin.“
Anna zuckte scheinbar gleichgültig mit den Schultern, betrachtete sich allerdings weiterhin im Spiegel hinter dem Waschtisch und als ihr die Dienerin für einen Moment den Rücken zuwandte, um nach Kamm und Haarnadeln zu suchen, zog das Mädchen eine dünne Kette hervor, die hinter der Schüssel verborgen gewesen war. An einem schmalen Lederband hing ein silbrig glänzender Anhänger in Form eines Ahornblattes. Doch Anna kam nicht dazu ihn umzubinden, weil Maria sich plötzlich aufrichtete. Daher verbarg sie die Kette in ihrer linken Hand.
„So? Oder so?“ Die Dienerin hatte das dunkelblonde Haar des Mädchens im Nacken zusammengenommen, wendete es hin und her und deutete verschiedene Frisuren an. „Oder lieber hier oben?“
„Ganz gleich.“ Anna zuckte ein weiteres Mal mit den Achseln. „Du machst das schon.“
Als Maria aber dann begann, die langen Strähnen an ihrem Hinterkopf festzustecken, hob sie ihre rechte Hand und strich einen Teil des Haares über ihre Stirn.
„Was tut Ihr denn da?“, fragte die Dienerin entgeistert. „Ihr bringt ja alles durcheinander.“
„Ist es denn notwendig, dass es ein jeder sieht? Ausgerechnet heute?“ Das Mädchen hantierte weiter an ihrem Kopf, um eine silbergraue Narbe zu verbergen.
Maria verbiss sich ein Grinsen und während sie Annas Haar auf eine andere Weise anordnete, um die Stelle zu bedecken, sagte sie sehr ernst: „Ihr habt Recht, dieses Ding ist wirklich scheußlich und vermutlich auch der Grund, weshalb Eure Mutter keinen Gatten für Euch findet.“
„Meinst du das im Ernst?“ Das Mädchen blickte voller Bestürzung in den Spiegel. „Findest du, es stört so sehr?“
Die Dienerin steckte die letzte Strähne am Hinterkopf ihrer Herrin fest. „Ihr seid ja doch eitel“, meinte sie dann. „Ich glaubte immer, das kümmerte Euch alles nicht. Nun ja, man wird schon noch jemanden für Euch finden, früher oder später. Und mit zwei, drei Mätressen im Hintergrund zum Zwecke der Ablenkung ist sogar der Anblick Eures entstellten Gesichtes für einen Mann halbwegs erträglich.“
Anna wandte sich beinahe wütend um und als sie sah, dass die Frau vor Lachen nicht mehr an sich halten konnte, sagte sie schmollend: „Du bist gemein!“
Maria konnte sich solche Frechheiten, wie das Mädchen dieses allmorgendliche Geschwätz gewöhnlich nannte, nur leisten, weil sie schon so lange auf der Burg beschäftigt war und jeder wusste, dass sie zwar ein loses Mundwerk hatte, aber im Grunde eine herzensgute Seele war.
„Es fällt doch gar nicht weiter auf“, sagte die Frau dann leise und wies auf die Stelle, unter der sich nun die verdeckte Narbe befand. Anschließend zog sie eine lange silberne Kette aus einer Schatulle hervor und wand sie mehrfach um das aufgebundene Haar des Mädchens.
Während Maria damit beschäftigt war, die Utensilien der Morgentoilette beiseite zu räumen und das Nachtgewand des Mädchens zum Lüften vor das offene Fenster zu hängen, nutzte Anna die Gelegenheit dazu, das dünne Lederband mit dem Anhänger um ihren Hals zu binden. Gott sei Dank hatte Anselm die Riemen damals so lang gelassen, dass die Kette vollständig unter ihrem Gewand verschwand. Und tatsächlich hatte in all den Jahren niemand, noch nicht einmal Markus, auch nur eine Spur dieses Geschenkes entdeckt.
„Ist das Mädchen schon bereit?“, erklang wenig später eine harsche Stimme durch die geschlossene Tür.
„Walter.“ Anna verdrehte die Augen. „Warum kann er mir nicht einmal an einem solch wundervollen Tag wie heute erspart bleiben?“
„Ich wette, der Wille Eurer Mutter“, erwiderte Maria leise und laut rief sie: „Ja, sie ist bereit.“
Die Tür öffnete sich, aber der Mann blieb draußen auf dem Gang stehen. Dass er das Zimmer des Mädchens noch niemals betreten hatte, musste Abneigung sein, denn Höflichkeit schien er, zumindest Anna gegenüber, nicht zu besitzen.
„Eure Mutter wünscht, dass Ihr gemeinsam mit mir die ersten Gäste begrüßt“, sagte Walter schroff. „Die Fürstin selbst wird alsbald nachkommen.“
Anna würdigte den Ziehbruder ihres Vaters keines Blickes, stattdessen ließ sie sich von Maria noch ein passendes Armband anlegen.
„Sieht sie nicht entzückend aus?“, fragte die Dienerin dann voller Stolz über ihr eigenes Kunstwerk und ging ein paar Schritte um das Mädchen herum.
Doch Walter knurrte lediglich „Hm“, und sah nicht einmal wirklich nach der Tochter seines engsten Freundes.
Während Anna lediglich den Kopf über seine Herzlosigkeit schütteln konnte, blaffte Maria ihn an: „Euren Anstand habt Ihr wohl im Bett vergessen?“
„Wir müssen los“, brachte der Mann hervor. „Es sind bereits etliche Gäste angereist. Sieh zu, dass das Mädchen fertig wird.“ Sein Blick schien Anna zu streifen. „Für meine Begriffe ist diese Aufmachung schon mehr als ausreichend“, meinte er dann.
Anna seufzte ergeben. „Ich komme“, sagte sie. Es blieb ihr ja doch keine andere Wahl, weil Elisabeth auf die gegenseitige Abneigung, die zwischen ihrer Tochter und dem Ziehbruder ihres Mannes herrschte, noch niemals Rücksicht genommen hatte.
Maria zupfte einige Male an Annas Gewand, prüfte die Festigkeit und den Halt der Frisur und gab dem Mädchen anschließend einen liebevollen Klaps. „Geht!“
Und Anna nickte, wandte sich herum und stob davon, als wäre der Teufel selbst hinter ihr her. So schnell, dass Walter ihr kaum zu folgen vermochte.
„Ich kann diesen Fraß nicht mehr sehen!“ Der Mann schob den Teller mit dem wässrigen Gerstenbrei von sich. „Wenn es nicht bald wieder etwas Ordentliches zu essen gibt, dann …“ Er schüttelte unwillig den Kopf.
Die übrigen Gesellen, die mit ihm am Tisch saßen, stimmten murrend zu. „Sprachen wir nicht unlängst über eine Burg ganz in der Nähe?“, warf einer von ihnen ein.
„Ja, wie steht es mit diesem Hof? Gibt es dort für uns irgendetwas zu holen?“ Einer der Männer fragte mit dröhnender Stimme, so dass seine Worte durch die ganze Halle hindurch zu vernehmen waren. Das Haar hing ihm lang und verfilzt über die Schultern, sein zerrissenes Gewand stank nach Dreck und Schweiß und war mit Sicherheit von Flöhen und Läusen bevölkert. Ein Gesetzesbrecher war er, ganz wie all die anderen, ein Räuber oder gar ein Mörder. Und wie die übrigen Männer war er mit dem Kirchenbann und der Reichsacht belegt und musste beten und hoffen, dass kein Häscher oder Kopfgeldjäger auf seine Spur kam, denn dann erwarteten ihn das Richtschwert oder der Strick.
„Seit Tagen lasse ich jene Burg beschatten.“ Ein kräftiger Mann erhob sich von einem der Tische. Er schien der Anführer des Haufens zu sein oder sich selbst zumindest dafür zu halten. „Sie ist nicht groß, eher eine bescheidene Anlage. Doch der Herr ist vermögend, wir konnten eine Menge guter Soldaten beobachten. Und deswegen …“, er machte eine kurze Pause, „… habe ich noch keine Entscheidung getroffen, ob wir dieses Wagnis eingehen sollen oder nicht.“
„Lasst es uns eingehen!“, rief jener Mann, der das Essen von sich geschoben hatte. „In diesem Loch hier verliere ich noch den Verstand.“
Die anderen bekräftigten seine Worte lauthals. „Und ein paar Frauen hätten wir auch mal wieder notwendig.“ Sie lachten derb.
„Nun.“ Der Führer nickte langsam. Seine Überzeugung hielt sich offensichtlich in Grenzen. „Dann ist es also beschlossene Sache. Morgen Nacht schlagen wir los.“ Er blickte in die Runde. „Wer von euch setzt die Wachsoldaten am äußeren Tor außer Gefecht?“
So sehr die Männer gerade noch mit Begeisterung seinen Worten gelauscht hatten, so beschäftigt schienen sie mit einem Mal. Sie polierten ihre Waffen, banden ihre Stiefel, sahen in die Luft oder starrten gedankenverloren an die Wand.
„Herrgott noch mal!“, schimpfte der Anführer. „Ihr seid nichts weiter als ein Haufen verdammter Feiglinge. Dann mache ich es eben selbst, obwohl ich letztes Mal bereits ...“
„Ich werde es tun.“
Ganz hinten, am Ende der Halle, hatte sich ein Junge mit nahezu weißem Haar vom Boden erhoben. In seiner Jugend und Schönheit wirkte er irritierend und wie ein Fremdkörper unter all dem wilden Gesindel.
„Teufel auch“, stöhnte einer. „Der Küchenjunge hat uns verheimlicht, dass er in Wahrheit ein großer Krieger ist.“ Er lachte verächtlich.
„Hör zu, Herrensöhnchen“, fügte ein zweiter hinzu. „Du kannst uns mehr als dankbar dafür sein, dass wir dich hier aufgenommen haben, anstatt dir die Kehle durchzuschneiden. Halte jetzt lieber deinen vorlauten Mund, ehe wir uns anders entscheiden.“ Mit grinsender Überlegenheit lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück. „Wenn die Männer ausziehen, um Beute zu machen, haben Weiber und Kinder zu Hause zu bleiben.“
„Lasst ihn doch“, sagte ein anderer und mühte sich um Versöhnung, froh darüber, dass einer bereit war, freiwillig die undankbare und gefährliche Aufgabe zu übernehmen, die Soldaten am äußeren Tor auszuschalten. „Wenn er sich unbedingt beweisen will.“
„Beweisen!“, grölte ein vierter. „Im Handumdrehen erwischen ihn die Soldaten und dann? Seht ihn euch an: der hat in seinem Lebtag noch keinen Schmerz ertragen müssen. Einer wie er wird seinen Mund aufmachen, kaum dass sie ihn nur piksen. Und am Ende lassen sie ihn laufen, weil er einer von ihnen ist. Uns aber wird es den Kopf kosten, wenn wir ihn mitnehmen. Hab ich nicht Recht?“
„Das sehe ich ganz genauso“, stimmte ein weiterer zu. „Wir sollten ihm den Hintern versohlen für seine Frechheit, wie einem ungezogenen Kind.“ Und dann sah er zu dem Jungen hinüber. „Glaubst du, wir wissen nichts über euch?“, schrie er ihn an. „Meinst du, wir hätten keine Ahnung davon, dass ihr euch euer angenehmes Leben auf euren feinen Burgen nur deswegen leisten könnt, weil andere für euch arbeiten? Andere, die ihr mit Waffengewalt unter euren Willen zwingt.“ Er spuckte aus.
Der Junge hielt dem Mann stand, ohne den Blick abzuwenden. Seine Augen waren von einem ungewöhnlich durchdringenden Blau. Und das Starren schien den Mann noch wütender zu machen.
„Sieh her!“, brüllte er. Mit einer Hand weitete er den oberen Ausschnitt seines Hemdes und entblößte von tiefen Narben zerfurchte Schultern. „Braucht es noch mehr? Was glaubst du, was die anderen hier erdulden mussten, in euren Verliesen, auf euren Feldern, in euren ...“
„Genug jetzt!“, fuhr einer dazwischen. „Was kann denn der Junge dafür? Lasst ihn in Ruhe! Er soll die Tische abräumen und wir können weiter besprechen.“
Doch einige der Männer schienen nicht zufrieden. „Nein, er soll zeigen, dass er nicht nur ein großes Maul hat!“ Einer von ihnen zog sein Schwert aus der Scheide und warf eine zweite Waffe auf den Tisch. „Wir wollen sehen, was du kannst!“
Der Junge mit dem weißen Haar tat einen Schritt, griff nach dem Heft des Schwertes und schlug dem Mann vor ihm mit einer kaum auszumachenden Bewegung die Waffe aus der Hand. Es war totenstill in der Halle, bis die anderen begriffen hatten, dass der Kampf bereits vorüber war.
„Der Junge wird morgen Nacht mit dabei sein“, sagte der Anführer endlich. „Und ich dulde keinen Widerspruch.“
Als die folgende Nacht hereinbrach, verbargen sich die Männer im Dickicht des Waldes, während sich der Junge mit dem weißen Haar auf leisen Sohlen der Burganlage näherte. Wie ein Schatten fiel er die beiden Soldaten am äußeren Tor aus dem Dunkeln an und schlug sie mit einem großen Stein zu Boden, ohne dabei auch nur ein einziges verräterisches Geräusch zu verursachen. Anschließend sprang er über die Mauer und öffnete von innen die Flügel des Einganges. Die Angreifer drangen auf den Grund und in die Gebäude vor und das Blut der Bewohner floss reichlich von ihren Klingen. Und auch der Junge selbst verstrickte sich in einen heftigen Kampf mit dem Lehnsherrn und einigen seiner Soldaten. Doch als ihm einer der Männer zu Hilfe eilen wollte, hielt ihn ein anderer zurück.
„Sieh dir das an!“, sagte er leise. „Er mag noch ein halbes Kind sein, aber er kämpft besser als selbst der Teufel. Der braucht unsere Hilfe nicht.“
Und die beiden Männer verfolgten staunend aus dem Hintergrund heraus, wie die Soldaten einer nach dem anderen von der Hand des Jungen fielen, bis ihm zuletzt der Herr der Burg allein gegenüberstand. Als dieser zu einem gewaltigen Hieb ansetzte, parierte der Junge den Schlag zur Seite hin und brachte anschließend seinen Gegner durch eine winzige Bewegung seines Fußes zu Fall. Dabei verlor der Lehnsherr seine Waffe, die klirrend über den Boden rutschte.
„Heb’ dein Schwert auf!“, wies der Junge ihn an.
„Ich ergebe mich“, stieß der Mann voller Verzweiflung hervor und zog die Beine unter seinen Körper, so dass er vor dem Jungen auf den Knien lag. „Ich flehe Euch an. Schont mein Leben. Nehmt Euch, was Ihr wollt. Ich besitze Gold … und habe ein paar hübsche Mägde …“
„Dein Gold und deine Weiber kümmern mich einen Scheißdreck!“, schrie der Junge. „Alles, was ich will, ist ein guter Kampf. Also, steh jetzt augenblicklich auf, hol’ deine Waffe und dann kämpfe wie ein Mann, du Feigling!“
Doch der Lehnsherr schüttelte lediglich stumm den Kopf und es war offensichtlich, dass er der Anweisung seines Gegenübers, den Kampf bis zum Tod fortzuführen, nicht nachkommen würde. Da ließ der Junge sein Schwert fallen und zog stattdessen ein Messer aus seinem Gürtel. Er tat einen Schritt nach vorne und fiel dann wie ein Raubtier über den unbewaffneten und am Boden knienden Mann her. Immer wieder stach er auf ihn ein und er ließ auch nicht von seinem Opfer ab, als das Bündel unter ihm nur mehr ein schlaffer Sack war, aus dem das Blut in einer hohen Fontäne aus der durchtrennten Halsschlagader schoss.
Irgendwann rissen die beiden Männer, die sich im Hintergrund des Kampfes gehalten hatten, den Jungen aus seinem Tun und als dieser sich gegen sie zur Wehr setzte, schlug ihm der eine die Faust gegen das Kinn.
„Hör endlich auf!“, brüllte er. „Er ist doch schon längst tot!“
Und der Junge starrte auf den Leichnam unter sich und verharrte eine Ewigkeit auf der Stelle, zitternd vor Berauschung an der Macht des Tötens und durchtränkt von eigenem Schweiß und fremdem Blut.
Bernadette, die löwenstarke, war eine jener Burganlagen, die ihrem Namen alle Ehre machten. Die riesige Festung war bereits vor Jahrhunderten errichtet worden und lag, beinahe unzugänglich, hoch oben auf einem steilen Felsen. Lediglich im Westen führte ein begradigter Weg durch den dichten Wald zum Tor der äußeren und mehr als dreimal mannshohen Ringmauer hinauf, breit genug, dass ein Wagen bequem von einem Doppelgespann Pferden gezogen werden konnte.
Die Burg war seit ihrem Bestehen noch niemals belagert oder gar angegriffen worden. Und dennoch hatte Richard, der Fürst, sich im Gegensatz zu seinem Großvater und Vater nicht darauf verlassen wollen, dass allein Bernadettes Größe und Mächtigkeit alle Gegner abschrecken würden. Stattdessen hatte er zahlreiche Söldner aus allen Teilen des Heiligen Römischen Reiches angeworben.
„Wenn ich mir ansehe, wie nachlässig die meisten Anlagen geschützt sind, dann kann ich mir bei so viel Dummheit nur an den Kopf greifen“, sagte Richard immer wieder zu jedem, der es hören wollte oder auch nicht. „Als ob ein Lehnsherr mit seinen drei oder vier Söhnen, die noch halbe Kinder sind, und seinen plumpen Bauern, die nicht einmal wissen, wie man ein Schwert hält, einen Angriff abwehren könnte. Dann muss der Herr sich auch nicht wundern, wenn er Gesellschaft von irgendwelchen marodierenden Haufen bekommt, die sich weigern wieder zu gehen. Er selbst hat sein Tor ja für sie offen gelassen.“
Der Fürst dagegen hielt eine gewisse Vorsicht für wesentlich angebrachter. Und anstatt auf Gott oder sein Glück zu vertrauen, die ihm wohl hoffentlich beide einen Angriff oder eine Belagerung seiner Burg ersparen mochten, setzte Richard lieber auf die Treffsicherheit seiner Bogenschützen und die mehrfach gehärteten Schwerter seiner Soldaten. „Die Sicherheit der Burgbewohner steht über allem“, konstatierte Richard und meinte damit nicht zuletzt sich selbst und seine Familie. „Auch wenn es mich vielleicht mein halbes Vermögen kosten mag, die Söldner zu bewaffnen.“
Walter lachte stets über solche Worte. „Tatsächlich aber kosten dich die Soldaten nicht nur einen Haufen Geld, sondern auch einen gut Teil deiner Nerven.“
Richard seufzte. „Ja, sie werden mich noch mal ins Grab bringen“, gab er zu.
Der Fürst bot seinen angeworbenen Männern nämlich neben der guten Ausbildung und der hervorragenden Bewaffnung, freie Unterkunft und Essen. Darüber hinaus musste er allerdings auch immer wieder nahezu klaglos ertragen, dass die Soldaten ein verhältnismäßig zügelloses Leben auf seinem Anwesen führten und er ließ sie sich sogar hin und wieder aus seinen gut gefüllten Weinkellern bedienen, nur damit sie bei Laune und auf seinem Grund blieben.
Nicht nur die eigentliche Burganlage, die innerhalb der Ringmauern lag, war riesig, auch das Lehen, das zu Bernadette gehörte, hatte im Lauf der Zeit gewaltige Ausmaße angenommen. Allerdings befanden sich nur wenige Ländereien in unmittelbarer Nähe der Burg selbst und waren gut zu Pferd zu erreichen. Andere lagen weit entfernt, so dass es für Richard bereits vor der Geburt seiner Tochter Anna unmöglich geworden war, sie alle mit Hilfe seiner Frau und seines Ziehbruders selbst zu verwalten und aus diesem Grund immer wieder einzelne Gebiete, Landstriche oder Burgen an nahe stehende Verwandte oder besonders treue Abhängige abgegeben hatte. Doch der Fürst hatte sehr bald feststellen müssen, dass seine neu gewonnenen Vasallen auf ihren Gütern taten, was ihnen beliebte und rasch vergaßen, wer ihr Lehnsherr war. Wenn Richard nicht ab und an selbst nach dem Rechten sah und seinen Abhängigen dabei ihre lediglich übertragene Verantwortung ins Gedächtnis rief, war schon so manches Anwesen verfallen oder die Bauern hatten sich gegen die Ungerechtigkeit und Ausbeutung seitens ihrer Herren erhoben. Da der Fürst aber unmöglich ständig von einem Hof zum anderen reisen konnte, war er schließlich nach dem Rat seiner Gattin darauf gekommen, all seine Vasallen jedes Jahr im Frühling auf seine eigene Burg, nach Bernadette, zu befehlen, damit sie ihm Rechenschaft über ihr Tun auf seinem Grund ablegten. Im Lauf der Zeit hatte sich dieses alljährliche Treffen zu einem großen Fest entwickelt, von den Burgbewohnern auf Bernadette ebenso mit Spannung und Vorfreude erwartet wie von den Gästen, so dass Elisabeth aus diesem Grund immer wieder auch zahlreiche Leute aus ihrer Verwandtschaft einlud, obwohl diese nicht zu den Abhängigen ihres Mannes gehörten.
Weil Richard sich zum Zeitpunkt des Frühlingsfestes in diesem Jahr zum ersten Mal nicht auf seiner Burg befand, hatte die Fürstin nach Bernadette geladen, um an Stelle ihres Mannes die Berichte der Vasallen über die vergangenen zwölf Monate entgegenzunehmen.
Als Anna schließlich an Walters Seite die Stufen vom oberen Stock herunter gestiegen war, erkannte sie, dass sich ein guter Teil der geladenen Lehnsmänner mit ihren Familien bereits eingefunden hatte. Der Tag versprach für die Jahreszeit außergewöhnlich heiß zu werden und daher hatten sich die meisten Gäste bemüht, noch in der frühen Morgenzeit auf die Burg zu gelangen, damit sie zu späterer Stunde nicht in engen und stickigen Wagen sitzen mussten. Viele der Vasallen hatten eine mehrtägige und sehr beschwerliche Reise hinter sich und würden mit ihren Gattinnen und Kindern wohl auch bis zum folgenden Morgen auf der Burg zubringen, weshalb die Fürstin bereits im Vorhinein eine ganze Armee an Dienstkräften bereit gestellt hatte, um die Quartiere einzurichten und den Ankommenden beim Auspacken und Umziehen behilflich zu sein.
Wegen der erwarteten Hitze hatte Elisabeth die große Tafel im Inneren des Gebäudes aufstellen lassen, da wohl keiner der Gäste Wert darauf legen würde, im Freien zu speisen. Doch jetzt, zu noch recht früher Stunde, tummelten sich die meisten draußen im Hof oder dem angrenzenden Garten, begrüßten einander und tauschten Neuigkeiten aus. Das Fest auf Bernadette stellte für viele Verwandte die einzige Gelegenheit im Jahr dar, einander zu sehen und während die Männer den Anlass nutzen, um neues Land, Pferde oder bessere Waffen zu erwerben, schmiedeten ihre Gattinnen Heiratspläne für die Kinder, während sie untergehakt über die Wege schritten und einen Schirm über sich hielten, damit sich ihre weiße Haut nicht bräunte.
Anna dagegen fürchtete die Sonne nicht. Das Mädchen ging unbedeckt, aber notgedrungen in der Begleitung von Walter, von einem zum anderen. Weil sie einen Großteil der Lehnsmänner ihres Vaters allerdings lediglich flüchtig kannte, überließ sie die Begrüßung der einzelnen Gäste dem Ziehbruder Richards, sie selbst fügte nur hier und da ein paar höfliche, aber nichts sagende Worte hinzu. Die beiden hielten sich bei niemandem länger als ein paar Augenblicke auf, damit jedem die ihm gebührende Aufwartung gemacht werden konnte.
Währenddessen spähte Anna heimlich nach allen Seiten, ob sie nicht irgendwo Judith oder eine andere Verwandte, die sie lange nicht gesehen hatte, finden konnte, um auf diese Art und Weise der unliebsamen Gesellschaft Walters zu entkommen. Ihm einfach davon zu laufen, so wie sie es sonst immer tat, wagte sie in der Gegenwart der vielen Gäste allerdings nicht. Doch leider konnte sie weder Judith noch eine andere Verwandte entdecken und so blieb ihr also erst einmal nichts weiter übrig, als die Gegenwart des Ziehbruders und engsten Freundes ihres Vaters zu ertragen. Walter hatte, sehr früh zum Waisen geworden, nahezu sein gesamtes Leben auf Bernadette verbracht und wusste über all die Abläufe Bescheid wie sonst nur der Fürst und die Fürstin selbst. So stand es ihm auch zu, den abwesenden Burgherrn zu vertreten und Elisabeth hatte ihn wohl aus eben diesem Grund darum gebeten, die Gäste zu begrüßen.
„Anna.“ Eine ältere Frau ergriff das Mädchen plötzlich am Arm. „Was für ein wundervolles Gewand Ihr tragt.“ Sie nestelte an dem Stoff herum. „Solch aufwendige Stickereien sah ich zuletzt an einem Kleid der Kaiserin. Wo habt Ihr das erworben?“
Anna wandte verlegen den Kopf zur Seite. „Ich habe es selbst gemacht“, erwiderte sie leise.
„Ihr?“ Die Frau schien beeindruckt. „Sehr reizend.“ Sie ließ das Gewand los. „Würdet Ihr mir wohl etwas Ähnliches für ein Kleid anfertigen?“
„Gewiss.“ Das Mädchen nickte. „Wenn Ihr es wünscht.“
„Vielleicht in Rot und mit Perlen von derselben Farbe.“ Die Frau blickte sinnend vor sich hin.
Anna nickte noch einmal. „Das ist keine Schwierigkeit für mich“, bestätigte sie anschließend erneut.
„Lasst mich wissen, was Ihr dazu braucht und ich werde Euch Garn und Perlen zukommen lassen“, sprach die Frau weiter. „Und Ihr sollt natürlich für Eure Mühen entlohnt werden.“
„Selbstverständlich.“ Es war nicht das erste Mal, dass das Mädchen einen Auftrag von irgendeiner Dame erhielt und natürlich wurde sie immer für ihre Arbeit bezahlt, wenn gleich das Geld, das man Anna schließlich aushändigte, kaum jemals die unzähligen Stunden, die sie an der Stickerei zugebracht hatte, aufwog.
Walter hatte eine Hand an die Schulter des Mädchens gelegt und drängte auf eine eindeutige und unangenehme Weise zum Weitergehen. In diesem Moment entdeckte Anna allerdings, Gott sei Dank, endlich ihre ehemalige Erzieherin Elgita unter den Dienstkräften der Burg und nutzte diese Gelegenheit, dem Ziehbruder ihres Vaters zu entkommen und sich an die Seite der Frau zu stehlen. Walter quittierte das ungehörige Benehmen lediglich mit einem strengen Blick und das Mädchen atmete erleichtert auf, als er schließlich alleine, ohne ihre Begleitung, fortfuhr die Gäste zu begrüßen.
„Anna“, sagte die Erzieherin überrascht und lächelte für einen Moment. Anschließend ließ sie ihren Blick über das junge Mädchen gleiten. „Ihr seht hübsch aus.“
„Danke.“ Annas Verschämtheit war deutlich. „Das ist ganz alleine Marias Werk“, wehrte sie ab. „Ach, da ist sie ja.“ Annas Dienerin war gerade aus dem Eingang des Herrenhauses herausgetreten.
„Maria.“ Elgita hielt die Frau auf. „Ich wollte dich bitten, dafür Sorge zu tragen, dass genügend Dienstkräfte für das Buffet bereit stehen.“
Die Dienerin nickte.
„Die Gäste werden bei diesem heißen Wetter sicher sehr durstig werden“, fuhr die Erzieherin fort. „Lass noch ein paar Fässer Bier und einige Flaschen Wein aus den Kellern holen und in den Schweinetrögen einkühlen. Wir wollen nicht in die peinliche Situation geraten, dass irgendjemand zu wenig bekommt.“ Seit Elgita nicht mehr für die Erziehung ihrer Tochter zuständig war, hatte die Fürstin der Frau die Verantwortung dazu übertragen, die Dienerschaft zu den anfallenden Arbeiten einzuteilen. Diese Aufgabe erledigte sie so gewissenhaft und zuverlässig, dass Elisabeth wohl nicht wusste, was sie ohne Elgita täte. Auch Anna selbst hatte immer noch ein sehr enges Verhältnis zu ihrer ehemaligen Erzieherin und abgesehen von Maria stand ihr keine Dienstkraft so nahe wie Elgita. Allerdings schien diese ihre frühere Tätigkeit und Verantwortung Anna gegenüber nur äußerst schwer ablegen zu können und so gab sie ihrer ehemaligen Schülerin immer noch hin und wieder gut gemeinte Ratschläge, was das Mädchen zu tun und zu lassen hätte. Anna allerdings hörte sich diese Belehrungen meist lediglich geduldig an, ohne sie dann zu beherzigen.
Sehr tief im Wald, jedoch nicht allzu weit von Bernadette entfernt, beugten sich im Keller einer kleinen Burgruine zwei Soldaten über einen Mann, der regungslos auf dem Boden lag. Er trug Spuren von Schlägen im Gesicht und an der rechten Seite seiner Stirn rann unter dem Haaransatz Blut aus einer offenen Wunde.
„Er hat schon wieder das Bewusstsein verloren“, stellte einer der Soldaten fest. Dann wandte er sich um. „Was nun, Herr?“
Sein Herr winkte ab. „Lassen wir das!“, erwiderte er. „Hier kommen wir nicht weiter.“
Die drei Männer verließen den Raum und schritten wortlos durch die halbdunklen Kellergänge. Vermutlich hatten die kühlen Räume zu beiden Seiten einmal vor langer Zeit dazu gedient, Wein oder Vorräte in ihnen zu lagern. Jetzt waren sie allesamt in einem schlechten Zustand mit abgebröckeltem Putz oder brüchigem Mauerwerk.
Schließlich hielten die Männer an und auf Befehl seines Herrn brachte einer der Soldaten einen weiteren Gefangenen herbei, dessen Hände hinter dem Rücken zusammen gebunden waren.
„Ich werde dir ein paar Fragen stellen“, sagte der Herr ruhig.
Die Lippen des Gefangenen zitterten, als er entgegnete: „Ich werde aber keine Antworten für Euch haben.“
Der erste Schlag traf ihn unvorbereitet mitten ins Gesicht. Er unterdrückte den Aufschrei und biss die Zähne zusammen und wenn ihn nicht einer der Soldaten gehalten hätte, wäre er wohl zu Boden gestürzt.
„Gut.“ Der Herr nickte. „Fangen wir an.“
Die Soldaten stießen den Gefangenen in einen der Räume hinein. Und der Herr stellte seine erste Frage. Der Gefangene blickte nicht einmal auf, doch dieses Mal war er darauf gefasst, dass ihn der Eisenhandschuh des Soldaten erneut ins Gesicht treffen würde. Seine Oberlippe platzte auf und das Blut lief ihm über den Mund. Doch er blieb stumm, während der Herr seine Fragen stellte und die Soldaten weiter auf ihn einschlugen.
„Deine Verstocktheit wird dir hier nichts nützen“, sagte der Herr, nachdem er seine Männer zurückgerufen hatte. „Wir verstehen uns nämlich darauf, auch die Schweigsamsten zum Reden zu bringen. Allerdings sehen wir uns auch gerne an, wie lange du durchhältst.“
Der Gefangene starrte weiter auf den Boden. Auf Geheiß seines Herrn trat einer der Soldaten hinter ihn und riss ihm die gebundenen Arme nach oben, so dass der Gefangene laut aufschrie und seinen Kopf zur Erde neigen musste, um dem Schmerz auszuweichen. Dann fühlte er, wie die Männer ein raues Seil um seine Handgelenke schlangen, das über einen Balken an der Decke auf der anderen Seite wieder nach unten verlief. Nur wenig später straffte sich das Seil und der Gefangene wurde vom Boden hochgezogen. Als er etwa einen Fuß weit über der Erde schwebte, verhakten die Soldaten das andere Ende des Seils an der hinteren Wand und ließen ihn hängen. Das volle Gewicht seines Körpers lastete an den nach hinten verdrehten Armen und brachte die Haut an Handgelenken und unter den Achseln zum Aufreißen. Der Gefangene war sicher, ersticken zu müssen und er schrie wie von Sinnen, als seine Oberarme dem Druck nachgaben und aus den Schultergelenken heraus sprangen. Der Schmerz umgab ihn wie ein dichter Nebel, so dass er nichts anderes mehr sehen oder wahrnehmen konnte und voller Verzweiflung betete er um die erlösende Ohnmacht, bis es endlich Nacht um ihn wurde.
Als die Männer das Seil ruckartig von der Wand losrissen und den Gefangenen auf den Boden prallen ließen, erlangte er sein Bewusstsein zurück. Kurz darauf traf ihn die Spitze eines Stiefels mitten ins Gesicht und noch während dem Gefangenen das Blut in den Hals lief, er würgte und hustete, zerrten die Soldaten ihn hoch auf die Knie. Und der Herr stellte eine weitere Frage.
Der Gefangene schwieg und der Stiefel traf ihn erneut mit voller Wucht auf die bereits geschundene Nase. Vor Schmerz sank er vornüber und das Blut rann aus seinem Mund und tropfte auf den Boden unter ihm.
Der Herr jedoch stand ungerührt über dem Knienden und warf einen abschätzenden Blick auf ihn. „Er ist noch nicht am Ende“, stellte er dann fest. „Brecht ihm die Rippen! Eine nach der anderen.“
Zwei der geladenen Lehnsherrngattinnen in Annas Nähe sprachen leise miteinander. „Es ist einfach nicht zu begreifen, weshalb sie sich immer zurecht machen muss wie ein billiges Straßenmädchen!“, ereiferte sich die eine von ihnen und wies dabei verächtlich quer durch den Raum.
Wenige Augenblicke zuvor hatte ein stattlicher Mann mit bereits ergrautem Haar die Große Halle des Herrenhauses betreten. An seiner Seite ging eingehakt eine etwas jüngere Frau, offensichtlich seine Gattin, deren Aufmachung allen gebotenen Konventionen zuwider lief, so dass ihre Erscheinung unmittelbar ins Auge stach.
Anna aber lief freudestrahlend auf die beiden zu. „Heinrich, Isabel“, rief sie glücklich. Dann blickte sich das Mädchen allerdings suchend um. „Wo ist denn Judith?“, fragte sie verwirrt.
„Ach, Anna, meine Liebe.“ Isabel küsste das Mädchen auf beide Wangen und zog sie anschließend ein wenig zur Seite. „Judith lässt dich grüßen. Sie fühlte sich heute nicht. Sie hat ihr Frauenleiden, du weißt schon. Aber ansonsten steht auf Florentina alles zum Besten.“
Isabels Ehemann Heinrich gehörte in weiterer Verwandtschaft zur Fürstenfamilie und weil er selbst mittellos war, hatte ihm bereits Richards Vater vor einigen Jahrzehnten Florentina anvertraut, ein kleines Lehen unweit von Bernadette. Dort lebte Heinrich immer noch, gemeinsam mit seiner Gattin Isabel und den mittlerweile erwachsenen Kindern, obwohl Florentina längst zu klein für die siebenköpfige Familie geworden war.
Isabels und Heinrichs Tochter Judith war eine der wenigen Gäste gewesen, auf die sich Anna ganz besonders gefreut hatte, denn obwohl ihr Bruder Markus derzeit nicht auf Bernadette weilte, war seine Verlobte in den vergangenen Monaten doch sehr häufig von Florentina herüber gekommen und Anna verband mit ihrer zukünftigen Schwägerin mittlerweile eine innige Freundschaft. Doch anstatt plaudernd und tuschelnd mit Judith Arm in Arm umherzuspazieren, musste das Mädchen nun deren Mutter ertragen. Und während sie sich bemühte, ihre Enttäuschung zu verbergen, ließ sie Isabels Redeschwall ohne Erwiderung über sich ergehen.
Auf Dauer war kaum jemand in der Lage, Isabels Mundwerk auszuhalten, dafür aber war sie eine echte Augenweide. Jede der fünf Schwangerschaften hatte ihren Körper mehr und mehr in die Breite gehen lassen, doch sie gab sich nicht einmal die Mühe es zu verbergen. Ganz im Gegenteil. Isabel trug trotz ihrer Fülle und ihres bereits fortgeschrittenen Alters immer sehr freizügige und tiefe Einblicke gewährende Kleider und bedeckte ihr ehemals blauschwarzes, mittlerweile gefärbtes Haar niemals mit einem Schleier, sondern ließ die Strähnen offen wie ein junges Mädchen bis auf ihre Hüften hinab hängen. Durch und durch war sie Südländerin geblieben, ihre Haut immer noch dunkel, selbst im Winter, und auch in Isabels Augen war das Feuer Andalusiens trotz des kalten Nordens, wohin man sie vor vielen, vielen Jahren gebracht hatte, niemals erloschen.
So war es kein Wunder, dass Isabels Erscheinung stets die Blicke sämtlicher anwesender Männer auf sich zog, was so manche Gattin zu einem Schwall hasserfüllter Worte reizte. Und daher wurde auch Anna Zeuge verschiedener Gespräche, als sie Isabel verlassen hatte, um sich einen Becher Wasser zu holen.
„Es ist eine Zumutung für uns alle“, sprach eine der Damen ohne Zurückhaltung und deutete unverhohlen auf Isabels unverschleiertes Haar. „Schließlich ist das hier keine Versammlung von Straßendirnen.“ Sie zupfte bestätigend an dem dichten Tuch über ihrem eigenen Haupt.
„Aus Andalusien soll sie stammen“, erwiderte eine zweite. „Ob das wohl gewiss ist?“
„Und wenn schon!“, winkte eine dritte ab. „Die Sarazenen tummeln sich auch in Andalusien wie die Fische im Meer.“ Sie hob ihre Augenbrauen mit deutlicher Überheblichkeit. „Wenn Ihr mich fragt, hatte da mit Sicherheit einer von ihnen seine Finger im Spiel.“
„Wohl weniger seine Finger…“, gackerte die erste.
An dieser Stelle hätte sich Anna beinahe wutentbrannt in das Gespräch der drei Frauen eingemischt. Es war nicht das erste Mal, dass sie miterleben musste, wie Judiths Mutter aufgrund ihres Aussehens und ihrer Aufmachung eine sarazenische Abstammung angedichtet wurde. Seit vielen Jahrzehnten überschwemmten maurische Krieger, Handwerker und Händler das Heilige Reich und waren vom Südwesten her bis weit in den Norden vorgedrungen. In ihrem Gefolge befanden sich auch zahlreiche Frauen, von denen ein guter Teil als Dienstmägde auf irgendwelchen Burgen arbeitete. Eine legitime Verbindung zwischen einer maurischen Frau und einem christlichen Adelsmann war allerdings etwas Undenkbares, wenn gleich natürlich unzählige Gerüchte über illegitime Verhältnisse von Lehnsherrn zu ihren sarazenischen Mägden kursierten, in denen gar von gemeinsamen Kindern die Rede war. Eine Verbindung zwischen einem Sarazenen und einer Adelsdame, ob legitim oder illegitim, bedeutete allerdings ein Todesurteil für beide. Isabel aber war weder selbst eine Sarazenin, noch war sie von irgendeiner maurischen Abstammung.
Bevor Anna allerdings den Mund öffnen konnte, fühlte sie Marias warme Hand auf ihrem Arm und die Dienerin, der die Erregung des Mädchens nicht entgangen war, zog sie sanft beiseite. „Nicht“, sprach sie leise. „Das ist es nicht wert. Es sind doch lediglich ein paar zänkische Weiber.“
Anna schüttelte den Kopf. „Ich möchte wissen, was ihnen Isabel getan hat, dass sie immerzu auf ihr herumhacken“, antwortete sie. Ihr selbst fiel die ungewöhnliche Art und Weise, auf die sich Judiths Mutter zurecht machte, schon gar nicht mehr auf, weil sie Isabel kannte, seit sie denken konnte.
Maria zuckte lediglich mit den Schultern. „Isabel hat ihnen überhaupt nichts getan. Das ist es ja eben. Es ist der Neid, der diese Damen quält, weil bei ihren Ehemännern der Geifer zu fließen beginnt, kaum dass sie Isabel nur sehen, wohingegen der Anblick der eigenen Gattin jenen Männern kaum noch mehr als ein müdes Gähnen entlocken kann.“ Maria sprach immerzu unumwunden aus, was sie sich dachte.
„Und das Gerede über Isabels angeblich sarazenische Herkunft?“, fragte Anna.
„Zeigt lediglich die Dummheit der Leute“, vollendete die Dienerin. „Sie brauchen immer einen Grund, um sich zu erregen. Und wenn es keinen gibt, nun, dann erfinden sie eben einen.“
Das Mädchen seufzte. „Du hast ja Recht“, gab sie niedergeschlagen zu.
Dennoch war Anna nur schwer in der Lage, die Angelegenheit so einfach abzutun, wie Maria es vermochte. Die Sarazenen mit ihrer dunklen Haut und ihren schwarzen Augen waren für das Mädchen nämlich unheimliche, beinahe angsteinflößende Menschen, wenn gleich sich auch unter Richards Soldaten einige Mauren aus verschiedenen Herkunftsländern befanden. Der Fürst schätzte sie sehr, denn sie waren treue Söldner und verstanden sich hervorragend auf den Umgang mit den unterschiedlichsten Waffen. Ihre Treffsicherheit war weit gerühmt und die Durchschlagkraft ihrer Reflexbögen machte auch noch auf achthundert Schritte eine jede Panzerung nutzlos. Doch auch wenn sich sarazenische Krieger in den Dienst irgendeines Lehnsherrn begeben hatten, blieben sie weitgehend unter sich. Sie sprachen miteinander Arabisch, selbst dann wenn sie nicht alleine waren, und sie praktizierten in aller Öffentlichkeit ihre eigene, fremde Religion, die Anna nicht verstand und über die sie eigentlich auch nichts wissen wollte. So war das beklemmende Gefühl, das das Mädchen den Mauren gegenüber empfand, auch der Grund, weshalb sie Isabel in keiner Weise mit diesen Männern in Verbindung gebracht haben wollte.
„Weißt du“, sprach sie dann leise zu Maria, die, über die lange Tafel gebeugt, die Wasserkaraffen auffüllte, „oftmals sorge ich mich um Judith. Weil Judith doch auch … Was ist, wenn über Judith irgendwann einmal genauso geredet wird wie über ihre Mutter?“
Ihre Dienerin wandte sich um und während sie über das ganze Gesicht grinste, flüsterte sie zurück: „Seid gewiss, diese Sorge ist ganz und gar unbegründet. In Gegenwart Eures Bruders hat noch niemand ungestraft über Isabel herziehen dürfen und bei seiner zukünftigen Frau versteht er diesbezüglich mit Sicherheit überhaupt keinen Spaß.“
Und dann erinnerte Maria ihre Herrin an einen Vorfall vor einigen Jahren, bei dem Markus einem jungen Burschen, der schamlos Isabels Abstammung aus einem andalusischen Adelshaus angezweifelt hatte, ohne Vorwarnung die Vorderzähne ausgeschlagen hatte.
„Komm raus, du Schlafmütze!“ Markus hämmerte mit der Faust von außen gegen die Zimmertür seiner Schwester. „Es gibt einen neuen Jungen auf der Burg. Ich glaube, es ist Elias’ Sohn.“
Wenig später standen Anna, Markus und all die anderen Kinder und Heranwachsenden um den unbekannten Knaben herum. Sie bestaunten und musterten ihn und wollten einfach alles von ihm wissen: „Wie ist dein Name?“, „Wie alt bist du?“, „Und wie viele Geschwister hast du?“, „Kannst du reiten?“, „Oder einen Bogen spannen?“, „Wie viele Pfeile triffst du nacheinander ins Schwarze?“, „Und wie hoch war der höchste Baum, auf den du je geklettert bist?“ So redeten und fragten alle durcheinander und der fremde Junge blickte stumm von einem zum anderen, verunsichert von den vielen unbekannten Kinderaugen.
Weil bereits alle Fragen gestellt worden waren, schwieg Anna und musterte den Knaben lediglich verhalten. Er trug eine einfache, eng anliegende Hose und darüber ein loses Hemd. Beides war offensichtlich frisch gewaschen und ohne einen einzigen Fleck oder Riss, vermutlich damit der Junge an seinem ersten Tag auf der Burg des Herrn einen guten Eindruck hinterließ. Sein Haar hatte die Farbe reifer Kastanien und zwischen den halblangen Strähnen leuchteten ein paar wache Augen hervor, so blau wie der dunkle Himmel an einem heißen Sommertag. Anna schätzte den Jungen zwei oder drei Jahre älter als sie selbst. Die dunkle Färbung seines Gesichtes und seine aufgerissenen Hände verrieten, dass er einen Großteil seiner Zeit auf den Feldern zubrachte, die Richard seinem Vater verpachtet hatte.
„So.“ Elias, der Schmied, trat aus seiner Werkstätte hervor und stellte sich neben den fremden Jungen. „Habt ihr euch schon miteinander bekannt gemacht? Das ist der Anselm, mein ältester Sohn“, sagte er zu den Kindern. „Ich werde ihn von nun an öfter mit auf die Burg nehmen, damit er mir hilft. Jetzt ist er alt genug, um schon ein wenig mit anzupacken und seinem alten Vater zur Hand zu gehen. Nicht wahr, Anselm?“ Der Schmied schlug ihm freundschaftlich auf die Schulter.
„Ja, Vater“, antwortete der Junge gehorsam.
„Nun, dann wollen wir mal.“ Elias wandte sich um.
„Ach, bitte …“, begann eines der Kinder und die anderen fielen augenblicklich mit ein: „Ja, bitte, bitte, darf der Anselm heute mit uns spielen? Nur ausnahmsweise, weil er doch das erste Mal hier auf der Burg ist?“
Der Schmied verzog die Stirn. „Nun, also… gut. Ausnahmsweise heute, weil es der erste Tag ist. Aber ich hab ihn ja mitgebracht, damit er mir hilft und nicht, damit er auf der faulen Haut liegt.“ Er gab seinem Sohn einen kleinen Stoß. „Nun geh schon. Sieh dir alles an, aber sei höflich und …“
Die Kinder hatten Anselm bereits umringt und zogen ihn mit sich fort.
„Soll ich dir erst einmal die ganze Anlage zeigen?“ Markus boxte sich zu dem neuen Jungen durch. „Ich bin der Sohn des Fürsten“, setzte er erklärend hinzu.
„Oh... Verzeiht, Herr, ich …“, stotterte Anselm.
„Ach was.“ Markus winkte ab. „Vergiss das einfach. Zumindest, wenn wir unter uns sind.“ Er musterte den neuen Jungen abschätzend. „Wie alt bist du?“, wollte er dann wissen.
„Zwölf“, erwiderte Anselm.
„Das hier ist meine Schwester Anna.“ Markus zog das Mädchen näher zu sich. „Ihr werdet euch sicher gut verstehen, ihr seid etwa im gleichen Alter.“
Es war kaum mehr als ein Atemzug, den Annas und Anselms Augen ineinander verharrten, und doch brannte sich diese Begegnung im Innersten des Mädchens ein, obwohl sie noch nicht einmal zehn Jahre alt war. Dann rissen die anderen Kinder den neuen Jungen fort, führten ihn durch die gesamte Burganlage, zeigten ihm die Stallungen der Pferde, der Schweine und Rinder, die Hühnergehege, den großen Burggarten, wagten sogar einen kurzen Blick in das Herrenhaus hinein und verrieten ihm schließlich all die geheimen Verstecke, die es hier und dort gab. Und Anselm folgte ihnen bereitwillig und neugierig, nur ein oder zwei Mal sah er sich nach Anna um.
Es war immer wieder aufregend, wenn einer von Richards Abhängigen eines seiner Kinder mitbrachte, damit es ihm bei der Arbeit half. Und weil Anna, solange es draußen hell war, spielen durfte, wo sie wollte und weder Elisabeth noch Elgita ihr je die Nähe zu den Söhnen und Töchtern des Gesindes untersagt hatten, war sie immer mit dabei, wenn ein neuer Junge oder ein neues Mädchen auf der Burg erschien.
„Seht mal, was wir erbeuten konnten!“ Ein paar der halbwüchsigen Burschen waren mit Bogen und Köcher eines unachtsamen oder eingeschlafenen Soldaten des Fürsten aufgetaucht und kicherten stolz vor sich hin. „Nun wollen wir sehen, was der Neue kann.“
Sie markierten ein Ziel an einem der großen Bäume im Burggarten und nahmen dann in einer langen Reihe hintereinander Aufstellung. Anna hielt sich abseits, weil ihre Kraft noch nicht dazu ausreichte, um einen Pfeil einzuspannen.
Anselm dagegen war sehr stark. Es gelang ihm mühelos, die Sehne mit dem Pfeil bis zum Anschlag nach hinten ziehen. Sein erster Schuss allerdings verfehlte den gekennzeichneten Baum um Längen. Als die anderen Kinder lachten, blickte Anna beinahe wütend um sich. Wer von ihnen hatte sich schon bei seinem ersten Versuch besser angestellt?
Dann jedoch trat Markus an Anselms Seite und bemühte sich, dem neuen Jungen mit wenigen Worten die Grundlagen des Bogenschießens begreiflich zu machen. Bereits der dritte Pfeil traf den markierten Baum und Anselm strahlte vor Stolz. Schließlich drehte er sich zu Anna um und lachte sie an und es schien ihr, als würden sie einander schon seit Ewigkeiten kennen.
Elisabeth stand so plötzlich mitten im Raum, als wäre sie aus dem Erdboden aufgetaucht. Gewiss war die Fürstin zuvor von irgendeinem ihrer Soldaten angekündigt worden, doch dessen Worte waren vermutlich im Tumult und den durcheinander sprechenden Gästen untergegangen. Keiner hätte sagen können, auf welche Art und Weise Elisabeth in die Große Halle hineingekommen war. Aber nun stand sie dort und selbst diejenigen unter den Gästen, die die Fürstin noch niemals selbst zu Gesicht bekommen hatten, begriffen augenblicklich, dass jene Frau nur die Herrin von Bernadette sein konnte.
An Elisabeths Gestalt war nichts Außergewöhnliches, nichts was unmittelbar ins Auge stach, ihre Erscheinung konnte bei weitem nicht mit der Schönheit Isabels mithalten. Die Fürstin war eine kleine und sehr zierliche Frau, sie trug ein schlichtes und hoch geschlossenes Kleid ohne jede Verzierung. Noch dazu hatte sie keinerlei Schmuck angelegt und einen dichten Schleier über ihr Haar gezogen. Auf den ersten Blick also wirkte Elisabeth so unscheinbar, dass es kein Wunder gewesen wäre, wenn die Gäste ihre Gastgeberin übersehen hätten.
Doch die Fürstin hielt sich sehr aufrecht und in ihren Augen standen Selbstbeherrschung, Würde und Stolz. Diese Frau war keine gewöhnliche Gattin irgendeines Lehnsherrn, die ihre Zeit tratschend und schnatternd verbrachte. Jede Regung, jede Bewegung, alles an Elisabeth machte deutlich, dass sie ihrem Mann eine ebenbürtige und unentbehrliche Partnerin war, ohne deren Hilfe er nicht in der Lage gewesen wäre, sein Anwesen zu führen. Und so stellte allein Elisabeths Auftreten alle anderen Lehnsherrngattinnen in den Schatten, selbst die strahlende Isabel.
Nach und nach wurde es still unter den geladenen Vasallen und ihren Familien und alle wandten sich der Fürstin zu. Elisabeths glattes, ebenmäßiges und beinahe wie versteinert wirkendes Gesicht ließ keinerlei Aussage darüber zu, ob sie noch jung oder schon alt war. Sie sprach leise ein paar förmliche Worte der Begrüßung zu den Lehnsmännern, die ohne jede Herzlichkeit erklangen. Es war unmöglich zu erkennen, was sie dachte und ob sie sich über ihre Gäste freute oder sie verfluchte.
Die Vasallen erwiderten die Worte der Fürstin mit Höflichkeit, um der Gattin ihres Lehnsherrn die notwendige Ehrerbietung zu erweisen. Doch als Elisabeth begann, von einem zum anderen zu schreiten, um jeden einzeln willkommen zu heißen, wurde alsbald deutlich, dass die Fürstin zu niemandem ein engeres Verhältnis pflegte. Mit keinem sprach sie mehr als ein oder zwei Sätze, wich dabei kaum einmal von der förmlichen Art und Weise ab und verzog den Mund nahezu niemals zu einem Lächeln.
Dennoch kehrten langsam der Trubel und die Lebendigkeit unter die Gäste zurück und sie begannen wieder, sich zu unterhalten, zu scherzen oder auch über die anderen Lehnsleute herzuziehen. Dabei war Isabel nicht die Einzige, die Anstoß erregte. Auch ein Paar in mittlerem Alter zog die Blicke und das Gerede auf sich. Die Frau an der Seite des Vasalls war eine der wenigen Unverschleierten, wenn gleich sie ihr Haar hochgesteckt trug, und sie befand sich bereits deutlich sichtbar in anderen Umständen.
„Es ist unglaublich“, erklang es irgendwo aus dem Hintergrund heraus. „Er wagt es tatsächlich, mit seiner Mätresse hier aufzutauchen.“
Die schwangere Frau wurde blass und ihre Hände krallten sich um den Arm des Mannes neben ihr. Elisabeth aber trat mit einer solchen Selbstverständlichkeit auf die beiden zu, ganz so, als wäre der Vasall mit seiner rechtmäßig angetrauten Ehegattin erschienen.
„Es freut mich, dass Ihr den weiten Weg auf Euch genommen habt, um heute mit uns zusammen zu sein“, begrüßte sie ihn freundlich und weitaus herzlicher als all die übrigen Gäste zuvor. „Und noch viel mehr freut es mich, die Bekanntschaft Eurer reizenden Begleiterin zu machen.“ Die Fürstin nickte der schwangeren Frau zu, die ergeben den Kopf vor ihr senkte. „Offensichtlich ist die Verbindung gesegnet.“ Elisabeth wies mit einer Hand auf den geschwollenen Leib.
Das abfällige Gemurmel im Rücken der Fürstin, von wo aus die Gäste die Szene beinahe atemlos beobachteten, wurde stärker. „Welchen Grund gibt es, die beiden mit einem solchen Wohlwollen zu empfangen?“, erregte sich eine der Damen. „Er soll mit seiner Mätresse gefälligst vor der Tür bleiben und uns nicht mit diesem Anblick belästigen!“
Elisabeth aber wandte sich ruckartig um und warf einen harten und überaus deutlichen Blick nach hinten und einmal quer durch den gesamten Raum, so dass jegliches Flüstern unverzüglich verstummte.
Und dann sagte Isabel deutlich und vollkommen ungeniert in die Stille hinein: „Ach, meine Liebe. Müssen wir nicht alle den Anblick der Bastarde unserer Ehemänner sogar auf den eigenen Burgen ertragen? Wer wird sich also aufregen?“ Dazu lächelte sie honigsüß in Richtung der Dame, die gesprochen hatte, und blickte dann bitterböse zu ihrem Gatten hinüber, der hustend hinter seinem Becher mit Wein verschwand.
„Meine Damen, meine Herren, das Buffet ist eröffnet.“ Nichts schien Elisabeth aus der Ruhe bringen zu können.
Es mochte Zufall sein, dass die Fürstin einen Augenblick später Isabel gegenüber stand und der Mutter ihrer zukünftigen Schwiegertochter den Weg zur reich gedeckten Tafel vertrat.
„Ist es nicht die Wahrheit?“, fragte Isabel leise. „Ich kann dieses Pack und ihre verdammte Heuchelei nicht ertragen.“
Elisabeths Blick war durchdringend. „Nun, dann steht es Euch frei, Euren Wagen richten zu lassen und nach Florentina heimzukehren“, erwiderte sie.
„Ist Euch dieses Geschwätz nicht ebenso zuwider wie mir?“ Isabel suchte die Bestätigung der Fürstin.
„Ich habe die Vasallen meines Gatten nach Bernadette geladen, damit sie mir Rechenschaft über das vergangene Jahr ablegen, nicht damit sie mich mit ihrer Anwesenheit erfreuen“, antwortete Elisabeth jedoch.
Isabel schüttelte voller Unverständnis den Kopf. „Warum habt Ihr Euch das bloß angetan? Ist es nicht Richards Angelegenheit, sich mit unverschämten Lehnsmännern und deren Gattinnen oder Mätressen herumzustreiten?“
„Richards Angelegenheiten sind auch meine“, sagte die Fürstin. „Und ich vertrete ihn, solange er nicht auf der Burg ist. Alles andere kümmert mich nur wenig.“
Isabel schwieg notgedrungen. Schließlich nickte sie kaum merklich mit dem Kopf und ging dann zum Buffet hinüber.
Auch Anna trat an die lange Tafel heran und häufte etliche Köstlichkeiten aus den Schüsseln und Schalen auf ihren Teller. Es war immer dasselbe bei derartigen Festen: besonders die Frauen wussten meist nichts Besseres zu tun, als übereinander herzuziehen und sich abfällig über Aufmachung oder Gehabe der anderen zu äußern. Da es dieses Mal allerdings Isabel getroffen hatte, und noch dazu Judith nicht nach Bernadette gekommen war, hatte sich Annas gute Stimmung getrübt und am liebsten hätte sie sich still und heimlich aus der Großen Halle zurückgezogen. Doch als Tochter der Gastgeberin blieb ihr nichts anderes übrig, als gute Miene zu allem zu machen und weiterhin zu einem jeden freundlich zu sein. Als Anna jedoch das Essen auf ihrem Teller gekostet hatte, hob sich ihre Laune augenblicklich, denn die Köchinnen auf Bernadette hatten sich wieder einmal selbst übertroffen.
Eine junge Frau, die einen kleinen Jungen an der Hand hielt und ein noch jüngeres Mädchen auf einer ihrer Hüften trug, mühte sich unmittelbar neben der Tochter der Fürstin damit ab, etwas von den Speisen auf ihren Teller zu laden. Sie kam Anna trotz des dichten Schleiers irgendwie bekannt vor, so dass sie sie immer wieder verhalten von der Seite her anblickte.
„Bianca!“ Endlich hatte sie die Frau erkannt.
„Ach, Anna.“ Bianca wandte sich herum. „Wie schön dich zu sehen.“
Ihre Worte klangen freundlich, aber unnahbar und auch nicht ganz ehrlich. Und Anna schwieg verwirrt. Vor Jahren hatte Bianca eine Zeitlang auf Bernadette gelebt und war gemeinsam mit der Tochter des Herrn von deren Erzieherin Elgita unterrichtet worden. Damals war sie eine von Annas engsten Vertrauten gewesen und daher gehörten die gemeinsam verbrachten Jahre zu den schönsten Erinnerungen des Mädchens.
„Wie lange ist es wohl her, dass wir uns zuletzt gesehen haben?“, sprach Bianca weiter und schien zu überlegen.
„Beinahe vier Jahre“, erwiderte Anna allerdings sofort. „Bei deiner Hochzeit war es.“
Noch vor ihrem vierzehnten Geburtstag war Bianca von ihrem Vater einem viel älteren Mann versprochen worden. Vermutlich hatte sich der Vater einen seiner Vasallen durch diese Verbindung und eine hohe Mitgift zur Treue verpflichtet oder war durch die Verlobung seines Kindes über Tausch in den Besitz irgendeines Lehens gekommen, das er schon lange hatte besitzen wollen. Bianca hatte die Entscheidung ihres Vaters widerspruchslos hingenommen, doch ihre Augen waren wochenlang rot und verquollen gewesen. Einige Zeit vor der Eheschließung hatte sie Bernadette verlassen, um sich auf ihre zukünftige Rolle als Ehefrau und Herrin eines Anwesens vorzubereiten.
„Wo ist denn dein Gatte?“ Anna blickte sich suchend um. „Du bist doch nicht etwa ohne ihn gekommen?“
„Nein.“ Bianca schüttelte den Kopf. „Dort drüben ist er.“ Sie wies quer durch den Raum. „Der mit dem blauen Hemd, der gerade seinen Becher hebt.“ Für einen Augenblick lächelte sie versonnen.
Anna sah ebenfalls zu Biancas Ehemann hinüber. Er stand auf der anderen Seite des Raumes und ließ sich Wein nachfüllen. Dabei starrte er das junge Mädchen, das ihm den Becher vollgoss, so unverhohlen an, dass es selbst gegenüber einer Magd ungehörig war, und sich Anna fragte, ob Bianca es wirklich nicht wahrnahm oder einfach nicht wahrnehmen wollte. Jener Mann war ihr bereits damals, als sie ihn bei der Eheschließung ihrer Freundin zum ersten Mal gesehen hatte, uralt vorgekommen und auch jetzt war er mit Sicherheit immer noch mindestens doppelt so alt wie seine Gattin.
Mit einem würgenden Gefühl im Hals erinnerte sich Anna daran, wie sie Bianca am Morgen nach der Hochzeitsfeier in aller Früh mit aufgelöstem Haar und weinend vor ihrer Zimmertür gefunden hatte. Erst nach langem und behutsamen Zureden hatte die Freundin mühsam hervorgebracht: „Es war entsetzlich.“ Anna hatte damals lediglich erahnt, was Bianca gemeint hatte, doch aus Angst, irgendwelche grauenhaften Einzelheiten erfahren zu müssen, hatte sie nicht weiter nachgefragt.
„Und wie stehen die Dinge bei dir?“, erkundigte sich Bianca dann. „Wenn ich es recht sehe, bist du immer noch unverheiratet.“ Ihre Stimme hatte einen abfälligen Klang bekommen.
„Ja“, gab Anna zu. „Elisabeth denkt noch nicht an meine Verehelichung. Und eigentlich …“
„Welchen Grund hat die Fürstin dafür?“, fiel ihr die ehemalige Freundin ins Wort und musterte Anna von oben bis unten, offensichtlich auf der Suche nach irgendeinem körperlichen Makel.
„Keinen Grund!“, erwiderte Anna härter als sie es wollte und war froh, dass Maria die Narbe an der Stirn unter ihrem Haar verborgen hatte. „Elisabeth erscheint es lediglich zu früh. Und eigentlich bin ich meiner Mutter überaus dankbar, dass sie noch nicht darauf drängt.“
„Tatsächlich?“ Das Unverständnis in Biancas Gesicht schien nicht nur gespielt. „Also ich würde um nichts auf der Welt jemals wieder tauschen wollen. Erst jetzt habe ich eine Position erlangt, in der ich etwas gelte. Erst jetzt habe ich etwas zu sagen und die Leute hören auf mich.“ Und dann fügte sie so herablassend hinzu, als wäre Anna noch ein kleines Mädchen: „Es ist schon ein ganz anderes Leben, das ich jetzt führe im Gegensatz zu dir.“
Anna starrte betreten auf ihren Teller, den sie während des vorangegangen Gespräches nahezu leer gegessen hatte. Dann sah sie, dass ihre ehemalige Freundin sich wegen der beiden müden und hungrigen Kinder, die an ihr zerrten, immer noch vergeblich bemühte, etwas aus den Schüsseln und Schalen herauszuschöpfen, so dass ihr Anna schließlich den Teller aus der Hand nahm und eine ordentliche Portion für Bianca und den Jungen und das Mädchen zusammenstellte. Die anfängliche Freude, die Anna über das unverhoffte Wiedersehen mit ihrer alten Freundin empfunden hatte, war durch Biancas abweisende Art längst abgeflaut. Nur mit halbem Ohr hörte sie zu, wie jene, während sie nebenbei die Kinder fütterte und sich selbst ab und an einen Bissen in den Mund schob, ohne Pause von nichts anderem als ihrem angeblich erfüllten und glücklichen Leben an der Seite ihres Gatten erzählte. Die Schrecken der Hochzeitsnacht schien Bianca mittlerweile vergessen zu haben, im Gegenteil, es war nicht zu überhören, dass sie sehr stolz auf ihren Mann war, der sogar von seinem Lehnsherrn immer wieder das eine oder andere Landstück für seine Treue erhielt, wie sie selbstgefällig berichtete. Anna allerdings konnte trotz der Lobeshymnen ihrer Freundin immer noch nichts Besonderes an deren Gatten entdecken. Nach ihrem Empfinden besaß er ein deutlich unterdurchschnittliches Aussehen und seine junge Frau, die ihm immerhin zwei Kinder geboren hatte, beachtete er mit keinem Blick.
Anna konnte kaum glauben, dass Bianca mit dem Leben, das sie führte, wirklich zufrieden war. Vermutlich aber war der Freundin nichts weiter übrig geblieben, als sich mit den Tatsachen abzufinden und das Beste daraus zu machen. So unterschied sich Bianca, obgleich sie noch nicht einmal achtzehn Jahre alt war, in nichts mehr von den anderen Gattinnen der Lehnsmänner, die allerdings zwanzig oder gar dreißig Jahre älter als das an sich noch junge Mädchen waren. Aber die beiden Schwangerschaften und ihre Pflichten als Herrin irgendeines Anwesens hatten Bianca erschöpft und auch der dichte Schleier, den sie wie beinahe jede verheiratete Frau trug, und der nicht nur ihr gesamtes Haar, sondern auch einen Großteil ihres Gesichtes verdeckte, ließ das ehemals sehr hübsche Mädchen unscheinbar und wesentlich älter erscheinen, als sie tatsächlich war. Selbst Biancas Körper wirkte alt und seltsam unförmig, bis Anna endlich begriff, dass ihre frühere Freundin bereits erneut ein Kind erwartete.
Die Übelkeit aufgrund der Schwangerschaft und des hastig hinunter geschlungenen Essens stand Bianca im Gesicht, auch wenn sie ohne Pause weiterredete. Anna blickte sich suchend nach allen Seiten um, ob sie nicht irgendwo ein unbeschäftigtes Dienstmädchen entdeckte, das die beiden Kinder für eine Zeitlang übernehmen würde, damit ihre ehemalige Freundin sich ein wenig ausruhen konnte. Von Biancas Ehemann war ganz sicher nichts zu erwarten, denn er schien nicht einmal daran zu denken, seiner Gattin auch nur eines der beiden Kinder für einen Augenblick abzunehmen.
„Jetzt bricht er bald wieder auf“, sagte Bianca plötzlich mit leuchtenden Augen. „Ein ganz großer Auftrag im Dienst des Landesherrn, ist das nicht wunderbar?“
Anna schrak zusammen. Ihre Gedanken waren abgeschweift und sie mühte sich nun, den Faden wieder aufzugreifen, um sich nicht anmerken zu lassen, dass sie ihrer ehemaligen Freundin schon seit geraumer Zeit nicht mehr zugehört hatte. „Dein Ehemann?“, fragte sie nach. Und aus purer Höflichkeit erkundigte sie sich: „Wie lange wird er denn unterwegs sein?“
„Ein halbes Jahr“, erwiderte Bianca.
„So lange?“ Anna riss die Augen auf. „Aber dann wird er ja vermutlich überhaupt nicht in deiner Nähe sein, wenn das Kind zur Welt kommt.“
Die Freundin schien verwirrt. „Ja, das stimmt“, antwortete sie schließlich. „Aber weißt du, er hat doch schon einen Sohn. Und nun … kümmert es ihn auch nicht mehr wirklich, vor allem, wenn es Mädchen sind.“
Anna schwieg.
„Er hat gestrahlt“, sagte Markus jedes Mal, wenn seine Schwester von ihm wissen wollte, was ihr Vater am Tag ihrer Geburt getan hätte. „Ich schwöre dir, Anna, niemals zuvor und niemals danach habe ich Richard so glücklich gesehen wie an jenem Tag.“ Und weil Markus bereits alt genug gewesen war, um sich zu erinnern, musste er Anna immer wieder davon erzählen. Selbstverständlich war der Fürst zu jener Zeit auf der Burg geblieben, in der seine Frau zum zweiten Mal niederkommen sollte. Und er hatte sich niemals in abfälliger Weise darüber geäußert, dass jenes zweite Kind ein Mädchen gewesen war.
Als Anna erkannte, dass sich ihre frühere Freundin kaum mehr auf den Beinen halten konnte, schob sie Bianca einen der Sessel unter und lief dann davon, um Johann, den Medicus, zu holen. Die Tochter der Fürstin beobachtete eine kurze Zeitlang, wie der Arzt der jungen Frau ein Mittel gegen die Schwangerschaftsübelkeit verabreichte und anschließend auch dafür sorgte, dass ein paar Dienstmädchen die beiden müden Kinder niederlegten, ehe sie sich schließlich zurückzog.
„Nimm den Auftrag an!“ Elisabeth ließ das Schreiben mit dem kaiserlichen Siegel sinken und wandte sich zu ihrem Gatten um, der hinter ihr im halbdunklen Zimmer stand.
„Ich bin doch nicht verrückt“, erwiderte Richard und schüttelte unwillig den Kopf. „Diese Unternehmung würde mit Sicherheit viele Monate in Anspruch nehmen und ich war erst … Nein, ich werde ablehnen.“ Der Fürst faltete den Brief zusammen und warf das Schriftstück achtlos auf seinen Schreibtisch.
Elisabeth schwieg einen Augenblick. „Kennst du die Ländereien, die der Kaiser dir als Lehen überlassen will, falls du den Auftrag zu seiner Zufriedenheit ausführst?“, fragte sie leise und begann, die Nadeln aus ihrem aufgesteckten Haar zu lösen.
„Selbstverständlich kenne ich sie“, sagte Richard barsch. „Sind wir nicht einmal gemeinsam dort vorbeigekommen? Damals, als du mich nach Burgund begleitet hast?“
Die Fürstin nickte bestätigend.
„Ich weiß sehr wohl, dass es ein wundervolles Stück Land ist“, sprach ihr Mann weiter, „aber ich habe nicht das geringste Interesse daran. Ich besitze bereits genügend Ländereien, jedes Stück mehr bedeutet auch mehr Arbeit, mehr Verantwortung, mehr Hader, Streit und Zank. Das weißt du doch selbst am allerbesten.“ Er winkte ab. „Nein, das Land verlockt mich ganz und gar nicht.“
„Aber das kann doch unmöglich der Grund sein, weshalb du diesen Auftrag nicht annehmen willst“, antwortete die Fürstin.
„Nein“, gab Richard zu. „Der Grund ist, dass ich einfach keine Lust habe, schon wieder aufzubrechen.“
„Richard!“, sagte Elisabeth mit Nachdruck und trat ein paar Schritte näher an ihn heran. „Du bist dir doch hoffentlich darüber im Klaren, dass dieser Auftrag keine Bitte, sondern ein Befehl ist. Du kannst dich nicht einfach weigern.“
„Nun.“ Er zuckte mit den Schultern. „Einfach wird es sicher nicht. Aber auf irgendeine Art und Weise muss es gelingen. Wie, das überlasse ich ganz dir. Du bist die Klügere von uns beiden, Elisabeth, du wirst das schon machen. Mir ist alles recht, Hauptsache, ich muss nicht aufbrechen. Schreib meinetwegen, dein Gatte hätte sich beide Beine gebrochen oder wäre schwachsinnig geworden.“
„Ach, Richard!“ Die Fürstin verzog die Stirn. Wie erstarrt hielt sie immer noch eine der aufgelösten Strähnen ihres Haares in den Händen.
Er strich sie ihr über die Schultern zurück. „Mein Gott, wie schön du bist“, meinte er leise.
„Du lenkst ab“, erwiderte Elisabeth.
„Ich weiß.“ Richard lachte und ließ sich nach hinten auf das Bett sinken. „Und jetzt kein Wort mehr von diesem verdammten Schreiben!“ Der Fürst griff nach den Händen seiner Frau und zog ihren Körper über sich.
„Es ist also dein Ernst“, fragte Elisabeth später, als sie Richard immer noch in ihren Armen hielt, „dass du den Auftrag tatsächlich ablehnen willst?“ Sie vergrub ihre rechte Hand im Haar auf seiner Brust.
„Ich dachte, wir hätten das bereits geklärt“, erwiderte der Mann schläfrig.
Die Fürstin beugte sich über ihn. „Richard, du weißt genau, dass du überhaupt keine andere Möglichkeit hast, als anzunehmen“, sagte sie beinahe streitlustig. „Wenn du eine solch wichtige Unternehmung ablehnst, wird man dir das seitens des Kaiserhauses mit Sicherheit übel auslegen und argwöhnen, du wolltest dich deiner Verantwortung und Treue gegenüber deinem Herrn entziehen. Jeder weiß doch, dass es eigentlich keinen legitimen Grund gibt, aus dem heraus du dich weigern könntest. Am Ende verlierst du noch deinen Status, den du beim Kaiser besitzt oder er lässt dir gar einen Teil des Lehens aberkennen. Willst du das aufs Spiel setzen? Also, nimm an!“
Richard öffnete langsam die Augen, legte seine Hände an die Wangen seiner Frau und zog sie zu sich hinunter, um sie zu küssen. „Nur, wenn du mich begleitest“, sagte er anschließend leise.
Elisabeth schwieg. „Richard, ich würde nichts lieber tun und das weißt du hoffentlich“, erwiderte sie dann. „Doch dieses Mal ist es mir wohl einfach unmöglich, dich zu begleiten. Gerade jetzt, im folgenden Jahr, stehen so viele Dinge an, dass Walter alleine vollkommen überlastet mit der ganzen Arbeit wäre. Markus ist durch die furchtbare Lungenentzündung immer noch geschwächt und muss sich schonen und Anna …, ja, Anna ist wohl leider noch weit davon entfernt, deinem Ziehbruder in irgendeiner Weise wirklich tatkräftig zur Seite zu stehen. Ich muss hier bleiben.“
Der Fürst nickte langsam. „Ja, du musst hier bleiben“, stimmte er zu. Dann erhob er sich und zog seine Hosen über. Anschließend trat Richard an das kleine Fenster des Raumes unter dem Dach. „Und weil ich aber nicht von dir getrennt sein möchte, schon gar nicht für eine solch lange Zeit, werde ich den Auftrag ablehnen.“ Er sprach ohne sich zu seiner Frau umzudrehen. „Auch auf die Gefahr hin, dass …“
Elisabeth wand eines der dünnen Bettlaken um ihren Körper und trat hinter ihren Gatten. „Wie lange sind wir jetzt verheiratet?“ Sie schwieg und schien nachzudenken. „Nächstes Jahr werden es fünfundzwanzig Jahre sein. Eine solch lange Zeit.“
„Nicht lange genug!“, erwiderte Richard hart.
Die Fürstin legte ihre Hände auf seine nackten Schultern. „Was sind schon ein paar Monate?“, fragte sie leise. „Wir waren doch schon so oft getrennt.“
„Das ist es ja eben“, fiel Richard ihr ins Wort und wandte sich ruckartig um. „Wir waren schon so oft getrennt in all den Jahren. So oft. Und nun will ich einfach nicht mehr. Ich will nicht noch einmal aufbrechen müssen, irgendwohin in die Fremde, wo ich nicht weiß, was mich erwartet. Ich bin nicht mehr jung und du auch nicht. So viele Male musste ich auf Wunsch oder Befehl meines Herrn aufbrechen und nun will ich endlich einmal in Ruhe hier auf meinem eigenen Anwesen bleiben und mich meinen Pflichten als Burgherr widmen. Schließlich gibt es auch auf Bernadette genug für mich zu tun. Ist das zu viel verlangt?“
„Es wäre sehr dumm, wenn wir auch nur einen Teil unseres Lehens verlören, nur weil du dich stur stellst“, erwiderte die Fürstin. „Auch ich möchte nicht von dir getrennt sein, aber ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, als dass du annimmst. Und wenn du erst einmal einen Auftrag von einer solchen Wichtigkeit zufrieden stellend ausgeführt hast, dann kannst du guten Gewissens darum bitten, aus dem Dienst des Kaisers entlassen zu werden. Auf diese Art und Weise müsstest du nie wieder aufbrechen und niemand wird deswegen argwöhnen, du wolltest dich deiner Verantwortung gegenüber deinem Herrn entziehen. Wäre dies nicht das, was du willst? Was wir beide wollen?“ Sie blickte ihren Mann geradewegs an. „Haben wir nicht immer davon geträumt, wirklich zusammen sein zu können, ohne Unterbrechung? Wer weiß, wie viele Jahre uns noch bleiben, ehe einer von uns …“
Elisabeth griff nach Richards Händen und zog ihn zu sich. „Bitte, Richard, nimm an. Riskiere nicht, in Ungnade zu fallen. Und wenn du zurückkehrst, dann wird Markus so weit sein, dass er Bernadette gemeinsam mit Judith übernehmen kann, Anna wird alt genug sein, um zu heiraten, und wir beide können uns ruhigen Gewissens auf irgendeines unserer kleineren Besitztümer zurückziehen, so wie wir es seit Jahren geplant haben.“
„Und das neue Land?“, fragte er leise. „Du weißt genau, dass neue Ländereien immer sehr viel Arbeit erfordern, bis alles seinen gewohnten Gang geht. Noch dazu, wo es so weit entfernt von hier ist.“
„Dann finde einen Regenten, der das Lehen für dich verwaltet“, schlug die Fürstin vor.
Richard allerdings schüttelte entschieden den Kopf. „Du weißt, wie viel Ärger ich mit meinen Vasallen habe. Ich habe gewiss kein Interesse an noch einem weiteren!“
„Dann setze jemanden ein, dem du bedingungslos vertrauen kannst.“
Richard seufzte. Sein Widerstand war nahezu gebrochen „Und wer ist deiner Meinung nach vertrauenswürdig?“, fragte er.
„Einer von Judiths Brüdern“, erwiderte Elisabeth nach einem kurzen Zögern. „Ihr Vater ist bereits dein Vasall, im Übrigen ein sehr treuer und zuverlässiger.“
„Das stimmt.“, gab der Fürst nuschelnd zu.
„Der Älteste wird irgendwann Florentina von Heinrich übernehmen, aber all die anderen sind noch ohne Besitz. Isabel gestand mir einmal, dass Heinrich und sie sogar fürchten, ihre Söhne würden eines Tages anfangen, einander nach dem Leben zu trachten, nur um an das winzige Erbe zu gelangen, das kaum für den Ältesten ausreicht. Wenn du nun einen oder gar mehrere von ihnen mit einem eigenen Land versorgst, gewinnst du mit Sicherheit sehr treue Vasallen, die es niemals wagen werden, sich gegen ihren Herrn, der darüber hinaus auch noch der Ehegatte ihrer eigenen Schwester ist, zu erheben. Und du hättest auf diese Art keine vermehrte Arbeit mit dem neuen Land.“
Richard erwiderte den Blick seiner Frau. „Weißt du eigentlich, wie sehr ich es hasse, dass du immer mit mir streiten musst?“, fragte er. „Selbst, wenn du Recht hast…“
„Markus könnte dich begleiten, wenn du nicht alleine reisen willst“, sagte die Fürstin nach einer kurzen Pause. „Sicher ist es nicht unmöglich, den Aufbruch um zwei oder drei Monate hinauszuzögern, damit er noch weiter zu Kräften kommen kann. Er scheint mir still und verändert durch die vielen Wochen, die er im Bett zubringen musste. Eine solche Unternehmung wird ihm mit Sicherheit sehr gut tun.“
„Und die geplante Eheschließung mit Judith?“, erwiderte Richard. „Sollen wir sie wirklich noch einmal aufschieben? Es wird allmählich Zeit. Das Mädchen ist bereits achtzehn Jahre alt.“
Elisabeth zuckte mit den Schultern. „Ein paar Monate mehr oder weniger sind doch vollkommen belanglos“, meinte sie ungerührt. „Wir verschieben die Heirat. Und ich werde mich in der Zeit eurer Abwesenheit gemeinsam mit Isabel darum kümmern, dass alles bereit ist und die Eheschließung so bald wie möglich vollzogen werden kann.“ Die Fürstin blickte zu Boden. „Das heißt also, du wirst den Auftrag annehmen?“, fragte sie schließlich leise.
Richard nickte. „In Gottes Namen werde ich annehmen und gemeinsam mit Markus aufbrechen.“
Nach ihrer Begegnung und der unbefriedigenden Unterredung mit ihrer ehemaligen Freundin Bianca war Annas Laune auf dem Tiefpunkt angelangt. Um sich aufzuheitern, trat sie noch einmal an die lange Tafel heran und kratzte die letzten Reste aus den Schüsseln und Schalen zusammen. Viel war nicht übrig geblieben.
„Wollt Ihr das?“ Maria trat an die Seite des Mädchens und streckte ihr zwei oder drei mit Honig glasierte Hühnerbeine auf einem kleinen Holzbrett entgegen. „Ich hab es nicht angerührt. Meine Augen waren wieder einmal größer als mein Magen. Und nun kann ich einfach nicht mehr.“ Sie hielt sich den Bauch.
„Ja, warum nicht?“, erwiderte Anna achselzuckend und fasste nach der Platte. „Von denen habe ich bislang sowieso noch keines gekostet… Die Gäste waren nämlich schneller als ich.“
„Nun, da hatten die Gäste dieses Jahr wohl großes Glück“, grinste Maria. „Ansonsten war nämlich Euer Bruder immer schneller als alle anderen.“
Anna musste ebenfalls lachen. „Ja, da hast du Recht“, gab sie zu.
„Also, lasst es Euch schmecken“, sagte ihre Dienerin, ehe sie sich beeilte, um den Küchenmägden beim Abtragen des Geschirrs behilflich zu sein.
Seit jeher hatte Markus essen können wie ein Stier, besonders aber in den Jahren seiner ausgehenden Jugend. Damals stürzte er sich ohne Rücksicht über die Schalen und Schüsseln, kaum dass diese aus der Küche heraus getragen worden waren. Und weil der Sohn des Fürsten, wie es so seine Art war, auch auf Festlichkeiten keine Zurückhaltung kannte, war für die anderen Gäste von den besten Köstlichkeiten oftmals nicht mehr allzu viel übrig geblieben.
Als ihn sein Vater Richard einmal wegen dieser Frechheit zur Rede stellte, erwiderte Markus lediglich: „Ich muss so viel essen, ansonsten habe ich keine Kraft zum Kämpfen.“
„Das Leben besteht nicht nur aus Kämpfen“, wies der Fürst seinen Sohn zurecht.
„Was denn noch?“, fragte Markus unschuldig und war bereits aus dem Raum hinaus, noch ehe sein Vater ihn zur Rechenschaft ziehen konnte.
Während Anna ein glasiertes Hühnerbein nach dem anderen verspeiste und die köstliche Soße mit ein paar übrig gelassenen und mittlerweile angetrockneten Brotkanten auftunkte, wünschte sie so sehr wie schon lange nicht mehr, dass ihr Bruder endlich nach Bernadette heimkehren mochte. Markus hätte es mit Sicherheit verstanden, sie aufzuheitern und wäre es nur dadurch, dass er ein paar derbe Späße auf Kosten der Gäste gemacht hätte.
Der Sohn des Fürsten war nicht auf den Kopf gefallen und leider noch weniger auf den Mund und so redete er, was immer ihm in den Sinn kam und war ohne Schwierigkeiten dazu in der Lage, eine ganze Festgesellschaft zu unterhalten. Die Gäste, von denen die meisten Markus nur hin und wieder erlebten, lachten über den Unsinn, den er zum Besten gab und dass der Sohn des Fürsten dabei auch ab und an über die Stränge schlug und ein wenig unverschämt wurde, nun, das verziehen sie ihm gerne. Dies mochte nicht zuletzt daran liegen, dass Markus das Gesicht eines Engels und den Körper eines Gottes besaß und es ihm, im vollen Bewusstsein dieser Tatsachen, ohne Mühe gelang, Frauen wie Männer gleichermaßen zu bezaubern. Diejenigen allerdings, die ihn besser kannten oder die sogar gezwungen waren, enger mit Markus zusammenzuarbeiten, wussten, dass der gutaussehende Sohn des Fürsten in Wahrheit ein launischer, jähzorniger und unbeherrschter Mensch war, dem man besser aus dem Weg ging, wenn man nicht Gefahr laufen wollte, mit einem blau geschlagenen Auge oder ein paar Zähnen weniger heimzukehren.
Auch Anna konnte sich an zahlreiche Gelegenheiten erinnern, bei denen es Streit unter den jungen Burschen auf der Burg gegeben hatte und wenn diese Auseinandersetzungen gar in Prügeleien geendet hatten, dann war ihr Bruder Markus gewiss in erster Reihe mit dabei gewesen. Mit seiner Schwester verband den Sohn des Fürsten jedoch ein außergewöhnlich enges Verhältnis und so sorgte er bei Festlichkeiten stets dafür, dass Anna nicht irgendwo alleine herumstand, sondern nahm sie mit sich, wenn sich die Heranwachsenden in eine Ecke des Burggartens zurückzogen, um ungestört miteinander scherzen und trinken zu können. Selbstredend war Markus nicht nur der, der die derbsten Scherze zum Besten gab, er war auch einer von denjenigen, die am meisten tranken und er schüttete den Inhalt so manches Bierkruges in sich hinein, bis er nicht mehr wusste, wie er hieß. Wenn Anna dann allerdings meinte, es wäre Zeit zu Bett zu gehen, ließ er sich widerstandslos von ihr zum Herrenhaus hinüber führen.
„Warum musst du immer so viel trinken, du verdammter Idiot!“, schimpfte sie jedes Mal, während sie die Tür zu Markus’ Zimmer hinter ihnen schloss. „Du kannst ja nicht einmal mehr ordentlich gehen.“
Ihr Bruder lachte lediglich. Doch dann umschloss er ihre Hand. „Bleib, Anna!“, sagte er leise und zog das Mädchen näher zu sich. „Schlaf bei mir. So wie früher.“ Auf solche Art und Weise sprach der Sohn des Fürsten lediglich, wenn er getrunken hatte, und am folgenden Morgen tat er immer so, als könnte er sich an nichts erinnern.
Das Mädchen schüttelte jedes Mal den Kopf. „Du weißt doch, dass das nicht möglich ist.“ Sie entzog ihm ihre Finger. „Ich würde schrecklichen Ärger bekommen. Und du furchtbare Prügel.“
Markus ließ sich auf sein Bett fallen. „Und du weißt genau, dass mir das vollkommen gleichgültig ist“, antwortete er.
„Aber mir nicht.“ Damit verließ Anna das Zimmer ihres Bruders.
Das letzte Hühnerbeinchen blieb dem Mädchen beinahe im Hals stecken und sie spülte es mit einem Schluck Bier hinunter. Schon lange war die Sehnsucht nach Markus nicht mehr so übermächtig gewesen. Und weil sich der Großteil der Gäste bereits in alle Richtungen zerstreut hatte und keiner mehr Annas Anwesenheit zu benötigen schien, dachte sie mehr und mehr daran, einen kurzen Ritt in den Wald zu wagen.
„Was tust du denn da, Maria?“, lachte Isabel und trat neben die Dienerin, die bis vor wenigen Augenblicken noch in ein mehr als vertrauliches Gespräch mit einem der angereisten Kämmerer vertieft gewesen war.
Die Frau zuckte lediglich mit den Schultern. „Ich habe nicht vor, heute Nacht alleine zu schlafen“, antwortete sie dann unumwunden. In Marias Bett lag immerzu irgendein Mann. Manchmal jede Nacht ein anderer, manchmal über ein paar Wochen hinweg derselbe. Doch niemals ergab sich daraus etwas Festes und Dauerhaftes und womöglich lag eben solches auch überhaupt nicht in Marias Interesse.
„Und dieser Mann gefällt dir tatsächlich?“, erkundigte sich Isabel stirnrunzelnd und wies ihm hinterher.
„Nun ja.“ Maria schien verlegen. „Eigentlich gefällt er mir am besten, dort drüben.“ Sie zeigte verhalten auf einen anderen der zahlreichen Kammerdiener, die ihre Herren zum Frühlingsfest begleitet hatten. „Aber das ist wohl aussichtslos, denn er hat nur Augen für sie!“
Ihr Blick glitt abschätzig über eine Dienstmagd, die dem Mann gerade sein Weinglas auffüllte. Die Frau war außergewöhnlich schön. Ein schwarzes Stirnband hielt ihr halblanges, rötlichblondes Haar zurück, damit es sie während der Arbeit nicht störte. Ihr Gesicht war ebenmäßig, mit hohen Wangenknochen und hervorstechenden, tiefgrünen Augen. Dazu trug sie ein passendes Kleid aus grüner Seide mit aufwendigen Stickereien am tief sitzenden Ausschnitt, alles andere als die gewöhnliche Arbeitsbekleidung einer einfachen Dienstmagd. Der Kämmerer hing an ihren Lippen und lag ihr beinahe zu Füßen, während sie ihn jedoch mit grober Abweisung behandelte.
„Was willst du?“, fragte Isabel ohne Verwunderung. „Sie ist mindestens zehn Jahre jünger als du.“
„Was soll das denn heißen?“, erkundigte sich Maria voller Entrüstung. „Bin ich etwa nicht …?“
„Gewiss, gewiss“, gab ihr Isabel Recht. „Wer ist sie überhaupt?“, wollte sie dann wissen.
Maria winkte ab. „Irgendeine Erika“, erwiderte sie. „Was weiß ich, woher. Seit ein paar Monaten ist sie auf Bernadette beschäftigt und es ist ihr bereits in so kurzer Zeit gelungen, allen Soldaten den Kopf zu verdrehen. Also, wenn Ihr mich fragt …“ Die Augen der Frau verengten sich zu Schlitzen. „… sollte man sie zum Teufel jagen. Sie verdirbt mir nämlich alles.“
Isabel lachte aus vollem Hals. „Ach, Maria“, sagte sie mit unüberhörbarem Spott in der Stimme, „du bist doch noch niemals leer ausgegangen, oder?“
„Na ja“, gab die Dienerin zu und war schon wieder halbwegs versöhnt. „Da halb Ihr wohl Recht.“
„Kannst du eigentlich all die Männer, die je in deinem Bett gelegen haben, noch zählen?“, wollte Judiths Mutter dann wissen.
„Nun, lasst mich einmal nachdenken.“ Maria schien allen Ernstes zu überlegen. „Nein.“ Sie schüttelte den Kopf. „Ich muss passen. So weit kann ich nämlich überhaupt nicht zählen.“ Sie grinste frech.
Isabel blickte zu Boden. „Ich beneide dich um deine Freiheit“, sagte sie leise.
„Freiheit“, wiederholte Maria. Dann zuckte sie mit den Schultern. „Ich nutze lediglich die Gelegenheiten, die sich mir bieten.“
„Für mich gibt es keine Gelegenheiten“, antwortete Isabel bitter. Dann sah sie um sich und fing einige der Blicke auf, die sich seit Stunden ohne Unterlass auf sie richteten. „Eigentlich wäre alles so einfach, nicht wahr? Aber wenn man mich in den Armen eines anderen Mannes entdeckte …“ Sie brach ab. „Ich will gar nicht darüber nachdenken.“ Isabel ließ sich auf einen der Sessel nieder. „Habe ich dir schon erzählt, dass ich plane, im nächsten Jahr nach Andalusien zu reisen?“, sprach sie dann vollkommen unvermittelt weiter.
„Wie schön.“ Maria lächelte. „Das freut mich für Euch. Vermisst Ihr Eure Heimat?“
„Ja“, gab Isabel augenblicklich zu. „Obwohl ich bereits seit über dreißig Jahren hier oben lebe, denke ich noch immer sehr viel an den Süden. Der Norden ist kalt. Und damit meine ich nun nicht nur das Wetter.“ Judiths Mutter warf einen deutlichen Blick auf Elisabeth, die in ein Gespräch vertieft, auf der anderen Seite des Raumes stand. „Ich kann bei Gott nicht sagen, dass ich unzufrieden wäre mit der Familie, in die meine Tochter in Kürze einheiraten wird.“ Isabel senkte die Stimme. „Oh nein, ich bin sogar äußerst zufrieden, denn auf diese Art und Weise muss ich mir um Judiths Zukunft keine Gedanken machen und weiß, dass wenigstens mein Mädchen gut versorgt sein wird. Aber ich bin froh und dankbar dafür, dass Markus ein so herzlicher und offener Mensch ist, ganz wie sein Vater! Käme er nämlich nach seiner Mutter, dann müsste ich mir ernsthaft Sorgen um das Wohl meines lieben Kindes machen.“
„Ja, Elisabeth ist ein wenig unzugänglich“, gab auch Maria zu.
„Hart und gefühllos ist sie!“, fiel Isabel der Frau ins Wort. „Wie ein Stein.“ Sie schüttelte den Kopf. „Oft genug habe ich mich schon gefragt, wie Richard eine solche Frau an seiner Seite ertragen kann und es ist mir eigentlich auch unbegreiflich, weshalb die beiden einander so nahe stehen, wenn gleich sie doch kaum verschiedener sein könnten.“
Maria hob die Schultern. „Möglicherweise gibt sich Elisabeth ganz und gar anders, wenn sie mit ihrem Mann alleine ist. Wer will das schon wissen?“
Isabel schwieg einen Augenblick. „Ich kann für Richard nur hoffen, dass es sich so verhält“, sagte sie dann.
Im Verlies der Ruine im Wald hing der Gefangene kraftlos in ein paar Eisenketten an der Wand. Sein Gesicht war nur mehr eine blutige Masse und auch sein Hemd war bereits vollständig durchtränkt.
Einer der Soldaten trat einen Schritt zurück. „Er wird seinen Mund nicht aufmachen, solange wir ihn nicht härter anfassen“, sagte er.
Sein Herr bedachte den Gefangenen mit einem abschätzenden Blick.
„Lasst uns die Eisen zum Glühen bringen und in ein paar Augenblicken werdet Ihr alles erfahren, was Ihr wissen wollt“, fügte der andere Söldner hinzu.
„Noch nicht“, antwortete der Herr. „Macht weiter!“, befahl er dann. „Ins Gesicht und auf die gebrochenen Rippen.“ Er wandte sich um. „Ich komme zurück.“
Der Herr schloss die Tür des Verlieses hinter sich. „Holt den anderen!“, wies er zwei seiner Soldaten an.
Sie gehorchten und kehrten bald darauf mit jenem Mann zurück, der vor nicht allzu langer Zeit unter der Behandlung der Soldaten das Bewusstsein verloren hatte. Sein Haar war blutverklebt und seine Kleider dreckverkrustet. Sie zwangen ihn, vor der Tür des Verlieses stehen zu bleiben. Jedem dumpfen Schlag aus dem Inneren folgte ein Aufschrei voller Qual.
„Jetzt, da Ihr bei wachem Verstand seid“, sagte der Herr schließlich, nachdem er eine ganze Weile mit Ruhe zugesehen hatte, wie der Mann bei jedem Schlag zusammenfuhr und bei jedem Schrei erzitterte, „werdet Ihr mir sicherlich meine Fragen beantworten wollen, nicht wahr?“
„Und wenn nicht?“, erwiderte der Mann voller Verzweiflung.
„Dann lasse ich Euch zusehen.“ Der Herr winkte einen seiner Soldaten herbei.
„Nein!“, entfuhr es dem Mann, noch ehe eine Hand an die Eisentür gelegt worden war. „Ich flehe Euch an, beendet diese entsetzliche Quälerei.“
„Nicht bevor Ihr Euch bereit erklärt habt, alle meine Fragen zu beantworten.“ Der Blick des Herrn war eiskalt.
Der Mann wich ihm aus. „Ich traue Euch nicht“, sagte er. „Wie kann ich Euch trauen?“
Der Herr verzog den Mund zu einem harten Lächeln. „Ich will Euch einen Eid leisten auf das Allerheiligste, das es in meinem Leben gibt, und ich bin sicher, dass es Euch überzeugen wird. Ich schwöre Euch also bei meiner Mutter, meiner lieben, dass ich das hier …“, er klopfte mit der Handfläche gegen die Verliestür, „… augenblicklich abbrechen lasse, sobald Ihr bereit seid, meine Fragen zu beantworten.“
Der Mann schüttelte den Kopf. „Oh Gott, vergib mir!“, sagte er dann leise und holte tief Luft. „Also, was wollt Ihr wissen?“
„Wohin begebt Ihr Euch?“ Walter vertrat Anna den Weg.
„Nur ein paar Schritte durch den Garten“, murmelte das Mädchen vor sich hin.
„Tatsächlich?“ Mit gespieltem Unglauben wandte er den Blick und sah zu den Stallungen der Pferde hinunter, die etwas tiefer und näher zum Tor der inneren Ringmauer lagen und zu denen Anna auf dem Weg gewesen war. „Haltet Ihr es nicht für Eure Pflicht, während des Festes auf der Burg anwesend zu sein?“
Die Tochter der Fürstin mühte sich, wortlos am Ziehbruder ihres Vaters vorüberzugehen, aber Walter griff nach ihrem Arm und hielt sie zurück. „Ihr benehmt Euch wie ein verzogenes Kind!“, fuhr er das Mädchen an. „Was werden wohl die Gäste denken? Und Eure Mutter?“
Anna schwieg trotzig und zuckte lediglich mit den Schultern, bis Walter sie schließlich kopfschüttelnd an sich vorbeiließ.
Während das Mädchen weiter zu den Ställen hinab ging, ärgerte sie sich unmäßig darüber, dass wieder einmal ausgerechnet Walter sie aufgehalten hatte. Diesem Mann schien einfach nichts von dem, was sie tat, zu entgehen und sie konnte sich nicht daran erinnern, dass er jemals ein freundliches Wort für sie übrig gehabt hätte.
„Du nimmst das alles viel zu ernst“, erwiderte Markus allerdings lediglich jedes Mal, wenn Anna sich bei ihm über Walters Art beschwerte. „Er ist schon in Ordnung.“ Dabei geriet ihr Bruder selbst immer wieder aufs heftigste mit diesem Mann aneinander. Dennoch empfand er wohl keine grundsätzliche Abneigung gegen den Ziehbruder seines Vaters, so wie es seine Schwester tat.
Anna seufzte, doch dann vertrieb sie Walter aus ihren Gedanken und freute sich stattdessen auf den herrlichen Ritt, zu dem sie sich nun bereit machen wollte.
„Mein Pferd, bitte“, wies sie einen der jungen Stallburschen an, der ihr entgegenkam.
Und nur wenig später führte dieser die gerichtete Stute aus dem Inneren in den Hof hinaus. Annas Pferd war ein herrliches Tier mit einem wunderbar seidigen Fell, von einer Farbe wie eine Mischung aus fließendem Gold und Silber. Sie hatte niemals gewagt, danach zu fragen, aber sie war sicher, dass die Stute ihren Vater Richard sehr viel Geld gekostet hatte. Als seine Schwester sich halbwegs auf dem Rücken des Pferdes halten konnte, ging Markus zu Elisabeth und bat seine Mutter auf Knien darum, dass er das Mädchen zu seinen täglichen Ritten in den Wald und die nähere Umgebung der Burg mitnehmen dürfte.
„Ja, ich gestatte es“, sagte die Fürstin schließlich, nachdem sie ihren Sohn eine Weile gemustert hatte. „Aber Markus“, fügte sie hinzu, „du bist dir hoffentlich darüber im Klaren, dass Anna noch sehr jung ist. So kann ich doch wohl davon ausgehen, dass du sie niemals alleine lässt, was auch geschehen mag, und dass du weißt, welche Orte sich für ein Mädchen ihres Alters ziemen und welche nicht.“
„Gewiss.“ Markus lächelte unschuldig.
„Und dass du deine Schwester selbstverständlich nicht in eines der Dörfer mitnimmst, solange ich nicht mein ausdrückliches Einverständnis dazu gegeben habe“, fuhr die Fürstin fort.
„Selbstverständlich nicht“, wiederholte Markus und kreuzte zur Vorsicht seine Finger hinter dem Rücken.
Von da an waren die Geschwister nahezu jeden Tag gemeinsam ausgeritten und bald kannte auch Anna rund um Bernadette jeden Winkel. Im Lauf der Monate und Jahre, die vergingen, hatten sich die beiden allerdings immer weiter von der Burg und den unmittelbar angrenzenden Feldern entfernt, viel weiter als Elisabeth es wissen durfte.
Doch nun, seitdem Markus gemeinsam mit Richard aufgebrochen war, war dem Mädchen nichts anderes übrig geblieben, als täglich alleine auszureiten, denn Elgita behauptete, dass das Geschaukel auf dem Pferderücken der Tod für ihr Kreuz wäre und Maria hatte immerzu irgendetwas zu tun.
Die Sonne brannte vom Himmel und binnen kürzester Zeit rann Anna der Schweiß von der Stirn. Deshalb beschloss sie, zu jener kleinen Grotte zu reiten, die sie vor Jahren einmal gemeinsam mit Markus entdeckt hatte. Eigentlich war es nur ein annähernd halbrund geformter Felsen, der jedoch so schräg nach vorne über dem Waldboden aufragte, dass die Wände eine Art überkragendes Dach bildeten. Im Inneren der Grotte entsprang im hinteren Teil aus dem Stein eine Quelle, deren Wasser sich in einem seichten Becken sammelte, ehe es als feines Rinnsal über den Boden floss. Es war ein herrlicher Ort und Anna und Markus waren sehr oft hierher gekommen. Im Hochsommer hatten sie Schutz vor der glühenden Sonne gesucht und im Herbst vor den plötzlich einsetzenden Regenfällen.
Anna glitt aus dem Sattel. Sie schöpfte mit beiden Händen Wasser, um zu trinken und sich das Gesicht zu erfrischen, danach führte sie auch ihr Pferd zur Wasserstelle. Anschließend ließ sie sich auf dem mit Moos und weichem Gras bewachsenen Boden nieder und während die Stute gemächlich vor sich hin zupfte und kaute, blickte Anna zu dem mächtigen Felsen über ihr auf. Dabei kam ihr das Gespräch mit Bianca wieder in den Sinn. Wie sehr hatte sich die ehemalige Freundin in den vier Jahren, die vergangen waren, verändert! Wie wenig verband die beiden Mädchen noch miteinander! Und wie unterschiedlich war tatsächlich die Stellung, die jede von ihnen innehatte. Doch ein Leben wie Bianca es führte, erschien Anna das Langweiligste und auch Abstoßendste, das sie sich vorstellen konnte, obwohl sie sehr wohl wusste, dass ihre frühere Freundin nun das Leben einer ganz gewöhnlichen Lehnsherrngattin führte. So bekam auch Bianca ein Kind nach dem anderen, saß vermutlich die meiste Zeit mit ihren Frauen in den Kammern und verbrachte die endlosen Stunden des Tages damit, ihre Kinder zu versorgen, zerrissene Kleider zu flicken und über belangloses Zeug zu reden. Auch Biancas Gatte war wohl ein ganz gewöhnlicher Ehemann, wenn gleich gewiss kein besonders guter und liebevoller, machte er doch nicht einmal einen Hehl daraus, dass er sich zur Abwechslung gerne hin und wieder die eine oder andere Frau in sein Bett holte oder zumindest gerne geholt hätte.
Und Bianca hatte sich mit den Tatsachen abgefunden, denn was wäre ihr auch für eine andere Wahl geblieben? Anna kannte niemanden, der jemals erfolgreich gegen die Entscheidung seiner Eltern aufbegehrt hätte.
„Was hättest du denn getan, wenn Vater nicht Judith als Ehefrau für dich ausgesucht hätte, sondern irgendein anderes Mädchen, das dir gar nicht gefällt?“, wollte sie einmal von ihrem Bruder Markus wissen.
Er zuckte mit den Schultern. „Die Zähne zusammengebissen und mich Richards Willen gefügt, was sonst?“, antwortete er. „Du stellst manchmal wirklich bescheuerte Fragen.“
Markus hatte Recht. Niemandem blieb eine andere Möglichkeit, als die Entscheidung hinzunehmen, die für ihn getroffen wurde. Doch Anna graute zutiefst vor dem Augenblick, in dem es bei ihr selbst so weit sein würde und deswegen hoffte sie manchmal im Stillen, dass ihr Vater niemanden für sie finden würde und sie für immer auf Bernadette bleiben konnte. Aber Richard war ein angesehener Lehnsherr, der über einen riesigen Besitz verfügte, und daher standen die Anwärter um die Hand seiner Tochter schon seit Jahren Schlange.
„Du wirst sehen, im Handumdrehen hat Vater einen Ehemann für dich gefunden, wenn es so weit ist“, hatte Markus immer wieder gesagt.
„Wie einen Käufer für ein gutes Stück Vieh, nicht wahr?“, erwiderte seine Schwester voller Bitterkeit. „Es geht ihnen allen doch nur um das Land.“
Markus sah sie an. „Da hast du nicht ganz Unrecht…“, murmelte er vor sich hin.
Und Anna hatte in seinen Augen den Schmerz darüber erkannt, dass sie ihn irgendwann verlassen würde.
Seit diesem Gespräch zwischen den Geschwistern waren einige Jahre vergangen. Anna lebte immer noch auf Bernadette und weder Richard noch Elisabeth schienen an ihre baldige Verehelichung zu denken, obwohl das Mädchen wusste, dass der Tag früher oder später herankommen würde. So blieb ihr nichts anderes übrig, als sich die Zeit bis dahin so angenehm wie möglich zu machen.
„Kommst du von den Hügeln?“, fragte Anna.
Es war bereits Nachmittag und Anselm zog einen der neu beschlagenen Schlitten hinter sich her. In jenem Winter war bislang sehr viel Schnee gefallen und deswegen trafen sich jeden Vormittag alle Kinder bei den Hügeln im hinteren Teil des Burggartens und rodelten um die Wette. Anselm selbst konnte nicht allzu oft mit dabei sein, denn Elias entließ seinen Sohn gewöhnlich erst dann, wenn der Großteil der Arbeit in der Schmiede getan war und dies war selten vor Mittag der Fall.
„Nein“, antwortete Anselm auf die Frage des Mädchens. „Ich gehe jetzt erst nach hinten. Ich hatte heute viel zu tun.“
Anna überlegte für einen Augenblick, dann sagte sie: „Ich komme mit dir.“
Die beiden fuhren den ganzen restlichen Nachmittag, bis es dunkel wurde und das Mädchen sich im Inneren des Herrenhauses einzufinden hatte. Wann immer Anselm in den folgenden Tagen und Wochen Zeit hatte, trafen sie sich bei den Hügeln. Dann saß Anna vorne auf dem Schlitten und Anselm hinter ihr und sie fuhren gemeinsam hinab und anschließend zog Anselm das Mädchen wieder hinauf. Dazwischen bauten sie Schneemänner, bewarfen sich gegenseitig mit Schneebällen und kreischten aus vollem Hals. Selbst Markus, der gewöhnlicher Weise vor Eifersucht tobte, sobald er befürchtete, irgendjemand könnte ihm die Zuneigung seiner Schwester streitig machen, sah das enge Verhältnis zwischen Anna und Anselm mit Belustigung, weil er den Sohn des Schmiedes recht gerne mochte. Ihm selbst blieb neben all seinen Verpflichtungen, die er auf der Burg gemäß Richards Wünschen zu übernehmen hatte, kaum mehr Zeit, sich um seine kleinere Schwester zu kümmern. Anselms Vater Elias beobachtete die Freundschaft der beiden Kinder allerdings mit großem Bedenken.
An einem Nachmittag prallte der Schlitten gegen einen herausstehenden Stein. Anselm gelang es, sich zur Seite fallen zu lassen, Anna aber stürzte kopfüber nach vorne in den Schnee und das gebogene Vorderteil des Schlittens traf sie mitten ins Gesicht. Als sie sich aufrichtete, blieb unter ihr ein roter Fleck zurück und eine warme Flüssigkeit rann ihr über Auge und Wange.
„Du hast dich verletzt“, keuchte Anselm, als er bei ihr angekommen war und neben ihr niedersank. „Oh Gott, du hast dich verletzt!“
Er wischte dem Mädchen mit dem Ärmel seiner Jacke über das Gesicht und presste dann Schnee auf die Wunde.
„Du brauchst einen Arzt“, stellte er schließlich fest und half ihr auf. „Das muss mit Sicherheit genäht werden.“
„Ach, das ist doch nichts“, wehrte Anna ab und versuchte zu lachen. „Nur ein Kratzer!“ Doch die Stelle brannte wie Feuer.
„Das wird dein Vater anders sehen!“, sagte Anselm bitter und zog den Schlitten hinter sich her.
Es dauerte eine Weile, ehe dem Mädchen die volle Bedeutung seiner Worte klar geworden war, doch dann beeilte sie sich, ihn einzuholen.
„Bitte, lauf schnell weg, ehe es zu spät ist“, sagte sie zu ihm. „Ich werde behaupten, dass ich allein gestürzt bin.“
Anselm sah sie kurz vor der Seite her an, doch dann schüttelte er den Kopf. „Nein, es wird sowieso offenkundig werden, dass ich dabei war. Zu viele Leute haben uns gemeinsam gesehen.“
Anna und Anselm bekamen auch überhaupt keine Gelegenheit, sich zu trennen, denn vor der Schmiede passte Elias die beiden ab und zog sie ins Innere hinein.
„Bist du das gewesen?“, fragte er seinen Sohn und wies auf die Verletzung des Mädchens.
„Nein“, antwortete der Junge leise. „Sie hat ...“
„Und wie erklärst du das hier?“, fragte der Vater und hielt Anselms blutverschmierten Ärmel in die Höhe.
„Er hat nur mein Gesicht abgewischt“, sagte Anna augenblicklich. Der Schnee, den sie immer noch auf die Wunde presste, begann in der Wärme der Schmiede zu schmelzen und rote Tropfen fielen zu Boden.
„Sie ist die Tochter deines Herrn!“, fuhr Elias seinen Sohn an. „Wie kannst du es wagen, ihr so nah zu kommen?“ Er schüttelte den Kopf. „Ich wusste, dass es nur Unglück bringen würde, wenn man euch beide miteinander alleine ließe. Zieh die Jacke aus!“, meinte er dann.
Anselm gehorchte und legte seine Jacke ab.
„Du wirst dein Gewand heute Abend selbst waschen“, wies der Schmied seinen Sohn an.
Der Junge senkte die Augen. „Ja, Vater“, antwortete er.
„Und jetzt knie dich hin und beug dich nach vorne“, sagte Elias und nahm den breiten Lederstreifen von der Wand, an dem er normalerweise seine Werkzeuge schärfte.
Anna starrte Anselm an und er erwiderte ihren Blick voller Entsetzen. Die Schmach, dass das Mädchen die Bestrafung miterleben sollte, war schlimmer als die Angst vor den Schlägen. Dann kniete Anselm vor seinem Vater nieder.
„Bitte nicht“, flehte Anna. „Er hat doch nichts getan.“
Elias aber sah sie mit einer Mischung aus Verzweiflung und Unerbittlichkeit an. „Wenn ich meinen Sohn nicht dafür strafe, dass Ihr Euch in seiner Gegenwart verletzt habt, wird Euer Vater mich entlassen. Das kann ich mir nicht leisten, immerhin habe ich eine Frau und vier Kinder zu ernähren.“ Er schob Anselms Hemd nach oben und entblößte dessen Rücken. Dann sagte er: „Und jetzt geht bitte zum Herrenhaus hinüber. Ich bin sicher, Eure Erzieherin wartet bereits auf Euch!“
Obwohl das Mädchen sich bemühte, von der Schmiede fort zu kommen, so schnell sie es vermochte, konnte sie hinter sich das Geräusch des Leders auf Anselms Haut hören und sein unterdrücktes Schreien.
Elgita war furchtbar wütend auf Anna. „Wie ist das nur geschehen?“, fragte sie.
„Ich bin auf dem Eis ausgerutscht und mit dem Kopf gegen einen Pfahl gestoßen“, log das Mädchen.
„Konntet Ihr nicht aufpassen?“, fuhr die Erzieherin sie an und dann rief sie nach dem Arzt.
Johann besah sich die Wunde. Er wusch sie und nähte anschließend die Ränder mit ein paar Stichen zusammen. Und das Mädchen presste die Zähne aufeinander, während die Nadel durch ihre Haut drang. Zum Abschluss gab der Arzt ein wenig Salbe auf die Verletzung.
„Wird eine große Narbe bleiben?“, wollte Elgita von ihm wissen.
Johann schüttelte den Kopf. „Nein“, erwiderte er. „Es wird wohl gut verheilen.“
Die Erzieherin schien ein wenig beruhigt, wenn gleich ihr mit Sicherheit davor graute, der Herrin von der Verletzung ihrer Tochter berichten zu müssen. Dann schickte sie das Mädchen auf ihr Zimmer, wo sie als Strafe bis zum folgenden Morgen und ohne Abendessen bleiben sollte. Nur ein oder zwei Stunden später aber betrat Elisabeth den Raum ihrer Tochter. Sie hob das Tuch auf, das Johann über die Wunde gelegt hatte und warf einen abschätzenden Blick auf die Verletzung.
„Nun ja“, sagte sie nach einer Weile schmunzelnd. „Ich denke, es wird deiner Schönheit nur einen kleinen Abbruch tun.“
Anna verzog den Mund zu einem schwachen Lächeln.
Elisabeth wurde ernst. „Aber mehr als eine derartige Verletzung im Gesicht kannst du dir nicht leisten. Du musst besser auf dich aufpassen! Hast du mich verstanden?“
„Ja, Mutter“, antwortete das Mädchen niedergeschlagen.
Die Fürstin griff nach der Hand ihrer Tochter. „Was ist, mein Herz? Bedrückt dich irgendetwas?“
Anna hob den Blick, doch dann schüttelte sie den Kopf. „Nein, es ist nur wegen der Wunde.“
„Das wird schon verheilen“, tröstete Elisabeth.
Spät am Abend schlich sich das Mädchen trotz aller Verbote zu Markus ins Zimmer und erzählte ihm flüsternd, was sich zugetragen hatte.
Er lachte lediglich und meinte: „Ich wette, sein Vater hat ihn ordentlich dafür verdroschen!“
Doch Anna konnte das nicht im Geringsten lustig finden. In jenem Winter war sie erst zwölf Jahre alt und sie hatte noch keinen Namen für die Empfindung tief in ihrem Inneren.
„Darf ich mich zu Euch gesellen?“ Johann trat auf Elgita zu.
Die Erzieherin hatte sich ein wenig abseits des Festtrubels in den Schatten einer Mauer zurückgezogen. Nun aber begegnete sie dem Arzt mit einem einladenden Blick. „Selbstverständlich.“
„Wollt Ihr etwas trinken?“ Johann hielt einen Becher mit Wein und einen mit Bier in den Händen.
„Bier“, entschied sich die Erzieherin nach einem kurzen Zögern.
„Ich wollte Euch schon lange etwas fragen.“ Der Arzt reichte der Frau eines der Gefäße. „Wo habt Ihr studiert?“
„Bologna“, antwortete Elgita. „Ich war eine der wenigen Frauen, die man dort zuließ. Es war nicht einfach.“
„Das kann ich mir vorstellen“, erwiderte Johann. „Auch in Salerno gab es nur wenige Studentinnen. Meine Frau war eine von ihnen.“
„Ihr seid verheiratet?“ Die Erzieherin war überrascht. Der Arzt war schon seit vielen Jahren auf der Burg, aber stets hatte sie ihn nur alleine gesehen.
Doch Johann nickte. „Immer noch“, sagte er. „Meine Frau lebt nach wie vor in Salerno. Sie war bereits im Studium wesentlich erfolgreicher als ich und heute ist sie Dozentin an der Medizinischen Fakultät. Bei mir hat es lediglich zu einem gewöhnlichen Medicus gereicht.“ Er grinste. „Auch das war nicht einfach.“
„Aber“, Elgita zögerte, „trefft Ihr Eure Frau hin und wieder?“
„Nein.“ Der Arzt schüttelte den Kopf. „Ich habe sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Sie weiß allerdings, dass ich hier auf Bernadette lebe und ab und an erhalte ich ein Schreiben von ihr, in dem sie sich nach meinem Befinden erkundigt und mir die neusten Ereignisse mitteilt. Auf diese Art stehen wir also nach wie vor in Verbindung, obwohl … Nun ja.“ Er winkte ab. „So ist eben das Leben.“
„Habt Ihr Kinder?“, wollte die Erzieherin wissen.
„Ja. Doch sie sind mittlerweile alle erwachsen, verheiratet, studieren und gehen ihre eigenen Wege.“ Johann zuckte mit den Schultern. Er schien nicht verbittert über den Lauf der Geschehnisse.
„Wenn Ihr doch in Salerno studiert und gelebt habt, wie kommt Ihr also hierher, so weit in den Norden?“, erkundigte sich Elgita.
„Ich stamme ursprünglich von hier“, erwiderte der Arzt. „In Wahrheit sogar noch weiter aus dem Norden, aus einer kleinen Stadt an der See. Ich war zwölf Jahre alt, als mein Vater nach einer heftigen Verletzung am Wundbrand starb und kurz darauf beschloss ich, später einmal Arzt zu werden. Meine Mutter allerdings musste mich und sich selbst nach dem Tod ihres Gatten alleine durchbringen und weil sie über keinen Besitz verfügte, war sie gezwungen, jede noch so geringe Tätigkeit anzunehmen.“ Er sah die Erzieherin an. „Das war keine einfache Zeit. Selbstverständlich hätte mir meine Mutter niemals die kostspielige Einschreibung an irgendeiner Universität bezahlen können und so sprach ich mit ihr auch nicht darüber, denn ich wollte nicht, dass sie sich am Ende in Schulden stürzte, nur um ihrem Sohn eine Ausbildung zu ermöglichen. Ein Onkel väterlicherseits half uns, Gott sei Dank, ab und zu aus und ein paar Jahre später begann ich, in seiner Schreinerei zu arbeiten. Er war sehr zufrieden mit mir, als er mich jedoch irgendwann fragte, ob ich seine Nachfolge antreten wollte, weil er selbst kinderlos war, nahm ich all meinen Mut zusammen und erzählte ihm von meinem Wunsch, Arzt zu werden. Ich hatte Glück. Ich war diesem Onkel in den Jahren unserer Zusammenarbeit so sehr ans Herz gewachsen, dass er mir bedingungslos die teure Einschreibung bezahlte und auch die Kosten für die Prüfungen trug, so lange bis ich gut genug ausgebildet worden war, um meinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Ich habe …“, Johann dachte einen Augenblick nach, „… über zwanzig Jahre in Salerno gelebt und gearbeitet, meine Kinder sind dort geboren worden und aufgewachsen. Aber in all der Zeit vermisste ich den Norden aus tiefstem Herzen. Ich sehnte mich nach dem rauen Wetter, den kalten und schneereichen Wintern, aber auch nach den langen Tagen im Sommer und ich wusste immer, dass ich irgendwann hierher zurückkehren würde. Als die Kinder aus dem Haus waren und die Ehe mit meiner Frau schon seit langer Zeit nur mehr ein Zweckbündnis war, da sah ich den Augenblick gekommen, meine Sachen zusammenzupacken und wieder Richtung Norden aufzubrechen. Ich arbeitete auf verschiedenen Anwesen, immer dort, wo ich gerade gebraucht wurde, bis ich schließlich irgendwann hörte, dass auf einer großen Burganlage ein Medicus gesucht würde. Ich kam nach Bernadette und blieb. Nun schon seit beinahe zehn Jahren.“ Der Arzt sah die Erzieherin an und lächelte. „Und Ihr?“, fragte er anschließend. „Ihr stammt ganz gewiss nicht von hier. Der südländische Einschlag in Eurer Sprache verrät Euch.“
Elgita lachte. „Und das, obwohl ich mich bereits seit vielen Jahren so hart darum bemühe, ihn zu vertreiben.“ Sie schüttelte den Kopf. „Ihr habt Recht. Mein Vater besaß ein kleines Lehnsgut in der Nähe von Bologna. Doch er war verarmt und als jüngste Tochter reichte der Besitz für meine Verheiratung nicht mehr aus. Das war mir im Grunde nicht unrecht, träumte ich als junges Mädchen doch heimlich davon, in eines der großen Klöster einzutreten, um mich dort zeitlebens in den Bibliotheken zu verkriechen und meinen Wissensdurst zu stillen. Doch auch daran war nicht zu denken, denn mein Vater hätte ebenso wenig die Mitgift für irgendeinen Konvent aufbringen können. Ein Studium an einer Universität kam mir überhaupt nicht in den Sinn, gab es doch in meinem Umfeld auch keine einzige Frau, die Derartiges getan hatte. Mein ältester Bruder hatte aber das Glück, die Erbtochter eines überaus vermögenden Lehnsherrn zur Frau zu haben und verfügte nun selbst über eine Menge Geld und Besitz. Er war es, der eines Tages auf mich zukam und mich fragte, ob ich nicht ein Studium der Freien Künste in Bologna beginnen wollte. Er erklärte sich bereit, alle Kosten zu tragen.“ Die Erzieherin lachte erneut. „Ich war zunächst der Meinung, er wollte mich auf den Arm nehmen und seine Scherze mit mir treiben. Aber mein Bruder sprach mit vollem Ernst. Möglicherweise war er der einzige, der begriffen hatte, dass ich eine gewisse Begabung in dieser Hinsicht hatte. Und er war bereits damals, vor vielen Jahren, der festen Ansicht gewesen, dass ich mit dem angeeigneten Wissen stets eine Anstellung in den besten Adelshäusern als Erzieherin der heranwachsenden Mädchen haben würde. Ich wäre also für den Rest meines Lebens in der Lage, selbst für meinen Unterhalt zu sorgen und wäre nicht gezwungen, eine niedere Tätigkeit als Kammerzofe im Dienste irgendeiner Herrin zu verrichten. So schrieb ich mich also an der Universität von Bologna ein und beendete einige Jahre später das Studium mit Auszeichnung. Wie mein Bruder es vorausgesagt hatte, bekam ich viele Angebote und konnte mir nahezu immer aussuchen, wo ich arbeiten wollte. So war ich etliche Jahre lang im Dienste mal dieser und mal jener Herrin tätig, ich wurde überaus gut bezahlt und wenn es mir irgendwo nicht gefiel, so stellte es für mich keinerlei Schwierigkeit dar, den Ort zu wechseln, so dass ich viel im gesamten Heiligen Reich herumgekommen bin. Aber …“, die Frau senkte die Augen, „… trotz all dieser Vorteile muss ich gestehen, dass ich niemals wirklich zufrieden gewesen bin. Denn die Eltern der jungen Mädchen, die ich unterrichtete, glaubten, es genüge vollkommen, wenn ihre Töchter lesen und ein paar fromme Formeln auf Latein daher sagen konnten, von der Bildung der heranwachsenden Burschen einmal ganz zu schweigen. Doch ich selbst verfügte über ein weitaus größeres Wissen, das ich auch weitergeben wollte. So dachte ich im Lauf der Jahre immer mehr daran, mich doch noch in irgendeines der Klöster zurückzuziehen, um vielleicht ein Buch zu schreiben. Aber dann wurde ich eines Tages auf dem Anwesen, auf dem ich zu jener Zeit beschäftigt war, von einer Frau angesprochen, die mir ihre damals fünfjährige Tochter anvertrauen wollte. Elisabeth hatte wohl meinen Unmut erkannt und als sie mir versicherte, dass ich bei Annas Erziehung und Ausbildung vollkommen freie Hand hätte, musste sie mich nicht lange bitten. Ich siedelte noch im gleichen Monat nach Bernadette über und blieb. Ebenso wie Ihr.“ Sie nickte zufrieden. „Nun bin ich schon zwölf Jahre hier und es war eine wundervolle Zeit. Anna war solch ein wissbegieriges und aufnahmefähiges Mädchen, dass es mir jeden Tag aufs Neue Freude bereitete, sie zu unterrichten. Und Elisabeth hielt Wort, ich hatte tatsächlich vollkommen freie Hand und ich brachte Anna all das bei, was ich wollte, auch Dinge, die sich … nun ja, weniger für junge Mädchen geziemen.“ Elgita grinste spitzbübisch.
„Ja, das Mädchen ist ein Engel“, erwiderte Johann. „Vor allem, wenn man sich den Bruder daneben vorstellt. Markus’ Erzieher sagte mir einmal …“
„Oh nein!“, fiel die Frau dem Arzt ins Wort. „Die Schuld ist nicht nur Markus allein zuzuschreiben. Richard hatte einen entsetzlichen Mann für seinen Sohn an den Hof geholt, der nicht verstand, mit dem Jungen umzugehen. Er hat kaum etwas anderes getan, als auf ihn einzuprügeln. Ich hörte jeden Tag, wie er das Kind schlug.“
„Dachtet Ihr daran, Markus’ Erziehung zu übernehmen?“, fragte Johann.
Elgita zögerte. „Nun, es kam mir einige Male in den Sinn, aber ich konnte mich nicht dazu überwinden, mit Richard darüber zu sprechen. Markus war nicht nur unbeherrscht, er war auch unbeherrschbar und so fürchtete ich, mir an der Unbeugsamkeit des Jungen die Zähne auszubeißen und so sehr mit ihm beschäftigt zu sein, dass ich das Mädchen nicht mehr hinreichend ausbilden könnte. Also hörte und sah ich weiterhin mit an, wie er von seinem Erzieher misshandelt wurde. Doch jenem Mann ist es niemals gelungen, Markus zu brechen. Im Gegenteil, jeder Schlag ließ den Jungen stärker werden. Als ich irgendwann sah, wie sehr Markus seinen Erzieher hasste, begriff ich, dass es nur noch eine Frage der Zeit wäre, ehe er es wagen würde, sich gegen diesen Mann auch in körperlicher Art und Weise zur Wehr zu setzen und das wäre mit Sicherheit äußerst übel für den Erzieher ausgegangen. Also ging ich zu Richard und berichtete ihm unter vier Augen, was jener Mann seinem Sohn bereits seit Jahren antat.“ Die Frau seufzte. „Richard entließ den Erzieher noch am selben Abend.“
Johann und Elgita schwiegen eine ganze Zeitlang und leerten ihre Becher.
„Denkt Ihr daran, eines Tages noch weiter in den Norden zu gehen, etwa zurück in Eure Heimatstadt?“, fragte die Erzieherin schließlich.
„Nein.“ Der Arzt schüttelte den Kopf. „Bislang ist mir nicht einmal der Gedanke gekommen, Bernadette zu verlassen. Ich wüsste auch nicht, welchen Grund ich dazu haben sollte. Auf der Burg gibt es genug für mich zu tun, hier ist immer irgendjemand erkrankt und kleinere oder größere Verletzungen, die versorgt werden müssen, gibt es jeden Tag. Und Richard ist meiner Meinung nach der beste und fürsorglichste Lehnsherr, in dessen Dienst ich je gewesen bin. Wie oft hat er mich sogar zu einem seiner Leibeigenen gesandt, wenn dieser selbst, dessen Frau oder eines der Kinder erkrankt war, obwohl jener sich eine ärztliche Behandlung niemals hätte leisten können. Aber Richard übernahm alle Kosten der Behandlung ohne viel Aufhebens um die ganze Angelegenheit zu machen. Ja, ich fühle mich durchaus wohl auf Bernadette und so hoffe ich, dass sich nicht allzu bald irgendetwas an diesem Zustand ändert.“ Johann wandte sich der Frau zu. „Auch Ihr seid ebenfalls noch hier, obwohl die Ausbildung des Mädchens seit zwei oder drei Jahren abgeschlossen ist“, stellte er fest. „Bernadette gefällt Euch wohl, genauso wie mir…“
„Ja“, gab Elgita sofort zu. „Auch wenn ich heute lediglich für die Einarbeitung neuer Dienstkräfte zuständig bin und nicht mehr unterrichte, so ist dieser Ort doch zu meinem Zuhause geworden. Ich habe auf so vielen verschiedenen Anwesen gelebt und musste mit so vielen unterschiedlichen Herrinnen auskommen, dass ich aus meiner Erfahrung sagen kann: Bernadette ist wirklich ein Traum zum Leben. Und wer weiß? Vielleicht wird man mir in naher Zukunft die Erziehung von Markus’ und Judiths Kindern anvertrauen. Es würde mir sehr gefallen, wieder zu unterrichten.“
Die Erzieherin blickte beinahe sehnsüchtig vor sich hin.
„Das ist doch nicht dein Ernst!“, schrie Anna so laut, dass es durch das gesamte Herrenhaus zu hören war. „Ihr werdet schon in zwanzig Tagen aufbrechen?“
Markus hatte seine Schwester in sein Zimmer gebeten und dem Mädchen von dem unmittelbar bevor stehenden Aufbruch gemeinsam mit seinem Vater Richard erzählt. Bislang hatte Anna noch nicht einmal erfahren, dass eine erneute Unternehmung anstand.
„Anna“, begann Markus sanft, doch seine Schwester ließ ihm keine Zeit, ihr irgendetwas zu erklären.
„Warum hast du denn nicht früher mit mir gesprochen?“, fiel sie ihm ins Wort. „Willst du mir etwa erzählen, dass du es selbst erst seit gestern weißt? Vermutlich hast du all die Jahre nur darauf gewartet, einmal für so lange von hier wegzukommen.“
„Anna, du weißt, dass das nicht wahr ist“, versuchte Markus sie zu beruhigen. „Hör mir doch einmal zu.“
„Nein!“, giftete das Mädchen ihn an. „Ich bin dir wohl überhaupt nichts wert, sonst würdest du hier bleiben!“ Als ihr Bruder die Hand ausstreckte, um ihre Wange zu berühren, schlug sie danach. „Lass das!“, fuhr sie ihn an. „Glaub nicht, dass du mich einfach so besänftigen kannst.“
Markus jedoch zog seine Schwester auch gegen ihren Widerstand in seine Arme und Anna ließ sich hineinsinken und begann haltlos zu weinen.
„Anna.“ Der Sohn des Fürsten fühlte sich so elend und hilflos, dass er sich beherrschen musste, um nicht mit dem Mädchen mitzuweinen. „Anna“, sagte er noch einmal sehr sanft. „Selbstverständlich bist du mir sehr viel mehr wert als dieser Auftrag, aber du weißt, dass ich mich unmöglich weigern kann, Richard zu begleiten. Ich werde allerdings bald zurück sein und dann ist alles wieder wie früher. Ich verspreche es. Wir werden gemeinsam ausreiten, am Abend zusammen Schach spielen, ich werde dir viele Dinge von der Reise mitbringen.“
Markus sprach eine ganze Zeitlang beruhigend auf seine Schwester ein und versuchte ihr alles zu erklären, doch Anna begriff von seinen Worten lediglich, dass ihr Bruder sehr lange von ihr fort sein würde und sie alleine zurückließe. Und diese Vorstellung war unerträglich. Zwar war es nicht das erste Mal, dass Markus seinen Vater irgendwohin begleiten sollte und seine Schwester auf ihn warten musste, doch niemals zuvor war er für eine solch lange Zeit fortgeblieben. Noch dazu hatten alle vorherigen Reisen spätestens im Herbst ihr Ende gefunden, wenn das Wetter die Wege untauglich machte. Doch dieses Mal würden die beiden wahrscheinlich sogar in den Wintermonaten fern sein und Anna fragte sich bereits jetzt, was sie denn in jener langen, dunklen Zeit ohne ihren Bruder anfangen sollte. Dazu kam, dass sie Markus erst seit kurzem wieder um sich hatte, denn im vergangenen Herbst war er an einer furchtbaren Lungenentzündung erkrankt, die so heftig verlaufen war, dass der Sohn des Fürsten viele Wochen im Bett zubringen musste. Anna war oft bei ihm gesessen, so lange bis sie vor Erschöpfung beinahe eingeschlafen war und Maria sie schließlich in ihr Zimmer gebracht hatte. Das Mädchen hatte gebetet und gehofft, dass ihr Bruder bald wieder genesen mochte und nun, wo er endlich wieder halbwegs auf den Beinen war, da würde er sie erneut verlassen. Das Mädchen weinte sehr lange in Markus’ Armen und atmete dabei seinen vertrauten Geruch ein, als wäre es das letzte Mal. Dann aber riss sie sich zusammen und mühte sich darum, ihrem Bruder mit Freundlichkeit zu begegnen, weil sie sich nicht selbst die letzte gemeinsame Zeit mit ihm verderben wollte.
„Was geht Euch durch den Kopf?“ Walter trat an Heinrichs Seite, der mit zusammengekniffenen Augen zu den Wehrgängen der inneren Ringmauer hinaufblickte.
„Ich versuche gerade zu schätzen, wie viele Söldner wohl derzeit im Dienst des Fürsten stehen.“ Judiths Vater wandte sich dem Mann zu.
Richards Ziehbruder lachte. „Ich kann es Euch sagen, wenn Ihr wollt. Es sind etwa fünf Dutzend.“
Heinrich zog hörbar die Luft ein. „Fünf Dutzend“, wiederholte er und die Bewunderung in seiner Stimme war deutlich zu vernehmen. „Das ist ja nahezu eine Armee. Ich habe kaum mehr als eine Handvoll auf Florentina!“
„Florentina ist auch nur schlecht mit Bernadette zu vergleichen“, merkte Walter an. „Eine Anlage von dieser Größe muss schon entsprechend geschützt werden. Ihr wisst doch selbst, wie es ist. Manch einer würde sich Richards Besitz liebend gerne einverleiben. Und ich bin sicher, dass schon einige einen Versuch gewagt hätten, wenn er nicht so viele und gut gerüstete Soldaten hätte.“
„Ja, da habt Ihr sicher recht“, stimmte Heinrich zu und prostete in Walters Richtung, ehe er seinen Becher ansetzte. „Wo wir gerade von ihm sprechen… Habt Ihr etwas von Richard und Markus gehört?“, wollte Judiths Vater anschließend wissen.
Der Ziehbruder des Fürsten schüttelte jedoch den Kopf. „Nein, schon seit etlichen Wochen nicht mehr. Die beiden schrieben überhaupt nur wenig im letzten Jahr und wenn, dann waren die Briefe ausschließlich für Elisabeth bestimmt.“ Er zuckte mit den Schultern. „So kann ich Euch nur das berichten, was mir die Fürstin davon eröffnet hat. Aber soweit ich es beurteilen kann, schien es Richard und Markus ausnahmslos gut zu ergehen. Es gab wohl keinerlei besondere Vorkommnisse.“
„Gott sei es gedankt“, erwiderte Heinrich. „Hoffen wir, dass die beiden bald heimkehren.“
Richards Ziehbruder nickte und leerte seinen Becher. „Ja, hoffen wir es“, sagte er dann.
Es regnete in Strömen und die ausgedörrte Erde sog gierig das niederprasselnde Wasser auf. Anna hatte sich zunächst in den hintersten Teil der Grotte zurückgezogen, dorthin wo sie und ihr Pferd ein wenig vor den herabstürzenden Wassermassen geschützt gewesen waren, doch nach kürzester Zeit waren Mädchen und Tier so durchnässt gewesen, dass Anna schließlich nach Bernadette zurückritt. Ihr Kopf war rot vor Scham, als sie das Herrenhaus betrat, doch unten, in der Großen Halle, befanden sich nicht mehr allzu viele Gäste. Einige hatten wohl den bevorstehenden Wolkenbruch gewittert und waren rechtzeitig abgereist, andere hatten sich in die für sie vorbereiteten Räumlichkeiten zurückgezogen. Anna konnte weder ihre Mutter, noch Walter irgendwo entdecken, worüber sie heilfroh war. Dafür aber trat Maria auf das Mädchen zu.
„Wo kommt Ihr denn her?“, fragte die Dienerin mit einem vorwurfsvollen Blick.
„Ich war nur kurz im Wald.“ Anna umfasste mit beiden Armen ihren zitternden Leib. Die Luft hatte sich durch den plötzlichen Regen stark abgekühlt und so war ihr eiskalt in ihrem durchnässten Gewand.
„Kurz?“, erwiderte Maria böse. „Das sieht mir aber nicht nach einem kurzen Ausflug aus.“ Sie fasste an den triefenden Stoff. „Geht nach oben und zieht Euch um. Und dann setzt Euch für eine Zeitlang unten in die Küche neben das Herdfeuer, damit Ihr Euch nicht erkältet.“
Das Mädchen ließ beschämt den Kopf hängen. „Könntest du mir nicht ein Bad richten lassen?“, fragte sie verhalten. „Mein Haar ist so verfilzt.“
Mit ein paar raschen Blicken sah die Dienerin sich nach allen Seiten um, doch niemand schien ihre Hilfe zu benötigen. „Ja, Ihr habt Recht“, stimmte sie dann nickend zu. „Ein heißes Bad ist sicher das Allerbeste. Also, zieht Euch um, ich komme Euch holen, sobald das Wasser recht ist.“
Der Raum, in dem der große, mit Pech ausgestrichene Zuber stand, befand sich auf halbem Weg in den Keller hinab. Durch eine kleine Luke, die unmittelbar zum Burghof lag, konnte das Wasser für das Bad hereingebracht werden, bevor es anschließend auf einem riesigen Ofen erwärmt wurde. Auf diese Art und Weise dauerte es zwar eine ganze Zeitlang, bis genügend Wasser für ein Bad bereit gemacht worden war, aber Elisabeth hatte schon seit jeher darauf geachtet, dass zumindest ihre Tochter regelmäßig gebadet wurde. Auch die Fürstin selbst stieg nach einem anstrengenden Tag gerne in den Keller hinab, um sich bei einem heißen Bad zu entspannen, wohingegen ihr Mann und auch ihr Sohn es vorzogen, sich in jenem Raum mit eiskaltem Brunnenwasser zu übergießen.
Anna jedoch liebte das heiße Wasser, ganz gleich wie ihre Mutter, und freute sich daher auf jedes Bad. So stand sie nun ungeduldig neben dem Trog und sah zu, wie Maria den letzten Eimer hineingoss.
„So…“ Die Frau wandte sich zur Seite und griff nach einem kleinen Ölfläschchen. „Ihr könnt dann.“
Blitzschnell zog sich das Mädchen ihr Untergewand über den Kopf und stieg in den Zuber, noch ehe die Dienerin sich ihr wieder zugewandt hatte und sie vollkommen entkleidet sah. Seltsamerweise brauchte Maria in letzter Zeit immer äußerst lange, um irgendwelche Dinge zur Morgentoilette herzurichten, so dass es Anna beinahe jedes Mal gelang, unbeobachtet zumindest ihr Mieder oder Hemd überzuziehen und darüber war sie gottfroh.
„Das ist neu“, sagte die Dienerin und goss einige Tropfen Öl ins Wasser. „Eure Mutter hat es erst vor kurzem erworben. Es stammt aus dem Morgenland. Jasmin oder so ähnlich.“
Anna schloss die Augen vor Zufriedenheit. „Wie ist dein Tag verlaufen?“, fragte sie allerdings wenig später und verrieb sich das Öl auf der Haut. „Gibt es etwas Neues?“ Sie verzog spöttisch den Mund.
„Ach…“ Maria winkte ab. „Alles für die Katz’ heute. Entweder waren sie hässlich, betrunken oder verheiratet. Ich weiß auch nicht, was davon schlimmer ist.“
Anna lachte. „Hab ich da nicht etwas von Mätressen gehört heute Morgen?“, fragte sie unschuldig.
Die Dienerin warf ihr einen gespielt bösen Blick zu.
„Nun ja.“ Das Mädchen zuckte mit den Schultern. „Dann nimm doch noch mal den Soldaten von letzter Woche. Erik hieß er, nicht wahr? Oder war das der von der vorletzten? Ich verliere bei dir wirklich langsam den Überblick…“
„Na, na!“ Maria tauchte eine Hand ins Wasser und spritzte dem Mädchen einen Schwall ins Gesicht. „Nicht so frech!“
Anna fühlte sich ausgezeichnet. Nach diesem verdrießlichen Tag genoss sie das Geplauder mit ihrer Dienerin aus tiefstem Herzen. Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht dachte sie daran, wie sie Maria nicht nur einmal des Nachts aus ihrem Bett geholt hatte, wenn sie krank war oder vor Angst nicht mehr einschlafen konnte. Dann war das Mädchen immer zu der kleinen Kammer neben ihrem Zimmer geschlichen, hatte gegen die Tür gehämmert und gerufen: „Maria! Maria!“ Solange, bis die Frau schließlich öffnete und mit genervtem Blick fragte: „Was gibt es, Anna?“, während sie sich lediglich halbwegs darum bemühte, ihren nackten Körper mit einem Laken zu bedecken und der Mann hinter ihr im Bett sich beherrschen musste, um seine Anwesenheit nicht durch ein Lachen aus vollem Hals zu verraten.
Im Laufe der langen Zeit, die sich Maria bereits auf Bernadette befand, waren nahezu alle Söldner, einer nach dem anderen, in ihrem Bett gelandet und sie wusste auch noch nach Jahren um die Kunstfertigkeiten eines jeden Einzelnen. Mit Anna sprach die Frau vollkommen ungehemmt über ihre Eroberungen und das führte manches Mal zu einer Auseinandersetzung mit Elgita, die das Mädchen in dieser Hinsicht gerne unbedarfter gehalten hätte.
Anderen Burgbewohnern war das Verhalten Marias gar ein Dorn im Auge. Wäre jene nicht die persönliche Dienstkraft der Tochter der Fürstin gewesen, hätten sie vermutlich wesentlich offener über sie hergezogen. So allerdings tuschelten sie lediglich hinter vorgehaltener Hand.
„Sie sind ja nur neidisch“, war allerdings das Einzige, was Maria dazu zu sagen hatte und da war vermutlich viel Wahres dran. „Sie hätten nämlich selbst gerne den einen oder anderen Soldaten in ihrem Bett.“
Im Gegensatz zu manchen Burgbewohnern schien sich allerdings Elisabeth trotz aller Härte und Strenge, die ihr nachgesagt wurden, an Marias Verhalten und ihrer Offenherzigkeit nicht zu stören, denn noch niemals hatte sie die Frau zur Zurückhaltung angewiesen, wenn gleich sie mit Sicherheit wusste, was die engste Dienerin ihrer Tochter trieb und ihr wohl auch schon von verschiedenen Seiten angetragen worden war, worüber Maria mit dem jungen Mädchen sprach.
An jenem Abend nach dem Frühlingsfest war Maria allerdings schweigsam und vermutlich ein wenig wütend, weil all ihre Bemühungen, sich einen Mann für die kommende Nacht zu angeln, erfolglos geblieben waren.
„Kommt Ihr alleine zurecht?“, fragte sie nach einer Weile und fingerte an ihrem Mieder herum, das ihr die Luft abdrückte. „Es ist unerträglich heiß hier drin und wenn Ihr es gestattet, würde ich den Raum gerne für eine Weile verlassen.“
Anna nickte ihre Zustimmung und die Frau zog sich zurück.
„Macht Platz und überlasst ihn dem Jungen! Der schätzt es, wenn einer so mutig kämpft!“
Der Herr der Burg hatte sich bislang recht tapfer geschlagen. Mit erhobenem Schwert stand er schützend vor seiner Frau und seinem Kind, und noch war es keinem der Angreifer gelungen, ihn zu Fall zu bringen. Als sich ihm der Junge mit dem nahezu weißen Haar näherte, ließ ihn der Mann nicht aus den Augen. Doch der Junge schnellte vor und schlitzte seinem Gegenüber ohne ein Wort der Vorwarnung den Unterarm auf. Vor Schmerz taumelte der Burgherr ein paar Schritte zur Seite und der Junge nutzte die Gelegenheit, um mit einer heftigen Bewegung die Frau und das Kind hinter ihm hervor zu reißen und die beiden zu einem seiner Kumpanen hinüber zu stoßen. Inzwischen hatte sich der Mann wieder in der Gewalt, wechselte seine Waffe in die linke Hand und begann, auf den Jungen einzuschlagen. Der Kampf war hart, aber es war für alle Beobachter von vorne herein offensichtlich, welcher der beiden Kontrahenten als Sieger hervorgehen würde. Noch im selben Moment, als der Burgherr durchbohrt vom Schwert des Jungen zu Boden sank, erstach der Kumpan die Frau und das Kind.
Ein junges Mädchen, vermutlich die Tochter irgendeines Abhängigen, die ihren Frondienst auf der Burg des Herrn leistete, stand kreischend vor Entsetzen im Hintergrund. Der Mann, der die Frau und das Kind ermordet hatte, trat auf sie zu und schlug ihr ins Gesicht.
„Halt doch dein dummes Maul, Weib!“, fuhr er sie an und nachdem das Mädchen niedergestürzt war, hob er sein Schwert.
„Lass sie am Leben!“, sagte der Junge. „Ich brauche sie noch.“
Der Mann lachte voller Rohheit. „Kommst du endlich auf den Geschmack?“, fragte er.
Doch der Junge gab ihm keine Antwort. Stattdessen trat er auf das Mädchen zu und riss sie vom Boden hoch. Er zerrte sie den Gang entlang hinter sich her, während er über die Körper der Toten und Sterbenden hinweg stieg, als sähe er sie nicht. Schließlich stieß er das Mädchen in der Küche vor die Feuerstelle.
„Mach mir etwas zu essen!“, wies er sie an und ließ sich am Tisch nieder.
Das Mädchen stand zitternd und weinend vor dem Herd. „Nach was steht Euch denn der Sinn?“, brachte sie endlich mühsam hervor.
„Vollkommen egal“, erwiderte er. „Hauptsache, ich bekomme etwas in den Magen.“
Das Mädchen begann voller Verzweiflung, ein paar Reste vom Vortag über dem Feuer zu erwärmen.
„Das Fleisch auch!“, befahl ihr der Junge und zeigte auf einen enthäuteten Hasen, der über dem Abzug hing.
Das Mädchen briet die Stücke, während ihr unentwegt die Tränen über das Gesicht liefen.
„Hör auf!“, fuhr er sie nach einer Weile an. Und weil sie nicht sofort gehorchte, schrie er: „Ich hab’ gesagt, du sollst aufhören mit der verdammten Heulerei!“
Das Mädchen beherrschte sich mit Mühe und stellte dann den Teller vor dem Jungen auf den Tisch. Er wusch sich nicht einmal das Blut von den Händen, ehe er anfing zu essen und er aß schlimmer als ein Schwein. Sie beobachtete ihn, während er das Essen nahezu hinunterschlang, denn sie wagte ohne seine ausdrückliche Erlaubnis, keinen Schritt zu tun. Mit Sicherheit war der Junge am Tisch nicht älter als achtzehn oder neunzehn Jahre. Und wenn er sich nicht benähme wie ein Tier, so dachte das Mädchen, und wenn er ein wenig mehr Wert auf seine äußere Erscheinung legen würde, so wäre er beinahe als schön zu bezeichnen. Es stand vollkommen außer Frage, was er von ihr wollen würde, wenn er zu Ende gegessen hätte. Aber dennoch, besser dieser, fand das Mädchen, als einer der anderen. Denn die anderen Männer waren ihrer Ansicht nach nichts weiter als stinkend, roh und widerwärtig. Und vielleicht würde dieser Junge sie hinterher sogar gehen lassen, wenn sie fügsam war und sich ihm ohne Widerstand überließ. Er war doch noch ein halbes Kind und sie nichts weiter als ein armes Mädchen, das ihm überhaupt nichts getan hatte. Weshalb sollte es ihn denn danach verlangen, sie zu töten?
Das Mädchen fuhr mit Entsetzen zusammen, als sie wahrnahm, dass der Junge sie wohl bereits seit einer ganzen Zeit beobachtete. Seine Augen waren voller Kälte und Härte und es war nicht das geringste Mitgefühl in ihnen auszumachen. Nein, er würde sie niemals gehen lassen. Er würde sie den anderen Männern übergeben, sobald er mit ihr fertig wäre, und dies würde sie mit Sicherheit nicht lebend überstehen.
„Räum den Tisch ab!“, befahl der Junge. Er klang ein wenig ruhiger als zuvor, vermutlich weil sein Hunger nun gestillt war.
Das Mädchen trug den Teller zum Eimer mit dem Brunnenwasser hinüber. Die Küchentür stand offen und der davor liegende Hof war leer. Wenn es ihr gelang, den Jungen irgendwie außer Gefecht zu setzen, und wäre es nur für einen Augenblick, dann bot sich ihr vielleicht eine Möglichkeit zu entkommen. Das Mädchen warf einen Blick nach dem Jungen. Er war abgelenkt und mit dem Binden seines Stiefels beschäftigt und nahezu unmerklich griff sie nach einem der spitzen Küchenmesser.
Schließlich erhob sich der Junge und trat langsam auf das Mädchen zu, während sich dessen Finger um den Griff des Messers krallten.
„Glaubst du, ich weiß nicht, was du hinter deinem Rücken versteckst?“, fragte er leise. „Nur zu, ich gebe dir einen Versuch.“ Er selbst war unbewaffnet, vermutlich steckte sein Schwert immer noch im Körper des Burgherrn.
Die Hand des Mädchens mit dem Messer schnellte vor, doch er wich ihr mühelos aus. Dann riss der Junge das Mädchen herum und einen Augenblick später fiel sie tot vor ihm in die Asche der Feuerstelle.