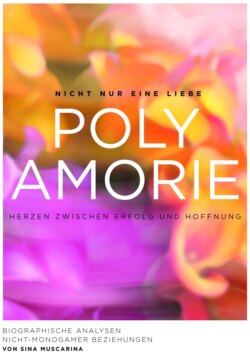Читать книгу Polyamorie - Herzen zwischen Erfolg und Hoffnung - Sina Muscarina - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Mono-normativer Bias in Psychologie und Partnerschaftstherapie
ОглавлениеIm Folgenden werden die aktuellen Leitbilder der Psychologie und Partnertherapie dargestellt, um den mononormativen Bias in der Psychologie aufzuzeigen. Dazu werden zentrale sekundäranalytische Studien in einer knappen Übersicht vorgestellt.
Der leitende Gesichtspunkt dafür ist die Mono-Normativität in wissenschaftlichen Studien über Partnerschaften und innerhalb der Psychotherapie. Marianne Pieper und Robin Bauer (2005) haben den Begriff der „Mono Normativität“ (Pieper M., Bauer R., 2005, p. 66) entworfen, um die gesellschaftliche Hegemonie der Förderung einer monogamen Paarkultur hervorzustreichen. Dieser Begriff definiert Machtverhältnisse im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs, die sich durch die Bevorzugung der monogamen Paarkultur ergeben. Daraus kann unter anderem eine Stigmatisierung von sexuellen Minderheiten (vg. Klesse 2007) entstehen.
In diesem Sinne definieren Sozialpsychologen und Konstruktivisten das Entstehen einer persönlichen Identität vorwiegend über soziale Interaktionen und im Hinblick auf die in einer Gesellschaft dominanten kulturellen Werthaltungen (vgl. Barker 2005). Barker und Ritchie (2003) reflektieren die Konstruktion von dominanten Leitbildern und Wertvorstellungen hinsichtlich Partnerschaftsformen in unserer westlichen Kultur anhand von Filmen, Pop-Songs und psychologischer Literatur und Forschung über Partnerschaften. Die Hauptelemente dieser Konstruktion sind, dass das erstrebenswerte Ideal der sexuellen Beziehungen heterosexuell und monogam sein soll.
Das Klischee, dass man nicht zwei Menschen zur gleichen Zeit lieben kann und keine Parallelbeziehung eingeht, wenn man in der Partnerschaft glücklich ist, hat in unserem westlichen Kulturkreis eine besondere Bedeutung (vgl. Griffin 2000). Diese Form von Heterosexualität wird in unserem Kulturkreis als eine stabile, dogmatische und nicht hinterfragbare Kategorie mit universeller Gültigkeit dargestellt und selten als das Konstrukt und die Erfindung einer bestimmten Kultur (vgl. Richardson 1998, zit. n. Barker & Ritchie 2003). Nicht-monogame Beziehungsformen sind nicht außerhalb des Wirkungsbereiches von Heteromononormativität bildbar und stehen unter deren Einfluss:
„The construction of the public sphere in heteronormative terms opens the possibilities for ostracising queer identities, sex, affection and relationships outside of the narrow constriction of the private sphere. […] As a result, queer sexualities (such as S/M, same-sex relationships and prostitution) may in fact be regulated by the state across the boundaries of the public/private distinction.“ (Klesse 2007, p. 134).
Jamieson (2004) sieht in ihren Forschungen aber eine Tendenz zur Lockerung dieser strengen normativen Ideale, weil das Ausleben von Sexualität außerhalb einer monogamen Partnerschaft auf mehr Akzeptanz in unserer Kultur stoße. Allerdings sei das Ideal immer noch die monogame Paarbeziehung. Um die besondere Wertschätzung der monogamen Paarbeziehung zum Ausdruck zu bringen, wird vor allem die sexuelle Exklusivität betont. Beziehungen außerhalb dieser Exklusivität nehmen die Form von heimlicher Untreue und somit Verfehlung der Partnerschaft an. Eine offene Form von nicht monogamen Beziehungen wird nicht in Erwägung gezogen (vgl. Jamieson 2004).
Im Lichte dessen definieren Reibstein und Richards (1993) die derzeit dominanten Wertvorstellungen für eine monogame Ehe.
Sie arbeiten in ihren soziologischen Studien drei Modelle für eine Ehe heraus, wie sie in unserer Kultur derzeit favorisiert und unterstützt werden:
Das Modell der alles inkludierenden Ehe , in der ein Partner die einzig wahre Liebe sei und alles miteinander geteilt würde und man sich ausschließlich aufeinander beziehe.
Weiters das Modell der segmentierten Ehe, in der man einen bestimmten Ausschnitt von gemeinsamen Vorstellungen miteinander teile, aber nicht alle, zumindest aber die Sexualität und die Liebe.
Zuletzt gäbe es das Modell der sexuell offenen Ehe, in der es gestattet sei, seine Sexualität auch mit anderen Partnern zu leben, die Liebe aber exklusiv dem Ehepartner vorbehalten bliebe (vgl. Reibstein und Richards 1993).
Die Bedeutung der Aufdeckung einer heimlichen, parallelen Beziehung in diesen Ehemodellen kann im Lichte dessen verschiedene Dimensionen annehmen:
Beim Modell der alles inkludierenden Ehe bedeutet eine aufgedeckte, ehemals heimliche, parallele Beziehung, dass der Partner etwas innerhalb der Beziehung vermisst, das man ermitteln und in die Ehe integrieren sollte. Die Intention ist also die Wiederherstellung der ursprünglichen Situation und das Beenden der parallelen Beziehung, da diese als Indikator für eine Schieflage in der ehelichen Beziehung gesehen wird. Ungelöste Eheprobleme werden als die Ausgangsbasis für das Eingehen einer parallelen Beziehung gesehen.
Beim Modell der segmentierten Ehe wird die parallel zur Ehe verlaufende, meist heimliche Beziehung als etwas Isoliertes oder sogar Komplementäres gesehen, das keinerlei Auswirkungen auf die Ehe hat. Die zumeist heimliche Beziehung wird von der sie unterhaltenden Person als Bereicherung der Ehe empfunden.
Der außereheliche Partner wird in diesem Modell vorzugsweise als Objekt und Stabilisator der ehelichen Beziehung behandelt, anstatt als eigenständiges Subjekt und eigenständige Beziehung.
Im Modell der offenen Ehe wird eine Zweitbeziehung meist nur dann geduldet, wenn es sich um eine rein sexuelle Beziehung handelt und diese Beziehung keinen zu großen Raum einnimmt. Ein Verlieben in den Parallelpartner wird meist genauso als Versagen innerhalb der Ehe gewertet wie beim Alles inkludierenden Modell (vgl. ebda.). Diese Modelle lassen sich auch auf nicht verheiratete Paare ausweiten, denn es wird im Allgemeinen vorausgesetzt und erwartet, dass man sich beim Eingehen einer Partnerschaft an monogamen Modellen orientiert (vgl. Griffin 2000).
An dieser Stelle kann man deutlich erkennen, dass bei den derzeit dominanten Wertvorstellungen für eine Ehe ein Bias zugunsten der Mononormativität und einer heterosexuellen Paarkultur vorhanden ist. Auch in der Psychologie wird generell wenig Aufmerksamkeit auf nicht-monogame Beziehungsformen innerhalb der westlichen Kultur gelenkt (vgl. Barker 2005). Die Literaturanalyse zeigt deutlich: Der herrschende Mainstream über eine beziehungspsychologische Normalität in der persönlichen Entwicklung ist das Eingehen einer lebenslangen oder seriellen monogamen Partnerschaft. Dieses Konstrukt ist die „Kernfamilie“. Die heteronormative Orientierung in der Beziehungs- und Familienforschung und auch in den Sexualwissenschaften (vgl. Klesse 2007, p. 11) zeigt deutlich, dass das Ideal der Zweierbeziehung stark in der heterosexuellen Kultur verankert ist. Individuen, die aus diesem Modell herausfallen, bleiben unbeachtet oder werden diskriminiert:
„Gayle Rubin (1992) has demonstrated that heterosexuality is integrated into a wider system of sexual stratification which does not only privilege heterosexuality, but also couplehood, monogamy, marriage, and the privatisation of sexuality. According to Rubin´s analysis, sexual acts are attributed differential status depending on which identities, genders, body parts, relationship status, styles of touch, numbers of partners and emotional undercurrents are involved.“(Klesse 2007, p. 11)
Die Leitideologie in der euro-amerikanischen Literatur und Kultur ist, dass echte Liebe nur zwischen zwei Personen wirklich wahrhaftig und verantwortungsvoll stattfinden könnte und dass diese Liebe für immer sei. Dieses kulturelle Programm verbunden mit dieser Erwartungshaltung wird als „fairy-tale-syndrom“ bezeichnet (vgl. Orion 2007, p. 3), weil die Realität der steigenden Scheidungsraten und die hohe Rate an heimlichen oder tolerierten Liebes- und Sexaffären ein anderes Bild zeigen. Weiters ist die „serielle Monogamie“, das heißt das Eingehen einer exklusiven Partnerschaft nach der anderen, derzeit der am meisten bevorzugte Partnerschaftsstil. Diese Erfahrungswerte sprechen also gegen das „one person for the rest of your life“- Ideal (vgl. Emerson, zit. nach Orion 2007, p. 3).
Nicht-monogame Beziehungen sind historisch gesehen ein Kennzeichen sexueller Liberalisierungstendenzen in der westlichen Gesellschaft (vgl. Klesse 2006). Vor allem in den 60-ern und 70-ern des vorigen Jahrhunderts haben diese Liberalisierungsbewegungen die kulturellen und politischen Diskurse in vielen sozialen Bewegungen geformt. Es wurde unter anderem mit neuen bzw. alternativen Beziehungsformen experimentiert und die „Kernfamilie“ als Repressionsinstitution kritisiert. Subkulturen entstanden, die mehr Raum für andere erotische, sexuelle und intime Identitäten geschaffen haben. Vor allem die Bewegung der Homosexuellen hat ein reichhaltiges Repertoire an nicht-monogamer Sexualität und Intimität entwickelt (vgl. ebda). Der Psychotherapeut Ellis hat erstmals 1958 sein Werk „Sex without guilt in the 21st century“ publiziert, bei dem er unter anderem in einem Kapitel über seine Erfahrungen mit der Zensur seines Buches aufgrund seiner sehr liberalen Einstellung zu Sex und Beziehungen spricht. In diesem Buch beschreibt er die Entstehung von neuen Formen nicht-monogamer Beziehungen und spricht sich für einen Wertepluralismus in persönlichen Beziehungen aus:
„Being passionately in love with two people simultaneously often leads to complications in our culture. But the fact remains that few individuals passionately love only one person for their entire lifetime. Many are deeply in love several times during their lives and in some of these instances they passionately love two or more persons simultaneously“ (Ellis 2003,p. 124)
Rogers hat 1972 sein Werk „Becoming Partners“ publiziert, in dem er wertneutral über ein Experiment einer offenen Ehe berichtet:
„When you have an internal center of evaluation, it is this […] type of judgement on which you rely and which guides your next behaviours. It also implies that you are not governed by the „shoulds“ and „oughts“ which all aspects of our culture are so ready to substitute for the values you are discovering in and by yourself.“ (Rogers, 1972, p. 208)
Rogers plädiert hier für ein Wertesystem, das sich nicht an den Restriktionen unserer normativen Gesellschaft orientiert, sondern an einem jeder Person innewohnenden, davon unabhängigen Wertesystem.
Die Partnertherapeuten Nena und George O´Neill publizierten 1972 ihr Buch „Open Marriages“, in dem sie empirische Studien mit Personen, die unter anderem nicht-monogame Beziehungsformen führten, durchgeführt haben (Robbins 2005, Keener 2004).
Nach einem Aufbruch in den 1960er Jahren sind zwei Dekaden später in der Literatur spürbare Tendenzen zur Restauration älterer ordnungsökonomischer und ordnungspolitischer Vorstellungen zu verzeichnen. Das gilt im Besonderen auch für die Zurückdrängung von Experimenten im Umkreis des Austestens nicht-monogamer und nicht-institutionell zentrierter Lebensformen. Eine politisch und ökonomisch motivierte Abwertung der Alternativen fand im Zeichen der Rückkehr zu konventionellen Lebensformen statt (vgl. Rubin 2001, Keener 2004, Robbins 2006, Barker 2004 u.a.). Wilske (2006) sieht in diesem in den 80er Jahren aufgekommenen geistigen Klima, das dazu tendiert, die 68er-Bewegung häufig negativ zu beurteilen (in Presse und Literatur), einen weiteren Hinweis für diesen „Rollback“ (Restauration alter Werte) in der Herstellung von Wertorientierungen. Auch Kröll (2009) bestätigt, dass es in den 1980ern eine massive kulturelle Restaurationsbewegung hinsichtlich der traditionellen Institution der ehezentrierten Kernfamilie gegeben hat. Ausgehend von den USA ist in der Zeit der Reagan-Ära versucht worden, eine Stabilisierung der sozialen Ordnung zu schaffen, die während der Zeit der 68er-Bewegung ins Wanken geraten war.
Kritische Sozialwissenschaftler konnten feststellen, dass der ursprünglich rege Forschungsstrom zu verschiedensten Werthaltungen während der 80er zum Versiegen kam (vgl. Harrisons & Huntington 2004). Im Werk des Soziologen George Gilder hat dieser Trend seinen Ausdruck und seine öffentliche Unterstützung gefunden, im Sinne von Restaurationstendenzen der vorherrschenden Mainstream-Kultur (Hecker 2002). Gilder, ein Unterstützer der amerikanischen republikanischen Partei, für die er auch Reden verfasste, kritisierte den Feminismus und die sexuelle Liberalisierung, indem er unter anderem damit argumentierte, dass diese liberalen Tendenzen die sozialisierte Position von Männern als Väter und finanzielle Unterstützer untergraben, und somit im weiteren Sinne auch den Kapitalismus unterwandern (vgl. Kröll 2008). Forschungen und Bücher zu alternativen Lebensvorstellungen werden vorwiegend im Eigenverlag oder in Kleinverlagen gedruckt, was konkret auch bei Literatur zu nicht-monogamen Beziehungen festgestellt werden kann (vgl. Robbins 2005):
Robin und Bauer (2006) sehen Forschungen zu nicht-monogamen Beziehungen zu einem grossen Teil ausgeschlossen aus dem Wissenschaftsdiskurs, weil der wissenschafliche Fokus einen Bias zugunsten der Erforschung monogamer Beziehungswelten nachweist.
„Non-monogamous patterns of intimacy as a valid way of relating continue to be largely excluded from the social scientific discourse, since theories of and research on primary relationships are rooted in a mono-normative perspective.“ (Robin M. & Bauer R., 2006, p.?)
Harrisons und Huntingtons Buch „Streit um Werte“ (2004) kann unter anderem als Beispiel für jene Restaurationstendenzen im Zuge einer Sorge um soziale Stabilität interpretiert werden. In einer darin veröffentlichten Studie von Edgerton ist unter anderem ein Plädoyer für alte ökonomische und soziale Stabilitätswerte herauszulesen, unter anderem auch für die Erhaltung der ehezentrierten Kernfamilie:
„Der Glaube, […] dass das Leben früher idyllischer war als heute und dass die Menschen ein Gemeinschaftsgefühl hatten, das ihnen verloren ging, spiegelt sich nicht nur in Filmen und Romanen unserer populären Kultur, sondern ist auch im Gelehrtendiskurs tief verankert. Dieser Auffassung zufolge ist menschliches Elend die Folge des Zerfalls der Gesellschaft […], von Klassenkämpfen und konkurrierenden Interessen, die große Gesellschaften […] plagen.“ (Edgerton in Harrison & Huntington 2002, p. 190)
Im Zuge dessen ist auch in der Psychologie ein massiver Rückgang in den Forschungen zu alternativen Lebensstilen festzustellen, d.h. es gibt einen akademischen Bias zugunsten der Monogamie und der Kernfamilie als Norm in der Psychologie (vgl. Keener 2004). Robbins (2005) erklärt hierzu:
„The lack of research may reflect biases supposedly moral and ethical, and may additionally indicate a shortage of funding and support for the investigation of polyamorous relationship practises.“ (Robbins, 2005, p. 8)
Es wird hier deutlich, dass Möglichkeiten alternative Lebensformen zu erforschen, beschnitten werden können, sowohl durch einen ethischen Bias als auch finanzielle Grenzen durch fehlende Forschungsgelder. Rubin (2001) erklärt das fehlende Interesse folgendermassen:
„A lack of research funding and limited academic rewards for examining personal and family choices that are often viewed as being at odds with achieving status, acceptance, and success in contemporary society may be an[…] explanation.“ (Rubin, 2001, p. 712)
Jackson (2003) und Barker (2005) erklären dieses Phänomen unter anderem in einer möglicherweise bedrohlichen Wirkung, die diese Lebensformen auf die als stabil angenommenen sozialen Werthaltungen ausüben, denn alternative Lebensformen wie nicht-monogame Lebensformen problematisieren und hinterfragen die dominante Art, über Beziehungen zu denken, und werden daher entweder dämonisiert oder verdrängt. Bei dieser Form eines Umgangs mit einem Konflikt kann das Interesse der Aufrechterhaltung von bestehenden Machtstrukturen gelten (vgl. Wimmer 2005). Demzufolge gibt es in der Paradigmenbildung der okzidental orientierten Sozial- und Kulturforschung eine meist implizite Tendenz, den Konflikt im Namen einer Ordnungsharmonie abzuwerten, das heißt ihn als zerstörerisches Element für die hegemoniale soziale Ordnung und deren reibungsloses Funktionieren zu interpretieren (vgl. Coser 1956 zit. n. Wimmer 2005).
Die Ursache von Fehlverhalten wird in der Psychologie meist in der Psyche der Individuen gesucht und soll durch Integration und Einfügen des Individuums in die soziale Ordnung behoben werden. Integration geschieht hier durch Normierungen und Therapie, um soziale Gesundheit zu ermöglichen. Die Aufrechterhaltung der strukturellen Ordnung im Sinne einer Stabilität wird als positiv erachtet, die negativen Konsequenzen eines vielleicht zu starren Systems oder die positiven Potenziale zur Veränderung des Systems werden nicht ins Auge gefasst. Ein Konflikt wird per se als Abweichung gesehen, aus dem Bild einer funktionierenden Gesellschaft ausgegrenzt und auf individuelles Fehlverhalten reduziert (vgl. Wimmer 2005).
Vor diesem Hintergrund wird die Konfliktbewältigung innerhalb einer Beziehungsstruktur nicht als Trigger zum Wandel von Bedingungen vorgenommen, sondern als Hinweis zur Wiederanpassung und Eingliederung der Individuen an die Normen vorgegebener Strukturbedingungen. Coser thematisiert den Konflikt aber als Chance zu einem soziokulturellen Wandel von Strukturbedingungen, die mitunter auch krank machen können (vgl. Wimmer 2005). In der Psychologie kann so eine Tendenz gesehen werden, alternative Lebensformen als problematisch und abnormal zu porträtieren (vgl. Rubin 2001). Nicht-monogame Lebensformen werden in unserer Kultur in der Regel ausgeblendet, und in den wenigen Fällen, wo sie zur Sprache gebracht werden, liegt der Fokus meist darauf, diese Lebensformen als seltsam oder dysfunktional zu präsentieren (vgl. Barker 2005).
Anderlini-D’Onofrio (2005) stellt fest, dass westliche Kulturen Monogamie mit der Fähigkeit zur wahren Liebe verknüpfen würden. Dementsprechend sei in der Literatur eine Tendenz festzustellen, sich gegenüber nicht-monogamen Kulturen aus diesem Grund überlegen zu fühlen – gelegentlich begleitet von einer unterschwelligen Tendenz, diese zu beneiden. Es gibt nur wenig wissenschaftliche Literatur über positive Aspekte von nicht-monogamen Beziehungen. In ihrer Literaturanalyse stellt Robbins (2005) fest, dass die wissenschaftliche Literatur über nicht-monogame Beziehungen hauptsächlich die negativen Aspekte dieser Lebensform herausgreife und typischerweise einen ganz bestimmten kulturellen, religiösen oder sozialen Kontext als Norm präsentiere (vgl. Robbins 2005). Orion (2007) assoziiert hier einen Zusammenhang zwischen der Ablehnung von nicht-monogamen Beziehungen und der negativen Bewertung von patriarchaler Polygynie durch unsere Kultur. Nicht-monogame Beziehungen werden als etwas gesehen, das nur Männern als Unterdrückern der Frau zugute kommt und nicht als etwas, das auch Frauen zu gute kommen kann.
Masson (1988) kritisiert, dass auch die Psychotherapie nicht immun sei gegen politischen und ideologischen Druck. Menschen, die versuchen würden, nichtkonformistisch zu leben, würden Gefahr laufen, unter Umständen in bestimmte Kategorien für Abweichungen von der Norm eingeteilt zu werden, oder veranlasst werden, sich an die vorherrschende Norm anzupassen. Psychotherapie könne unter anderem auch als Ausdruck der vorherrschenden Meinung in einer Gesellschaft gesehen werden. Einen weiteren Hinweis dafür, dass die Psychotherapie einen stabilisierenden Einfluss auf die Erhaltung dominanter Leitbilder unserer Kultur bieten könnte, liefert Ernst Bornemann (1997) mit seiner Kritik am Boom der Psychogruppen seit den 70ern: Durch die Reduktion auf das Subjekt in diesen Gruppierungen werde die Gesellschaft entpolitisiert. Es sei eine Illusion, dass die gesellschaftsbedingte Entfremdung und Fassadenhaftigkeit durch die Begegnung in einer Psychogruppe verändert werden könne. Die Energien, die in einer Psychogruppe entfacht werden, gingen unter anderem gesellschaftsverändernden Zwecken verloren, weil so das Anliegen des Klienten kurzfristig gemindert und auf ein persönliches Problem reduziert werde. Es bliebe daher die Illusion aufrecht, dass die Probleme des Klienten größtenteils privater Natur seien und nicht gesellschaftsbedingt erzeugt werden (vgl. Bornemann 1997). Masson kritisiert im selben Ton (1988), dass Therapeuten eine Tendenz hätten, die Schwierigkeiten ihrer Klienten als selbsterzeugt und rein subjektiv zu sehen. Sie sähen die Klienten wenigstens zum Teil für ihre Probleme verantwortlich und würden weniger gesellschaftliche Ursachen annehmen. Auch in den Diskursen über Selbsthilfe werde eine starke Tendenz sichtbar, soziale Prozesse zu psychologisieren und auf das Individuum zu beschränken. Diese Kritik kann auch auf die aktuell zugängliche Selbsthilfe-Literatur in Bezug auf nicht-monogame Beziehungen erweitert werden, weil dort dieselben Tendenzen sichtbar werden. Im Lichte dessen wird ignoriert, wie Gefühle in einer ganz bestimmten historischen Gegebenheit und unter ganz bestimmten Machtverhältnissen konstruiert werden (vgl. Klesse 2006).
Diesbezüglich hält Hillman (1993) fest, dass die dominierende Sprache in der Psychotherapie hinsichtlich Familie und Beziehungen zum großen Teil in Bezug auf das Aufrechterhalten von oder einer Rückführung zu den alten familiären Werten der Kernfamilie formuliert sei. Er sieht aber aktuelle soziologische Gegebenheiten und Wandlungen dagegen sprechen, weil die Kernfamilie in dieser Form nicht mehr das dominante Muster darstellt. Die aktuellen Muster des familiären Zusammenlebens und wie Leute sich beziehungsmäßig untereinander verhalten, zeugen von einer massiven Veränderung dieser Werte. Hillmann kommt zu dem Schluss, dass das Ideal der Kernfamilie und dementsprechende soziale Beziehungen nur in der Fantasie der Psychotherapeuten existieren, die auf ein bestimmtes bürgerliches zahlungsfähiges Klientel zugeschnitten sei:
„The government and therapy are in symbiotic, happy agreement on the propaganda […] about family. Yet family, we know sociologically, does not exist anymore. […] Ad the actual patterns of family life, how people feel and act in the families that still exist have changed radically. […]. The idea of family only exists in the bourgeois patient population that serves psychotherapy. In fact, the family is largely today a […] therapist's fantasy.“ (Hillmann, 1993,p. 13)
Die von bürgerlichen Traditionen beeinflusste Therapielandschaft mystifiziert dieses Ideal bewusst, mit dem Ziel Klienten zu erhalten:
„For therapy, it’s keeping up an ideal in place so that we can show how dysfunctional we all are. It keeps the trade going […]. We need clients.“ (Hillmann, 1993, p. 14)
Hillmann sieht die Aufrechterhaltung des Ideals der Kernfamilie so als Methode , um zu zeigen, wie dysfunktional potentielle Klienten seien und daher dringend eine Therapie benötigen. Aus dem Mainstream einer partnerpsychologischen Normalität fallen nach dem Paartherapeuten Mary (2002) unter anderem die Partnerschaften, die mit alternativen (zum Beispiel nicht-monogamen) Beziehungsformen experimentieren, heraus. Mängel in einer normalen monogamen Partnerschaft führen Partnerschaftstherapeuten tendenziell zumeist nicht auf einem Mangel an der Institution Ehe oder auf die psychischen Kosten lebenslanger Monogamie zurück, sondern auf die Persönlichkeit des betreffenden Menschen:
„Kann man sich beispielsweise eine Paartherapie vorstellen, die den Seitensprung oder die Nebenbeziehung fördert und Hilfe bei der Bewältigung dabei entstehender Unsicherheiten und Ängste anbietet? Wohl nur in Ausnahmefällen. Was wird zum Beispiel ein Paar erleben,das mit der Vorstellung zum Therapeuten kommt: „Wir wollen Nebenbeziehungen integrieren und brauchen ihre Hilfe“. Das würde nicht zum propagierten Konzept der personalen Ganzliebe passen und ist in den Ausbildungsplänen der therapeutischen Institute nicht enthalten, weil es der staatlich und fachlich anerkannten Therapie […] zuwiderläuft.“ (Mary, 2005, p.27)
Mary hält auch fest, dass das therapeutische Interesse einer Paartherapie ist, Hilfe zu bieten bei der Anpassung an die hegemoniale soziale Ordnung. Eine Paartherapie ist als Unterstützung von traditionellen Beziehungsmustern gedacht. Nicht-monogame Beziehungskonzepte gehören nicht zum Konzept der alles inkludierenden Liebe,und sind daher in den Ausbildungsplänen der Paartherapeuten nicht berücksichtigt. Dreierbeziehungen finden somit unter dem Rahmen einer Paartherapie selten Platz (vgl. Baumgart 2006). Schon das Setting einer Therapie enthält so eine kulturelle Wertung:
„Eine Art der Kommunikation zwischen Klient und Therapeut ist bereits die Therapieform. […] Dass man […] manipuliert, ist selbstverständlich. Auch die Anwendung von Deutung hat etwas Direktives, und alleine das Setting […] enthält bereits eine Wertung, nämlich zugunsten des Systems der Ehe im Falle der Gemeinsamkeit, und zugunsten des individuellen Wachstums im Falle der Einzelarbeit.“ (Baumgart, 2006, p.279)
Die Methode der Therapie enthält bereits einen Bias zugunsten einer bestimmten Lebens- oder Liebesform. In einer Paartherapie liegt diese kulturelle Wertung zugunsten der monogamen Zweierbeziehung, wie auch Rubin betont:
„Marital and family therapy is based on the traditional monogamous, nuclear family model, which inadequately prepares clinicians for dealing with alternative lifestyles such as swinging, group sex, group marriage and communes.“ (Rubin, 2001, p. 723)
Auch Robbins (2005) hebt nach Durchsicht der vorherrschenden Literatur über nicht-monogame Beziehungen hervor, dass nicht-monogam lebende Personen sozial und auch in einem klinischen Setting häufig stigmatisiert werden. Eine monogame Beziehung wird als die beste mögliche Form von Partnerschaft angenommen, und Personen, die dem nicht entsprechen, werden pathologisiert. Gängige stereotype Vorurteile im Diskurs zu nicht-monogamen Beziehungen sind nach Robbins zum Beispiel, dass nicht-monogame Personen nur in dieser Form der Beziehung verweilen würden, weil sie nicht fähig seien, sich in einer Partnerschaft verbindlich einzulassen und Verantwortung zu übernehmen. Oftmals wird auch nur der sexuelle Aspekt von nicht-monogamen Beziehungen hervorgehoben und als Unfähigkeit gesehen, sich für einen bevorzugten Partner zu entscheiden und Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen. Orion (2007) ergänzt dazu, dass typische Vorurteile in einem klinischen Setting seien, dass nicht-monogame Menschen sexsüchtig wären und Probleme mit partnerschaftlicher Bindung hätten. Meist werden negative Persönlichkeitsmerkmale als Hintergrund für die Disposition zu einer nicht-monogamen Beziehung angenommen. Diese Persönlichkeitsmerkmale gelten als Hinderungsgrund für eine Bindung in einer als normal geltenden Beziehung.
Rodemaker (2007) bestätigt bis dato einen Bias zugunsten von lebenslanger oder serieller Monogamie bei der Ausbildung zum Familientherapeuten, Partnertherapeuten oder ähnlichen Domänen in den USA. Dieser Bias ist an der für die Ausbildung empfohlenen Literatur sichtbar und wird auch an den gängigen Selbsthilfebüchern am Markt deutlich. Laut Mary (2002) sind alternative Beziehungskonzepte in den Ausbildungsplänen der therapeutischen Institute auch in Europa nicht vorgesehen.
Giddens hingegen (1992) sieht konträr zu dieser Kritik die Entstehung einer Kultur der Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeliteratur als positiven Aspekt der individuellen Fähigkeit, Reflexionen über sich selbst zu betreiben und sich in der Folge mit Möglichkeiten auszustatten, die einem mehr Macht geben, sich selbst und seine Beziehungen den individuellen Ansprüchen nach zu verändern und zu gestalten. Daraus können sich unter Umständen auch gesellschaftspolitische Anliegen entwickeln.
Therapien und Selbsthilfegruppen in Bezug auf Partnerschaft sind zusammenfassend unter mehreren Perspektiven zu sehen. Zum einen ermöglichen sie die Teilnehmer zu einem Erfahrungsaustausch, dessen Ziel es ist, sich über die eigenen Motive, Gefühle und Befindlichkeiten klar zu werden. Das Setting von Selbsthilfegruppen oder Therapien erlaubt es, in einem geschützten Rahmen über eigene Probleme zu reden und die Probleme anderer Menschen kennen zu lernen und so neue Optionen und Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Grenzen dieses Erfahrungsaustausches liegen in dem Setting einer Therapie oder einer Selbsthilfegruppe selbst, weil diese ihrerseits Werthaltungen und Normen propagieren oder unterstützen. Das kann in der Folge die Gefahr bergen, sich manipulativ und restriktiv auf die Interaktion zwischen Klient und Therapeut auszuwirken.
Klesse (2007) sieht weiters auch, dass die nur spärlich vorhandene Selbsthilfeliteratur zu nicht-monogamen Beziehungen die Hegemonie der gesellschaftlichen Zwänge, die eine monogame Paarkultur fördern, nicht in Frage stellt. Die Selbsthilfeliteratur hinterfrage tendenziell nicht Heteronormativität [2], sondern folge Tendenzen zur Machtvermeidung.
Der Begriff der Machtvermeidung (Frankenberg zit. nach Klesse 2007) beschreibt eine Weigerung von privilegierten Personen, sich mit gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen auseinanderzusetzen und sich aktiv mit der Bearbeitung von aktuellen Machtverhältnissen zu beschäftigen (Klesse 2007, Noel 2006). In Bezug auf nicht-monogame Beziehungen wird das dieserart erläutert:
„Der philosophische Individualismus, der das psychologische Modell egalitär-vertraglicher Aushandlung und intersubjektiven Gefühlsmanagements, das diese Ratgeber propagieren, trägt, verhindert eine aktive Bearbeitung struktureller Machtungleichheiten in […] Beziehungen.“ (Easton & Klesse 2006, p. 3)
Die Betonung einer individuellen sozialen und politischen Gleichheit in der Möglichkeit zur Gestaltung von Beziehungen in Beziehungsratgebern negiert praktisch die Auswirkungen einer eventuellen Machtungleichheit aufgrund sozialer Strukturen zwischen Partnern.
„Die Vision eines universellen […] Affektes, einer einheitlichen Gefühlskultur, wird nicht durch eine kritische Reflexion kultureller Differenzen oder einer Benennung emotionaler und materieller Gewaltverhältnisse […] ergänzt. Die optimistische Einschätzung, dass es möglich sei, bestimmte Probleme zu lösen, wenn wir über genügend Selbsterkenntnis verfügen und sensible Techniken der Kommunikation und des Gefühlsmanagements anwenden, verschleiert die subtile Normativität hinsichtlich Identität, Beziehungserwartungen oder partnerschaftlicher Dynamik, die sich in den Ratschlägen der Experten offenbart.“ (Klesse 2007, p. 2)
Klesse bringt hier zum Ausdruck, dass bei der Bearbeitung von bestimmten Beziehungsproblemen ein reiner Bezug zur individuellen Persönlichkeit von der impliziten Normativität ablenkt, die durch Beziehungsratgeber selbst veranschlagt wird. Es wird von einer einheitlichen, normativen Gefühlskultur ausgegangen, in der emotionale oder materielle Machtverhältnisse ausgeblendet werden, und in der es möglich sei, Probleme durch egalitäre Kommunikationstechniken zu lösen. Infolgedessen betont Klesse, dass dadurch einer Machtvermeidung Vorschub geleistet wird, weil strukturelle Probleme in einer heteronormativen Gesellschaft nicht durch Selbsterkenntnis und Veränderungen der eigenen Person oder der Partnerschaft gelöst werden können. Auch Mary sieht hier Grenzen der Paartherapie:
„Gott sei Dank lässt sich nicht jedes Thema therapeutisch bearbeiten. Würde es gelingen, alle Paare auf partnerschaftliche […] Normalität hin zu lenken und […] Störendes grundsätzlich zu eliminieren […], wäre die weitere Entwicklung von Beziehungsformen blockiert.“ (Mary, 2005, p. 30)
Mary sieht hier störende Einflüsse in einer Beziehung als Potenzial für die Weiterentwicklung von Beziehungsnormen und Beziehungspraxen, die über den mono-normativ verankerten Diskurs von Beziehungswelten hinaus verhilft.
Klesse führt in diesem Sinne allerdings ergänzend aus, dass persönliche Grenzüberschreitungen alleine stehend keinerlei Auswirkungen auf politische und andere normative Strukturen hätten, weil dafür auch öffentliche Aktivitäten notwendig seien:
„Even if the living conditions for queers have undoubtedly been improved thanks to the struggles of progressive social movements campaigning around gender and sexuality, the state has continued to promote heteronormative discourses on what it means to be a proper and valuable citizen and has created the material conditions for a secondary citizenship status for queer people.“ (Klesse 2007, p. 134).
Weiters kritisiert Klesse selbst in den Diskursen über Polyamorie eine Tendenz dazu, jede andere nicht-monogame Form von Beziehung als negativ zu stigmatisieren:
„While some claim polyamory to be an oppositional discourse, sex radicals contest the over emphazis on love and intimacy in the stylisation of polyamory as ,responsible non-monogamy‘. This conflict shows that polyamory creates it’s own margins of less condoned styles of non-monogamy which are to a stronger degree motivated by an endorsement of sexual pleasure.“ (Klesse 2007, p. 18).
Durch die Betonung von Polyamorie als „verantwortungsvolle“ Form von Nicht-Monogamie wird automatisch jede andere Beziehungsform als weniger oder nicht verantwortungsvoll normiert:
„Polyamory discourses potentially reinforce the stigmatisation of people who seek sex for the sake of sexual pleasure, have ,unreasonable‘ numbers of sexual partners, or do not look for long-term intimate relationships.“ (Klesse 2007, p. 111).
Klesse kritisiert, dass unter solchen Umständen keine vielfältige queere [3] Beziehungswelt politisch verteidigt werden könne. Progressive soziale Bewegungen sollten vermeiden, die Marginalisation von einigen sexuellen Praktiken und Beziehungswelten zu verstärken.
„The presentation of polyamory as ,responsible non-monogamy‘ is based on the attempt to challenge the negative assumptions of non-monogamous people as promiscuous, over-sexed, self-obsessed, irrational and pathological. However, rather than deconstructing exclusive assumptions at the heart of promiscuity discourses, many polyamorous people deploy an argumentative strategy that aims at demonstrating that the promiscuity allegation is not applicable to themselves. […] This distinction follows […] the desire for an imaginary inclusion […] [into the heteronormative status quo]. […] The problematic dichotomies getting established in polyamory discourses are ,the good polyamorist‘/,the bad swinger‘ or the ,responsible non-monogamist‘/,the promiscuous queer‘.“ (Klesse 2007, p. 112)
Der Terminus „verantwortungsvolle Nicht-Monogamie“, der manchmal in der Literatur über Polyamorie verwendet wird, leistet einer Stigmatisierung von jeder anderen Form von Nicht-Monogamie Vorschub und unterwirft sich damit weiterhin Mono-Normativität, weil er sozusagen als Rechtfertigung gegenüber Vorurteilen dient.
In diesem Kapitel wurden Vorurteile und Vorbehalte gegenüber Polyamorie von einem mono-normativen Standpunkt beleuchtet und auch Vorurteile der polyamorösen Subkultur gegenüber anderen Vertretern von nicht-monogamen Beziehungen aufgezeigt. Es wurde weiters verdeutlicht, dass es aufgrund repressiver sozialer Normen in Sinne von Mono-Normativität nicht möglich ist, eine polyamoröse Kultur in sich abgeschlossen als monadischen Raum zu beschreiben, weil immer auch Vernetzungen und Verwebungen mit der herrschenden Mainstream-Kultur gegeben sind.
Für meine Arbeit interessant ist im Speziellen, ob und wie sich diese Vorurteile in der Biographie von polyamorös lebenden Menschen spiegeln, und ob und wie sich die Normen der Mainstream-Kultur in Biographien auffinden lassen.