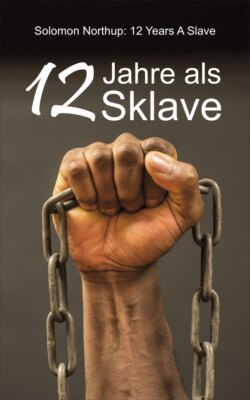Читать книгу 12 Jahre als Sklave - Solomon Northup - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL III.
SCHMERZHAFTE ÜBERLEGUNGEN – JAMES H. BURCH – WILLIAMS’ SKLAVENPFERCH IN WASHINGTON – DER LAKAI RADBURN – ICH BEHARRE AUF MEINER FREIHEIT – DER ZORN DES HÄNDLERS – DAS PADDEL UND DIE NEUNSCHWÄNZIGE KATZE – DIE ZÜCHTIGUNG – NEUE BEKANNTE – RAY, WILLIAMS UND RANDALL – ANKUNFT DER KLEINEN EMILY UND IHRER MUTTER IM PFERCH – MÜTTERLICHER KUMMER – DIE GESCHICHTE ELIZAS.
Etwa drei Stunden vergingen, während derer ich auf der niedrigen Pritsche sitzen blieb, in schmerzhafte Überlegungen versunken. Schließlich vernahm ich das Krähen eines Hahnes, und bald darauf drang ein fernes, polterndes Geräusch an meine Ohren, wie von Kutschen, welche durch die Straßen eilten, und ich wusste, dass es Tag war. Jedoch fiel nicht ein einziger Lichtstrahl in mein Gefängnis. Schließlich vernahm ich Schritte direkt über mir, als ob dort jemand hin und her schritt. Es kam mir der Gedanke, dass ich mich in einem unterirdischen Raum befände, und der feuchte, schimmlige Geruch des Ortes bestätigte meinen Verdacht. Der Lärm über mir dauerte mindestens eine Stunde an, als ich schließlich Schritte von draußen nahen hörte. Ein Schlüssel klapperte im Schloss – eine massive Tür schwang in ihren Angeln auf, ließ eine Lichtflut herein und zwei Männer traten ein und standen vor mir. Einer von ihnen war ein großer, kräftiger Mann, von vielleicht vierzig Jahren, mit dunklem, kastanienbraunem Haar, ein wenig mit Grau durchsetzt. Sein Gesicht war voll, sein Teint gerötet, seine Züge waren grob und derb, und drückten nur Grausamkeit und Arglist aus. Er war ungefähr fünf Fuß und zehn Zoll groß, von fülliger Statur, und man gestatte mir ohne Vorurteil zu sagen, dass er ein Mann war, dessen ganze Erscheinung bösartig und abstoßend war. Sein Name war James H. Burch, wie ich später herausfand – ein wohlbekannter Sklavenhändler in Washington; und damals oder zumindest bis vor kurzem als Geschäftspartner verbunden mit Theophilus Freeman aus New Orleans. Die Person, welche ihn begleitete, war ein einfacher Lakai namens Ebenezer Radburn, der nur als Gefangenenwärter fungierte. Beide Männer leben immer noch in Washington, oder taten es zur Zeit meiner Rückkehr aus der Sklaverei durch diese Stadt im letzten Januar.
Das Licht, welches durch die offene Tür fiel, befähigte mich, den Raum zu betrachten, in dem ich festgehalten wurde. Er maß etwa zwölf Fuß auf jeder Seite – die Wände aus stabilem Mauerwerk. Der Boden bestand aus schweren Holzbohlen. Es gab ein kleines Fenster, von dicken, gekreuzten Eisenstangen versperrt und einer äußeren Fensterlade, die sicher befestigt war.
Eine eisenbeschlagene Tür führte in eine benachbarte Zelle oder ein Kellergewölbe, das völlig ohne Fenster oder eine andere Quelle von Tageslicht war. Die Einrichtung des Raumes, in dem ich mich befand, bestand aus der hölzernen Pritsche, auf der ich saß, und einem altmodischen, verdreckten Kastenofen, und abgesehen davon gab es in keiner der Zellen weder Bett noch Decke noch sonst irgendetwas anderes. Die Tür, durch die Burch und Radburn eingetreten waren, führte durch eine kleine Passage und eine Treppenflucht hinauf in einen Hof, der von einer zehn oder zwölf Fuß hohen Ziegelmauer umgeben war, unmittelbar an der Rückseite eines Gebäudes gelegen, das ebenso breit wie der Hof war. Der Hof erstreckte sich hinter dem Haus auf einer Länge von etwa dreißig Fuß. In einem Teil der Mauer war eine mit Eisen verstärkte Tür, die in einen schmalen, überdachten Gang führte, welcher an der einen Seite des Hauses vorbei zur Straße verlief. Das Verhängnis des farbigen Mannes, hinter dem sich die Tür aus jenem schmalen Gang schloss, war besiegelt. Die Mauerkrone trug eine Seite eines Daches, welches nach innen hin aufstieg und so eine Art offenen Schuppen bildete. Unter dem Dach verlief ringsum eine Art Dachboden, wo Sklaven, wenn sie denn wollten, bei Nacht schlafen oder bei unbarmherzigem Wetter Zuflucht vor dem Sturm suchen konnten. In vielerlei Hinsicht sah er wie die Scheune eines Farmers, außer dass er so konstruiert war, dass die Außenwelt niemals das menschliche Vieh sehen konnte, welches hier hindurchgetrieben wurde.
Das Gebäude, zu dem der Hof gehörte, war zwei Stockwerke hoch, und lag mit der Vorderseite an einer der öffentlichen Straßen Washingtons. Seine Außenseite gab nur den Anschein eines ruhigen Privatwohnsitzes wieder. Ein Fremder, der es ansah, hätte sich niemals seinen scheußlichen Nutzen träumen lassen. So seltsam es auch scheinen mag, deutlich in Sichtweise ebendiesen Hauses, von seiner gebieterischen Höhe auf es herabblickend, lag das Capitol. So konnten sich die Stimmen der patriotischen Repräsentanten, die von Freiheit und Gleichheit prahlten und das Klirren der Ketten jener armen Sklaven beinahe vermischen. Ein Sklavenpferch, im Schatten des Capitols selbst!
Solchermaßen ist die korrekte Beschreibung von Williams’ Sklavenpferch in Washington wie er im Jahr 1841 aussah, von einem der Keller aus, in denen ich mich so unerklärlich wiederfand.
„Nun, mein Junge, wie fühlst du dich jetzt?“, sagte Burch, als er durch die offene Tür trat. Ich antwortete, dass ich krank sei, und erkundigte mich nach dem Grund meiner Gefangenschaft. Er entgegnete, dass ich sein Sklave sei – dass er mich gekauft hätte, und dass er mich nach New Orleans schicken wolle. Ich brachte laut und deutlich zur Geltung, dass ich ein freier Mann sei – ein Einwohner von Saratoga, wo ich eine Frau und Kinder hatte, die ebenfalls frei wären, und dass mein Name Northup sei. Ich beschwerte mich bitterlich über die ungewohnte Behandlung, die mir zuteil geworden war und drohte, dass ich bei meiner Befreiung Genugtuung für das erlittene Unrecht verlangen würde. Er stritt ab, dass ich ein freier Mann sei, und erklärte mit einem einfühlsamen Fluch, dass ich aus Georgia käme. Wieder und wieder brachte ich vor, dass ich niemandes Sklave sei, und bestand darauf, dass er mir sofort die Ketten abnähme. Er war bemüht, mich zum Schweigen zu bringen, als fürchte er, meine Stimme könne gehört werden. Doch ich wollte nicht schweigen und prangerte die Urheber meiner Gefangenschaft, wer immer sie auch sein mochten, als durchtriebene Verbrecher an. Nachdem er feststellte, dass er mich nicht zum Schweigen bringen konnte, flüchtete er sich in einen gewaltigen Gefühlsausbruch. Mit lästerlichen Flüchen nannte er mich einen rabenschwarzen Lügner, einen Entflohenen aus Georgia, und belegte mich mit allen möglichen anderen profanen und vulgären Schimpfnamen, die sich eine höchst unanständige Phantasie ausdenken kann.
Während der ganzen Zeit stand Radburn schweigend neben ihm. Seine Aufgabe war es, diesen menschlichen oder vielmehr unmenschlichen Stallbetrieb zu überwachen, Sklaven entgegenzunehmen, zu füttern und sie auszupeitschen, für den Lohn von zwei Schilling pro Kopf und Tag. Burch wandte sich zu ihm um und befahl, das Paddel und die neunschwänzige Katze hereinzubringen. Er verschwand und kehrte nach wenigen Augenblicken mit diesen Folterinstrumenten zurück. Das Paddel, wie man es im Jargon der Sklavenzüchtigung nennt, oder zumindest das Exemplar, mit dem ich das erste Mal die Bekanntschaft machte, und von dem ich nun spreche, war ein Brett aus Hartholz, achtzehn oder zwanzig Zoll lang, in der Form eines altmodischen Puddingschlägers oder auch eines gewöhnlichen Ruders. Der flache Teil, der vom Umfang etwa so groß wie zwei offene Hände war, besaß an zahlreichen Stellen Löcher von einem kleinen Bohrer. Die Katze war ein dickes Tau mit vielen Strängen – die Stränge trennten sich und waren an jedem ihrer Enden mit einem Knoten versehen.
Sowie diese respekteinflößenden Peitschen erschienen, wurde ich von den beiden gepackt und grob meiner Kleidung beraubt. Meine Füße waren, wie ich bereits erklärte, am Boden befestigt. Nachdem er mich mit dem Gesicht nach unten auf die Pritsche gezogen hatte, stellte Radburn seinen schweren Fuß auf die Fesseln zwischen meinen Handgelenken, womit er sie schmerzhaft auf dem Boden hielt. Burch begann mich daraufhin mit dem Paddel zu schlagen. Hieb auf Hieb ging auf meinen nackten Leib hinab. Als sein unnachgiebiger Arm ermüdete, hielt er inne und fragte, ob ich immer noch darauf bestünde, ein freier Mann zu sein. Ich bestand darauf, und dann wurden die Schläge erneuert, schneller und energischer, wenn dies überhaupt möglich war, als zuvor. Immer wenn er ermüdete, wiederholte er dieselbe Frage, und setzte nach dem Erhalt der gleichen Antwort sein grausames Werk fort. Die ganze Zeit gab jener fleischgewordene Dämon die teuflischsten Flüche von sich. Schließlich brach das Paddel und er hielt nur noch den nutzlosen Griff in seiner Hand. Immer noch wollte ich nicht nachgeben. All seine Hiebe konnten meinen Lippen nicht die schändliche Lüge entlocken, ich sei ein Sklave. Den Griff des zerbrochenen Paddels zornig auf den Boden werfend, ergriff er das Seil. Dies war weitaus schmerzhafter als das andere. Ich strampelte mit all meiner Macht, doch es war umsonst. Ich betete um Gnade, doch mein Gebet wurde nur mit Verwünschungen und Striemen beantwortet. Ich glaubte, ich müsse unter den Peitschenhieben des verfluchten Rohlings sterben. Selbst jetzt noch geht mir eine Gänsehaut bis auf die Knochen, wenn ich mich an diese Szene erinnere. Mein ganzer Leib stand in Flammen. Mein Leiden kann ich mit nichts anderem als den brennenden Qualen der Hölle vergleichen!
Schließlich bewahrte ich auf seine wiederholten Fragen mein Schweigen. Ich gab ihm keine Antwort. Tatsächlich war ich auch kaum noch in der Lage zu sprechen. Immer noch bearbeitete er mit der Peitsche ohne Unterlass meinen armen Leib, bis es schien, als würde mir das blutige Fleisch bei jedem Hieb vom Leib gezogen. Ein Mann mit auch nur einem Körnchen Erbarmen in seiner Seele hätte keinen Hund so grausam geprügelt. Schließlich sagte Radburn, dass es nutzlos wäre, mich weiter zu peitschen – dass ich schon wund genug sei. Daraufhin ließ Burch von mir ab und sagte mit einem mahnenden Schütteln seiner Faust vor meinem Gesicht, die Worte durch seine fest zusammengepressten Zähne zischend, dass, wenn ich jemals noch einmal wagen würde zu behaupten, ich hätte ein Recht auf Freiheit, dass ich entführt worden wäre oder irgendetwas anderes in dieser Art, die Züchtigung, die ich gerade erhalten hätte, nichts sei im Vergleich zu dem, was dann folgen würde. Er schwor, dass er mich entweder unterwerfen oder umbringen würde. Mit diesen tröstlichen Worten wurden die Fesseln von meinen Handgelenken genommen, doch meine Füße blieben am Ring befestigt; der Laden an dem kleinen vergitterten Fenster, der geöffnet worden war, wurde wieder geschlossen, und nachdem sie hinausgingen und die große Tür hinter sich schlossen, war ich wie zuvor wieder allein in der Dunkelheit.
Nach einer Stunde, vielleicht zwei, sprang mir das Herz in die Kehle, als der Schlüssel erneut im Schloss klapperte. Ich, der ich so allein gewesen war, und der sich so inbrünstig danach gesehnt hatte, jemanden zu sehen, gleichgültig wen, erschauerte nun bei dem Gedanken, dass sich ein Mensch näherte. Ein menschliches Gesicht war furchterregend für mich, besonders ein weißes. Radburn trat ein, und brachte auf einem Blechteller ein Stück verschrumpeltes gebratenes Schwein, eine Scheibe Brot und einen Becher Wasser. Er fragte mich, wie ich mich fühlte, und merkte an, ich hätte eine ziemlich heftige Tracht Prügel bekommen. Er machte mir Vorhaltungen bezüglich der Schicklichkeit, auf meiner Freiheit zu beharren. In einer recht gönnerhaften und vertraulichen Manier gab er mir den Rat, dass je weniger ich zu diesem Thema sagte, desto besser es für mich wäre. Der Mann versuchte offenkundig freundlich zu erscheinen – ob ihn nun der Anblick meines erbarmungswürdigen Zustands anrührte oder mit der Absicht, jede weitere Bekundung meiner Rechte auf meiner Seite verstummen zu lassen, darüber ist es jetzt nicht nötig, zu spekulieren. Er schloss die Fesseln an meinen Fußgelenken auf, öffnete die Läden des kleinen Fensters und ging, mich wieder alleine zurücklassend.
Mittlerweile war ich steif und wund; mein Körper war mit Blasen übersät, und ich konnte mich nur unter großen Schmerzen und Schwierigkeiten bewegen. Aus dem Fenster konnte ich nichts sehen außer dem Dach, das auf der Mauer gegenüber auflag. Bei Nacht legte ich mich auf den feuchten, harten Boden, ohne ein Kissen oder irgendeine Art von Decke. Pünktlich kam Radburn zweimal am Tag herein, mit seinem Schwein und Brot und Wasser. Ich besaß nur wenig Appetit, auch wenn ich von ständigem Durst gequält wurde. Meine Wunden erlaubten mir nicht länger als ein paar Minuten in der gleichen Position zu verharren; und so verbrachte ich die Tage und Nächte sitzend oder stehend oder langsam im Kreise gehend. Ich war tiefbetrübt und entmutigt. Gedanken an meine Familie, an meine Frau und meine Kinder nahmen meinen Geist ständig in Besitz. Wenn mich der Schlaf übermannte, träumte ich von ihnen – träumte, ich wäre wieder in Saratoga – dass ich ihre Gesichter sehen könnte, und ihre Stimmen hörte, die mich riefen. Wenn ich nach den erfreulichen Trugbildern des Schlafes wieder in der bitteren Realität um mich herum erwachte, konnte ich nur noch stöhnen und weinen. Immer noch war mein Geist nicht gebrochen. Ich frönte der Erwartung meiner Flucht, und dies recht zügig. Es war unmöglich, so mein Gedankengang, dass Menschen so ungerecht sein konnten, mich als Sklaven zu halten, wenn die Wahrheit meines Falles bekannt wurde. Burch würde mich sicherlich gehen lassen, wenn er sich vergewissert hatte, dass ich kein flüchtiger Sklave aus Georgia war. Auch wenn ich nicht selten Argwohn gegenüber Brown und Hamilton hegte, konnte ich mich nicht mit der Vorstellung vertraut machen, sie wären mitschuldig an meiner Gefangenschaft. Sicherlich würden sie mich suchen – sie würden mich aus der Knechtschaft erretten. Ach! Damals hatte ich noch nicht das Ausmaß der „Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen“ gelernt, noch zu welch grenzenlosem Ausmaß an Bosheit er für seine Gewinnsucht fähig ist.
Nach einigen Tagen wurde die äußere Tür aufgesperrt, was mir die Freiheit verschaffte, den Garten aufzusuchen. Dort traf ich drei Sklaven an – einer von ihnen ein Junge von zehn Jahren, die anderen junge Männer von etwa zwanzig und fünfundzwanzig. Ich brauchte nicht lange, um mich mit ihnen bekannt zu machen und ihre Namen herauszufinden sowie die Einzelheiten ihrer Geschichte.
Der Älteste war ein farbiger Mann namens Clemens Ray. Er hatte in Washington gelebt, hatte eine Droschke gefahren und lange Zeit in einem Mietstall gearbeitet. Er war sehr intelligent und verstand seine Lage genau. Der Gedanke, nach Süden zu gehen überwältigte ihn mit Kummer. Burch hatte ihn einige Tage zuvor gekauft und ihn hier untergebracht, bis er bereit war, ihn zum Markt in New Orleans zu schicken. Von ihm erfuhr ich zum ersten Mal, dass ich in Williams’ Sklavenpferch war, ein Ort, von dem ich nie zuvor gehört hatte. Er beschrieb mir die Verwendungen, für die er angelegt war. Ich wiederholte für ihn die Einzelheiten meiner unglücklichen Geschichte, doch er konnte mir nur durch sein Mitgefühl Trost schenken. Er riet mir ebenfalls, von nun an hinsichtlich des Themas meiner Freiheit zu schweigen, denn da er den Charakter Burchs kannte, versicherte er mir, dass er nur mit einem erneuten Auspeitschen aufwarten würde. Der Nächstälteste hieß John Williams. Er war in Virginia aufgewachsen, nicht weit von Washington. Burch hatte ihn als Begleichung einer Schuld angenommen, und John hegte die beständige Hoffnung, dass ihn sein Herr zurückkaufen würde – eine Hoffnung, die sich im Nachfolgenden bewahrheitete. Der Junge war ein aufgewecktes Kind und hörte auf den Namen Randall. Die meiste Zeit spielte er im Hof, doch gelegentlich begann er zu weinen, rief nach seiner Mutter und fragte sich, wann sie kommen würde. Die Abwesenheit seiner Mutter schien die größte und einzige Sorge in seinem kleinen Herzen zu sein. Er war zu jung, um sich über seine Lage im Klaren zu sein, und wenn ihm nicht gerade die Erinnerung an seine Mutter durch den Sinn ging, amüsierte er uns mit seinen freundlichen Streichen.
Des Nachts schliefen Ray, William und der Junge auf dem Dachboden des Schuppens, während ich in der Zelle eingesperrt war. Schließlich wurden uns Decken zur Verfügung gestellt, wie sie auch auf Pferden Verwendung finden – das einzige Bettzeug, das mir in den nachfolgenden zwölf Jahren erlaubt war zu besitzen. Ray und Williams stellten mir viele Fragen über New York – wie man farbige Leute dort behandelte; wie sie denn ein eigenes Zuhause und Familien besitzen konnten, ohne dass sie jemand störte und unterdrückte; und ganz besonders Ray sehnte sich dauernd stöhnend nach Freiheit. Solche Unterhaltungen fanden jedoch nie in Hörweite von Burch oder dem Wärter Radburn statt. Bestrebungen wie diese hätten die Peitsche auf unsere Rücken niedergehen lassen.
Es ist nötig, dass ich in diesem Bericht von wohlbekannten Orten und noch lebenden Menschen spreche, damit ich eine vollständige und wahrheitsgetreue Aussage aller wichtigen Ereignisse in meinem Leben machen kann und um die Einrichtung der Sklaverei so darzustellen, wie ich sie gesehen und erlebt habe. Ich bin und war immer schon in Washington und dem dortigen Umland völlig fremd – kannte außer Burch und Radburn keinen Menschen dort, außer was ich über meine versklavten Gefährten erfahren habe. Wenn das, was ich sagen will nicht stimmt, so kann dem leicht widersprochen werden.
Ich blieb zwei Wochen lang in Williams’ Sklavenpferch. In der Nacht vor meiner Abreise wurde eine Frau hereingebracht, die bitterlich weinte und ein kleines Kind an der Hand führte. Es waren Randalls Mutter und Halbschwester. Als er ihnen begegnete, war er hocherfreut, klammerte sich an ihr Kleid, küsste das Kind und zeigte sein Vergnügen auf jede vorstellbare Weise. Die Mutter nahm ihn ebenfalls in die Arme, drückte ihn innig und blickte ihn liebevoll durch ihre Tränen an, ihn bei so manchem zärtlichen Namen nennend.
Emily, ihr Kind, war sieben oder acht Jahre alt, besaß einen hellen Teint und ein Gesicht von bewundernswerter Schönheit. Ihr Haar fiel ihr in Locken auf die Schultern, während der Stil und die Kostbarkeit ihres Kleides sowie die Ordentlichkeit ihrer ganzen Erscheinung darauf hindeuteten, dass sie inmitten von Wohlstand aufgewachsen war. Sie war in der Tat ein liebenswertes Kind. Die Frau war gleichfalls in Seide gekleidet, mit Ringen an ihren Fingern und goldenen Schmuckstücken, die von ihren Ohren hingen. Ihre Haltung und ihr Benehmen, die Korrektheit und Angemessenheit ihrer Sprache – all dies zeigte offensichtlich, dass sie einige Zeit über der gewöhnlichen Stufe eines Sklaven gestanden hatte. Was dies betrifft, schien auch sie erstaunt zu sein, sich an einem solchen Ort wiederzufinden. Es war offensichtlich eine plötzliche und unerwartete Wendung des Schicksals, die sie hierher gebracht hatte. Während sie die Luft mit ihren Klagen erfüllte, wurde sie zusammen mit den Kindern und mir in die Zelle gedrängt. Die Sprache kann nur einen unzureichenden Eindruck von dem Wehklagen vermitteln, das sie unablässig äußerte. Sich auf den Boden werfend und die Kinder mit den Armen umfassend, strömten aus ihr so anrührende Worte, wie sie nur mütterliche Liebe und Güte nahelegen kann. Sie kuschelten sich eng an sie, als gäbe es nur dort irgendeine Sicherheit oder Schutz. Schließlich schliefen sie ein, die Köpfe auf dem Schoß der Mutter ruhend. Während sie schliefen, strich sie ihnen die Haare aus ihren kleinen Stirnen und sprach die ganze Nacht zu ihnen. Sie nannte sie ihre Lieblinge – ihre süßen Babys – arme unschuldige Dinge, die nichts von dem Elend ahnten, das ihnen zu ertragen bestimmt war. Bald würden sie keine Mutter mehr haben, die ihnen Trost spendete – sie würden ihr weggenommen werden. Was würde aus ihnen werden? Oh, sie konnte nicht getrennt von ihrer kleinen Emmy und ihrem lieben Jungen leben. Sie waren immer solch gute Kinder gewesen, und hatten solch eine liebevolle Art. Gott weiß, es würde ihr Herz brechen, sagte sie, wenn sie ihr genommen würden; und doch wusste sie, dass man sie verkaufen würde, und vielleicht würden sie getrennt werden, und würden einander nie wieder sehen. Den bedauernswerten Äußerungen jener hoffnungslosen und verstörten Mutter zuzuhören, hätte ein Herz aus Stein zum Schmelzen gebracht. Ihr Name war Eliza; und dies ist die Geschichte ihres Lebens, wie sie sie mir später erzählte:
Sie war die Sklavin von Elisha Berry, einem reichen Mann gewesen, der in der Nähe von Washington lebte. Ich glaube, sie sagte, dass sie auf seiner Plantage geboren worden war. Jahre zuvor war er zügellosen Gewohnheiten verfallen, und hatte sich mit seiner Ehefrau gestritten. Tatsächlich trennten sie sich kurz nach der Geburt von Randall. Seine Frau und seine Tochter in dem Haus leben lassend, das sie schon immer bewohnt hatten, erbaute er in der Nähe ein neues HHhhHHHHHHHSFDHaus auf seinem Grundstück. In dieses Haus brachte er Eliza mit; und unter der Bedingung, dass sie mit ihm zusammenlebte, sollten sie und ihre Kinder freigelassen werden. Sie wohnte dort mit ihm neun Jahre lang, mit Dienern, die ihr aufwarteten, und mit jeder Bequemlichkeit und Annehmlichkeit des Lebens ausgestattet. Emily war sein Kind! Schließlich heiratete ihre junge Herrin, welche die ganze Zeit bei ihrer Mutter in ihrem alten Zuhause gelebt hatte, einen gewissen Mr. Jacob Brooks. Letztlich wurde aus irgendeinem Grund, (wie ich aus ihrer Erzählung schloss,) der außerhalb von Berrys Einfluss lag, sein Besitz geteilt. Sie und ihre Kinder fielen in den Anteil von Mr. Brooks. Während der neun Jahre, die sie mit Berry gelebt hatte, waren sie und Emily als Konsequenz der Stellung, die sie gezwungen waren auszufüllen, der Gegenstand des Hasses und des Widerwillens von Mrs. Berry und ihrer Tochter geworden. Berry selbst stellte sie als Mann mit einem von Natur aus gütigen Herzen dar, der ihr immer versprochen hatte, sie solle ihre Freiheit erhalten, und der, da hatte sie keinen Zweifel, ihr diese auch gewährt hätte, wenn es nur in seiner Macht gelegen hätte. Sobald sie also auf solche Weise in den Besitz und die Kontrolle der Tochter gerieten, wurde es überdeutlich, dass sie nicht lange miteinander leben würden. Der Anblick von Eliza schien Mrs. Brooks verhasst; ebenso wenig konnte sie es ertragen, das Kind, ihre Halbschwester anzusehen, welches zudem noch so unvergleichlich schön war!
Am Tag, als sie in den Pferch gebracht wurde, hatte Brooks sie von dem Anwesen in die Stadt gebracht, unter dem Vorwand, dass die Zeit gekommen wäre, dass ihre Freiennachweise ausgestellt werden sollten, um das Versprechen ihres Herrn zu erfüllen. Erleichtert angesichts der Aussicht auf unmittelbare Freiheit, staffierte sie sich und die kleine Emmy mit ihren besten Kleidern aus und begleitete ihn mit freudigem Herzen. Bei ihrer Ankunft in der Stadt wurde sie, anstatt ihre Taufe in der Familie der Freien zu begehen, an den Händler Burch übergeben. Der Nachweis, der ausgestellt wurde, war die Quittung über ihren Verkauf. Jahrelange Hoffnung wurde in einem Augenblick zugrunde gerichtet. An diesem Tag ward sie von den Höhen höchst frohlockenden Glücks in die fernsten Tiefen des Elends gestoßen. Kein Wunder, dass sie weinte, und den Pferch mit Jammer und den Bekundungen herzzerreißenden Leids erfüllte.
Eliza ist schon tot. Weit oben am Red River, wo er seine Fluten träge durch das unzuträgliche Flachland Louisianas ergießt, ruht sie endlich in ihrem Grabe – der einzige Ruheplatz eines armen Sklaven! Wie sich all ihre Ängste bewahrheiteten – wie sie Tag und Nacht trauerte, und niemals Trost fand – wie, genau ihrer Vorhersage entsprechend, ihr Herz tatsächlich brach unter der Last mütterlichen Kummers, wird noch im Fortlauf der Erzählung zu sehen sein.