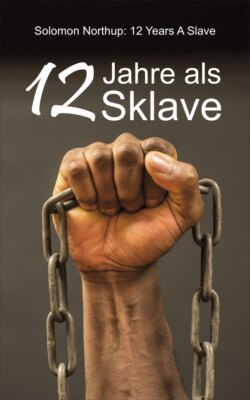Читать книгу 12 Jahre als Sklave - Solomon Northup - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL V.
ANKUNFT IN NORFOLK – FREDERICK UND MARIA – ARTHUR DER FREIE – ZUM STEWARD ERNANNT – JIM, CUFFEE UND JENNY – DER STURM – BAHAMA BANKS – DIE RUHE – DIE VERSCHWÖRUNG – DAS LANGBOOT – DIE POCKEN – ROBERTS TOD – MANNING, DER SEEMANN – DAS TREFFEN IM VORSCHIFF – DER BRIEF – ANKUNFT IN NEW ORLEANS – ARTHURS RETTUNG – THEOPHILUS FREEMAN, DER EMPFÄNGER – PLATT – ERSTE NACHT IM SKLAVENPFERCH VON NEW ORLEANS.
Nachdem wir alle an Bord waren, setzte die Brigg Orleans ihre Reise den James River hinab fort. Wir gelangten in die Chesapeake Bay und kamen am nächsten Tag gegenüber der Stadt Norfolk an. Während wir vor Anker lagen, näherte sich uns ein Leichter aus der Stadt, der vier weitere Sklaven brachte. Frederick, ein Junge von achtzehn Jahren, war als Sklave geboren, wie auch Henry, der einige Jahre älter war. Sie waren beide Hausdiener in der Stadt gewesen. Maria war ein recht vornehm aussehendes farbiges Mädchen, von makelloser Gestalt, doch unwissend und äußerst eitel. Die Vorstellung, nach New Orleans zu kommen gefiel ihr. Sie unterhielt eine übertrieben hohe Vorstellung von ihrer eigenen Anziehungskraft. Eine hochmütige Miene aufsetzend, erklärte sie ihren Gefährten, dass sie unmittelbar nach unserer Ankunft in New Orleans, da hatte sie keinen Zweifel, ein wohlhabender, alleinstehender Gentleman mit gutem Geschmack vom Fleck weg kaufen würde!
Doch der hervorstechendste der Vier war ein Mann namens Arthur. Während sich der Leichter näherte, rang er beherzt mit seinen Wärtern. Nur mit äußerster Gewalt konnten sie ihn an Bord der Brigg zerren. Er protestierte mit lauter Stimme gegen die Behandlung, die ihm zuteil wurde, und verlangte, freigelassen zu werden. Sein Gesicht war angeschwollen und mit Wunden und blauen Flecken bedeckt, und in der Tat war die eine Hälfte eine vollständige offene Wunde. Er wurde in aller Eile durch die Ladeluke in den Frachtraum gedrängt. Ich bekam einen Abriss seiner Geschichte mit, als er zappelnd über Deck getragen wurde, und von der er mir später einen vollständigeren Bericht lieferte, und der war folgendermaßen: Er hatte lange in der Stadt Norfolk gelebt und war ein freier Mann. Er hatte eine Familie, die dort lebte und war von Beruf Maurer. Nachdem er bei der Arbeit ungewöhnlich lange aufgehalten worden war, kehrte er eines Abends spät zu seinem Haus im Vorort der Stadt zurück, als er von einer Bande aus mehreren Personen auf einer unbelebten Straße angegriffen wurde. Er kämpfte, bis ihn seine Kraft verließ. Endlich überwältigt, wurde er geknebelt, mit Seilen gefesselt und geschlagen, bis er ohnmächtig wurde. Mehrere Tage lang hielten sie ihn im Sklavenpferch von Norfolk versteckt – eine sehr gewöhnliche Einrichtung, wie es scheint, in den Städten des Südens. In der Nacht zuvor hatte man ihn dort hinausgebracht und an Bord des Leichters gesteckt, der sich daraufhin vom Ufer abgestoßen und unsere Ankunft erwartet hatte. Er setzte seine Beteuerungen eine ganze Weile fort, und gab sich insgesamt unversöhnlich. Schließlich jedoch wurde er ruhiger. Er versank in eine finstere und gedankenvolle Stimmung und schien mit sich selbst ins Gericht zu gehen. In dem entschlossenen Gesicht des Mannes war etwas, etwas, das den Gedanken an Verzweiflung nahe legte.
Nachdem wir Norfolk verließen, wurden uns die Handschellen abgenommen und während des Tages war es uns gestattet, an Deck zu bleiben. Der Kapitän wählte Robert als seinen Kellner aus und ich wurde ausersehen, die Küche zu überwachen, sowie die Verteilung von Essen und Wasser. Ich hatte drei Gehilfen, Jim, Cuffee und Jenny. Jennys Aufgabe war es, den Kaffee zuzubereiten, der aus Maismehl, in einem Kessel geröstet, bestand, und mit Melasse gekocht und gesüßt wurde. Jim und Cuffee backten die Fladenbrote und grillten den Speck.
Neben einem Tisch stehend, der aus einem breiten Brett bestand, das auf einigen Fässern lag, schnitt und überreichte ich jedem eine Scheibe Speck und ein Stückchen Brot, und schüttete aus Jennys Kessel ebenfalls für jeden einen Becher Kaffee aus. Auf Teller wurde verzichtet und ihre schwarzen Finger mussten die Stelle von Messer und Gabel einnehmen. Jim und Cuffee waren sehr ernst und aufmerksam, ein wenig aufgeblasen wegen ihrer Stellung als zweite Köche, und ohne Zweifel der Meinung, eine große Verantwortung laste auf ihnen. Man nannte mich Steward – ein Name, der mir von dem Kapitän gegeben wurde.
Die Sklaven wurden zweimal am Tag gefüttert, um zehn und um fünf Uhr – erhielten immer dieselbe Art und Menge von Kost, und auf dieselbe Weise wie oben beschrieben. Bei Nacht wurden wir in den Laderaum getrieben und sicher eingesperrt.
Kaum waren wir außer Sichtweite des Landes, da wurden wir von einem gewaltigen Sturm eingeholt. Die Brigg rollte und tauchte ab, bis wir fürchteten, sie würde untergehen. Einige waren seekrank, andere auf den Knien betend, während sich einige wiederum aneinander klammerten, gelähmt vor Furcht. Die Seekrankheit machte aus dem Ort unserer Gefangenschaft etwas Ekelhaftes und Abscheuliches. Die meisten von uns wären glücklich gewesen – zumindest hätte es uns die Pein vieler hundert Peitschenhiebe und letztlich elende Tode erspart – hätte uns die mitfühlende See an jenem Tag aus den Fängen gewissenloser Männer gerissen. Der Gedanke, wie Randall und die kleine Emmy hinabsänken inmitten der Ungeheuer der Tiefe, ist eine weitaus angenehmere Erwägung als darüber nachzudenken, wie es ihnen vielleicht jetzt ergehen möge, sich ohne Belohnung durch ein Leben der Schufterei schleppend.
Als wir in Sichtweite der Bahama Banks kamen, an einer Stelle die „Alte Kompassspitze“ oder „Loch in der Mauer“ genannt wird, lagen wir drei Tage in Windstille. Es ging kaum ein Hauch von Luft. Das Wasser der Golfs zeigte sich in einer einzigartigen weißen Farbe, so wie Kalkwasser. In der Abfolge der Ereignisse komme ich nun dazu, eine Begebenheit zu erzählen, die ich mir nur mit dem Gefühl des Bedauerns ins Gedächtnis rufen kann. Ich danke Gott, der mir seither erlaubt hat, der Knechtschaft der Sklaverei zu entkommen, dass durch seine gnädige Fügung ich davon abgehalten wurde, meine Hände mit dem Blut seiner Geschöpfe zu beflecken. Doch sollen diejenigen, die niemals in solche Umstände geraten sind, nicht allzu schroff über mich richten. Bis sie angekettet und geschlagen wurden – bis sie sich in der Lage wiederfinden, in der ich war, von Heim und Familie verschleppt in ein Land der Hörigkeit – sollten sie es unterlassen, zu sagen, was sie selbst um der Freiheit willen nicht tun würden. Wie weit ich nach Ansicht von Gott und Mensch im Recht gewesen wäre, darüber ist im Augenblick keine Spekulation nötig. Es soll reichen, wenn ich sage, dass ich mich selbst zu der schadlosen Beendigung einer Angelegenheit beglückwünschen kann, die eine Zeitlang drohte, von ernstzunehmenden Folgen begleitet zu sein.
Gegen Abend am ersten Tag der Windstille waren Arthur und ich im Bug des Schiffes und saßen auf der Ankerwinde. Wir unterhielten uns über das wahrscheinliche Schicksal, das uns erwartete, und betrauerten gemeinsam unser Unglück. Arthur sagte, und da gebe ich ihm Recht, der Tod sei weitaus weniger schrecklich als die Lebensaussichten, die vor uns lagen. Eine lange Zeit sprachen wir von unseren Kindern, unseren vergangenen Leben und den Wahrscheinlichkeiten einer Flucht. Einer von uns schlug vor, die Brigg in unsere Gewalt zu bringen. Wir sprachen über die Möglichkeit, in einem solchen Falle unseren Weg bis zum Hafen von New York zu finden. Ich kannte mich nur wenig mit dem Kompass aus; die Idee aber, jenen Versuch zu riskieren wurde bereitwillig erwogen. Die Chancen für uns wie auch gegen uns bei einem Zusammenstoß mit der Mannschaft wurden geprüft. Auf wen konnte man sich verlassen, und auf wen nicht, die rechte Zeit und Art des Angriffs, alles wurde wieder und immer wieder besprochen. Von dem Augenblick an, als der Komplott sich als naheliegend erwies, begann ich zu hoffen. Andauernd ging er mir im Sinn herum. Als Schwierigkeit auf Schwierigkeit auftauchte, war ein fertiger Einfall zur Hand, der zeigte, wie man sie überwinden konnte. Während andere schliefen, brachten Arthur und ich unsere Pläne zur Reife. Schließlich wurde Robert mit viel Vorsicht stückweise mit unseren Absichten bekannt gemacht. Er gab sofort seine Zustimmung und trat der Verschwörung mit tatkräftigem Eifer bei. Es gab keinen anderen Sklaven, dem wir uns wagten anzuvertrauen. Derart in Furcht und Unwissenheit aufgezogen wie sie es waren, kann man es kaum begreifen, wie unterwürfig sie sich unter dem Blick eines weißen Mannes duckten. Es war nicht sicher, ein solch kühnes Geheimnis einem von ihnen anzuvertrauen, und schließlich beschlossen wir drei, die furchterregende Verantwortung des Versuches auf uns selbst zu nehmen.
Bei Nacht wurden wir wie gesagt in den Laderaum getrieben und die Luke verriegelt. Das Deck zu erreichen war die erste Schwierigkeit, die sich uns in den Weg stellte. Ich hatte jedoch im Bug der Brigg ein kleines Boot gesehen, welches mit dem Kiel nach oben dort lag. Mir kam der Gedanke, dass wenn wir uns insgeheim darunter verstecken würden, wir nicht in der Menge vermisst würden, wenn sie des Nachts in den Laderaum gescheucht würde. Ich wurde auserwählt, das Experiment zu versuchen, um uns von der Machbarkeit zu überzeugen. Am nächsten Abend verbarg ich mich dementsprechend nach dem Abendessen hastig darunter, nachdem ich die passende Gelegenheit abgepasst hatte. Dicht am Deck liegend, konnte ich sehen, was rings um mich herum vor sich ging, während ich völlig ungesehen blieb. Am Morgen, als die anderen hinaufkamen, schlüpfte ich aus meinem Versteck, ohne beobachtet zu werden. Das Ergebnis war völlig zufrieden stellend.
Der Kapitän und der Maat schliefen in der Kabine des ersteren. Bei Robert, der in seiner Eigenschaft als Kellner regelmäßig Gelegenheit besaß, in ihrem Quartier Beobachtungen anzustellen, brachten wir die genaue Position ihrer jeweiligen Kojen in Erfahrung. Weiterhin informierte er uns, dass immer zwei Pistolen und ein Entermesser auf dem Tisch lägen. Der Mannschaftskoch schlief in der Kombüse auf Deck, einer Art Vehikel auf Rädern, das man bewegen konnte, wie es die Bequemlichkeit erforderte, während die Seeleute, die nur zu sechst waren, entweder auf dem Vorderdeck schliefen oder aber in Hängematten in der Takelage.
Schließlich waren alle unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Arthur und ich sollten uns lautlos in die Kapitänskajüte schleichen, die Pistolen und das Entermesser nehmen und so schnell wie möglich ihn und den Maat aus dem Weg räumen. Robert sollte mit einem Knüppel an der Tür stehen, die vom Deck hinab in die Kabine führte und im Falle der Notwendigkeit die Seeleute zurückschlagen, bis wir zu seiner Unterstützung eilen konnten. Dann sollten wir so weitermachen, wie es die Umstände erforderten. Sollte der Angriff so plötzlich und erfolgreich sein, dass er jeglichen Widerstand ausschloss, sollte die Luke verriegelt bleiben; ansonsten sollten die Sklaven herauf gerufen werden, und in dem Gedränge und der Eile und der Verwirrung dieses Moments, so beschlossen wir, sollten wir dann unsere Freiheit wiederbekommen oder unser Leben verlieren. Dann sollte ich die ungewohnte Stelle des Steuermannes einnehmen und uns nordwärts lenken, während wir darauf bauten, dass uns sodann ein glücklicher Wind in ein Land der Freiheit bringen würde.
Der Name des Maats war Biddee, an den des Kapitäns kann ich mich nun nicht erinnern, auch wenn ich selten einen Namen vergesse, den ich einmal gehört habe. Der Kapitän war ein kleiner, vornehmer Mann, aufrecht und pünktlich, mit einer stolzen Haltung und er sah wie die Tapferkeit in Person aus. Wenn er noch immer lebt, und diese Seiten zufällig seinem Auge begegnen sollten, wird er eine Tatsache in Zusammenhang mit der Reise seiner Brigg von Richmond nach New Orleans im Jahr 1841 erfahren, die nicht in seinem Logbuch steht.
Wir waren alle vorbereitet und warteten ungeduldig auf die Gelegenheit, unsere Pläne in die Tat umzusetzen, als sie von einem traurigen und unvorhersehbaren Ereignis vereitelt wurden. Robert wurde krank. Bald darauf wurde verkündet, er habe die Pocken. Es ging ihm unaufhörlich schlechter, und vier Tage vor unserer Ankunft in New Orleans starb er. Einer der Seeleute nähte ihn in seine Decke ein, mit einem großen Stein vom Ballast zu seinen Füßen, dann legte er ihn auf eine Ladeluke, und indem er diese mit der Takelung über die Reling schwang, wurde der leblose Leib des armen Robert den weißen Wassern des Golfs übergeben.
Wir waren alle durch das Auftreten der Pocken mit Panik geschlagen. Der Kapitän befahl, dass Kalk im Frachtraum verstreut und andere kluge Vorsichtsmaßnahmen eingeschlagen werden sollten. Der Tod Roberts jedoch, und die Gegenwart der Krankheit bedrückten mich sehr, und ich blickte über die große Wasseröde mit einer Stimmung, die wahrhaftig untröstlich war.
Einen Abend oder zwei nach Roberts Bestattung lehnte ich mich auf die Ladeluke nahe dem Vorderdeck, voller verzagender Gedanken, als mich ein Seemann mit freundlicher Stimme fragte, warum ich so niedergeschlagen sei. Tonfall und Haltung des Mannes gaben mir Vertrauen, und ich antwortete, weil ich ein freier Mann sei und entführt worden war. Er bemerkte, dies würde ausreichen, um jeden niedergeschlagen zu machen, und fuhr fort, mich zu befragen, bis er die Einzelheiten meiner ganzen Geschichte erfuhr. Er war offensichtlich sehr zu meinen Gunsten interessiert, und schwor in der unverblümten Sprache eines Seemanns, er würde mir helfen so gut er könnte, auch wenn es ihm „die Planken zerhaue“. Ich bat ihn, mir Stift, Tinte und Papier zu besorgen, damit ich einigen meiner Freunde schreiben konnte. Er versprach, dies zu erledigen – doch wie ich sie unentdeckt benutzen konnte, war eine Schwierigkeit. Könnte ich nur ins Vorderschiff gelangen, wenn er nicht hinsähe und die anderen Seeleute schliefen, dann wäre die Angelegenheit machbar. Das kleine Boot kam mir sofort in den Sinn. Er glaubte, wir wären nicht weit von Balize, an der Mündung des Mississippi, und es war notwendig, dass der Brief bald geschrieben würde, oder die Gelegenheit wäre vorbei. Entsprechend schaffte ich es, wie wir zuvor vereinbart hatten, mich in der nächsten Nacht erneut unter dem Langboot zu verstecken. Seine Wache endete um zwölf, ich sah ihn zum Vorderschiff gehen, und folgte ihm nach etwa einer Stunde. Er döste im Halbschlaf über einem Tisch, auf dem ein schwaches Licht flackerte und auf dem ebenfalls ein Stift und ein Blatt Papier lagen. Als ich eintrat wurde er wach, bedeutete mir neben ihm Platz zu nehmen und zeigte auf das Papier. Ich richtete den Brief an Henry B. Northup aus Sandy Hill – bekundete, dass ich entführt worden war, zur Zeit an Bord der Brigg Orleans war auf dem Weg nach New Orleans; dass es mir derzeit unmöglich sei, mein endgültiges Ziel zu mutmaßen, und bat, dass er Maßnahmen ergriffe, mich zu retten. Der Brief wurde versiegelt und adressiert, und Manning versprach, nachdem er ihn gelesen hatte, ihn im Postamt von New Orleans abzugeben. Ich eilte zurück zu meinem Platz unter dem Langboot, und am Morgen, als die Sklaven herauskamen und herumliefen, kroch ich heraus und mischte mich unter sie.
Mein guter Freund, dessen Name John Manning war, war von Geburt her Engländer, und ein edelmütigerer, großzügigerer Seemann schritt nie über ein Deck. Er hatte in Boston gelebt – war ein großer, gut gebauter Mann, etwa vierundzwanzig Jahre alt, mit einem Gesicht, das leicht pockennarbig war, doch erfüllt von einem wohlwollenden Ausdruck.
Nichts geschah, um die Eintönigkeit unseres täglichen Lebens abzuändern bis wir New Orleans erreichten. Als wir den Damm erreichten und noch bevor das Schiff festgemacht war, sah ich Manning an Land springen und in die Stadt davoneilen. Als er loslief, warf er einen bedeutungsvollen Blick über seine Schulter, womit er mir das Ziel seines Botengangs zu verstehen gab. Schließlich kehrte er zurück, und nah an mir vorbeistreifend, gab er mir einen leichten Knuff mit dem Ellbogen, mit einem besonderen Zwinkern, wie um mir zu sagen „es ist in Ordnung.“
Der Brief erreichte Sandy Hill, wie ich seitdem erfahren habe. Mr. Northup fuhr nach Albany und legte ihn Gouverneur Seward vor, aber insoweit er keine eindeutige Information hinsichtlich meines wahrscheinlichen Aufenthaltsortes enthielt, wurde es zu diesem Zeitpunkt nicht für ratsam gehalten, Maßnahmen zu meiner Befreiung in die Wege zu leiten. Es wurde beschlossen, dies aufzuschieben, im Vertrauen, dass schließlich in Erfahrung gebracht würde, wo ich weilte.
Wir wurden Zeuge einer glücklichen und anrührenden Szene unmittelbar, nachdem wir den Damm erreichten. Gerade als Manning die Brigg auf dem Weg zum Postamt verlassen hatte, kamen zwei Männer an Bord und riefen laut nach Arthur. Letzterer war beinahe rasend vor Vergnügen, als er sie erkannte. Es waren Männer aus Norfolk, die nach New Orleans gekommen waren, um ihn zu retten. Seine Entführer, so informierten sie ihn, waren verhaftet und in Norfolk ins Gefängnis gesperrt worden. Sie unterhielten sich einige Augenblicke mit dem Kapitän, und gingen dann mit dem erleichterten Arthur davon.
Doch in der ganzen Menschenmenge, die sich auf dem Dock tummelte, gab es niemandem, der mich kannte oder sich um mich kümmerte. Niemand. Keine bekannte Stimme begrüßte meine Ohren, noch gab es auch nur ein Gesicht, das ich schon einmal gesehen hatte. Bald würde Arthur wieder mit seiner Familie vereint sein und das ihm zugefügte Unrecht zu seiner Befriedigung gerächt: doch weh, sollte ich meine Familie überhaupt noch einmal wieder sehen? In meinem Herzen machte sich das Gefühl völliger Verlassenheit breit, erfüllte es mit dem verzweifelnden und bedauernden Gedanken, dass ich nicht mit Robert zum Grund des Meeres gesunken war.
Sehr bald kamen Händler und Käufer an Bord. Einer, ein großer dünngesichtiger Mann, mit hellem Teint und ein wenig gebeugt, trat mit einem Papier in der Hand in Erscheinung. Burchs Kolonne, die aus mir, Eliza und ihren Kindern, Harry, Lethe, und einigen anderen bestand, die in Richmond zu uns gestoßen waren, wurde ihm übergeben. Dieser Gentleman war Mr. Theophilus Freeman. Von seinem Papier ablesend rief er: „Platt.“ Niemand antwortete. Der Name wurde wieder und wieder gerufen, doch es gab immer noch keine Antwort. Dann wurde Lethe gerufen, dann Eliza, dann Harry, bis die Liste abgearbeitet war, jeder vortretend, wenn sein oder ihr Name gerufen wurde.
„Kapitän, wo ist Platt?“, wollte Theophilus Freeman wissen.
Der Kapitän konnte es ihm nicht sagen, da niemand an Bord war, der auf diesen Namen höre.
„Wer hat diesen Nigger verschifft?“, fragte er abermals beim Kapitän nach, auf mich deutend.
„Burch“, antwortete der Kapitän.
„Dein Name ist Platt – du passt zu meiner Beschreibung. Warum trittst du nicht vor?“, verlangte er in zornigem Tonfall von mir zu wissen.
Ich setzte ihn darüber in Kenntnis, dass dies nicht mein Name sei; dass ich niemals so genannt worden sei, aber keinen Einwand dagegen hätte, soweit ich wüsste.
„Nun, ich werde dir deinen Namen beibringen“, sagte er; „und zwar so, dass du ihn auch nicht mehr vergessen wirst, bei Gott“, fügte er hinzu.
Mr. Theophilus Freeman stand übrigens seinem Partner Burch nicht im Geringsten hinsichtlich des Gebrauchs blasphemischer Redewendungen nach. Auf dem Schiff hatte ich auf den Namen „Steward“ gehört, und dies war das erste Mal, dass ich als Platt bezeichnet wurde – der Name, den Burch seinem Abnehmer übermittelt hatte. Vom Schiff aus beobachtete ich die Sklavenkolonne, die am Deich arbeitete. Wir kamen nahe bei ihnen vorbei, als wir zu Freemans Sklavenpferch getrieben wurden. Dieser Pferch ähnelt stark dem von Goodin in Richmond, außer dass dieser Hof von Brettern, aufrecht stehend und mit spitzen Enden, umgeben war, anstatt von Ziegelmauern.
Uns eingeschlossen waren wir nun wenigstens fünfzig in diesem Pferch. Nachdem wir unsere Decken in einem der kleinen Gebäude auf dem Hof verstaut hatten und zusammengerufen und gefüttert worden waren, wurde uns erlaubt, bis zum Abend auf dem Gelände herumzuschlendern, worauf wir uns dann in unsere Decken hüllten und uns unter dem Schuppendach, oder auf dem Dachboden oder dem offenen Hof hinlegten, so wie es jeder vorzog.