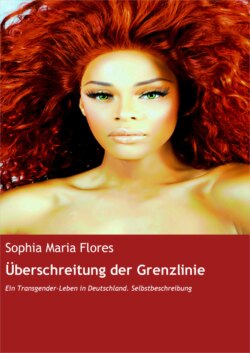Читать книгу Überschreitung der Grenzlinie - Sophia Maria Flores - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Was du schwarz auf weiß besitzt
ОглавлениеIn der Tat sind die Aussagen über die an ihrer Geschlechtsidentität Leidenden wenig signifikant, vor allem in Hinblick auf die Familienanamnese. Solche Unentschiedenheit lässt Freiräume für Wunschträume oder Propaganda. »Offenbar haben weder der genetische Code noch die Geschlechtsdrüsen und die von ihnen ausgeschütteten Hormone einen determinierenden Einfluss auf die Entwicklung der Gender-Identität, die sich auf ähnliche Weise einprägt wie die Muttersprache. Auch auf die Einflüsse des Milieus ließ sich die Transsexualität, von Medizinern auch Geschlechtsdysphorie genannt, nicht zurückführen — in der Regel wachsen die Transsexuellen in einem normalen Elternhaus auf. Wie der Amsterdamer Psychologe Anton Verschoor nach dem Studium von Lebenserinnerungen Betroffener feststellte, spielen besondere emotionelle Bindungen zu Mutter oder Vater keine Rolle.« (So war es am 25. Juni 1990 anonym unter der Überschrift »Vergessene Gruppe« in der Ausgabe Nr. 26 von DER SPIEGEL abgedruckt). Wenn es denn da so zu lesen steht, bin ich wohl gezwungen, es zu akzeptieren, zumal ich nicht in der Lage bin, ausreichend viele Lebenserinnerungen von Betroffenen zu durchleuchten, gleich gar nicht mit wissenschaftlichen Methoden. Zumindest in Hinblick auf meine Person sei mir ein leiser Einwand gestattet, denn meine Biografie scheint einen ganz bestimmten Gesichtspunkt der Psychoanalyse zu bestätigen, weil sie von einer erheblichen Störung in den Beziehungen der Eltern zueinander und des Kindes zu den Eltern begleitet ist. Im Speziellen meine ich »die gleichgeschlechtliche Identifikationsperson«, die in der Familie fehlt oder demontiert ist, während die gegengeschlechtliche Identifikationsperson übermächtig erscheint, beherrschend und besitzergreifend. In der Literatur, die mir damals zur Verfügung stand, war die Familienanamnese der Transsexuellen sträflich vernachlässigt, ganz anders zum Beispiel als bei den Intersexformen. Es mutet an, als hätte es eine Zeit gegeben, in der die Ernsthaftigkeit der sexuologischen Arbeit überhaupt erst bei den gonosomalen Chromosomenaberationen der Zytogenetik anfing. Unsereine galt da nur als eine Art exklusiver Spielerei. Man kann das auch so interpretieren: Die Patienten und Patientinnen mit Klinefelter-Syndrom etc. konnten nichts dafür ... Mehrmals habe ich, hochsensibel für gewisse Zwischentöne, durchaus Spott und Zynismus aus den ärztlichen Bulletins herausgelesen, wenn es sich um meine Leidensgefährten und -gefährtinnen handelte. Vielleicht zu unrecht. Vielleicht auch nicht.
Auch die Transsexuellen selbst bekleckern sich nicht eben mit Ruhm, wenn es darum geht, ihr Nest von Schmutz freizuhalten. Statt sich zu fragen, warum die Medien in jüngster Zeit ein solch süffisantes Interesse an dem heiklen Thema zeigen, lassen sie sich auf das fatale Spiel ein und in die Verhörstühle der Teleanstalten stopfen und in die Zeitungsspalten quetschen, wo sie auf Bestellung immer denselben Unsinn erzählen. Allerdings muss man ihnen zugute halten, dass jede(r) Einzelne stets für die Repräsentantin bzw. den Repräsentanten Aller gehalten wird, so dass die Aussagen, die jemand über sich und seine resp. ihre Situation trifft, stellvertretend als Meinung der ganzen Gruppe wahrgenommen wird. Außerdem unterziehen sich manche nicht der Mühe, Vermutungen, die ihnen zugetragen werden, auf ihre Quellen hin zu überprüfen. So tauchte in den Talk-Shows der neunziger Jahre aus den Mündern der Gegner einer geschlechtsangleichenden Operation immer wieder die Behauptung auf, die Suizidrate unter den Transsexuellen wäre enorm hoch. Niemals hat auch nur einer die Mutmaßung mit einem Hinweis auf die statistische Untersuchung untermauert, auf die er sich beruft. Das wäre ihm wahrscheinlich auch schwergefallen. Angeblich habe eine in späteren Jahren vorgenommene Studie an der Universität Basel, Abteilung klinische Psychologie, aufgezeigt, dass Transsexuelle auch nach dem operativen Eingriff in höherem Maße als der Rest der Bevölkerung selbstmordgefährdet seien. Die Selbstmordrate liege bei spektakulären 80 Prozent. Dumm nur, dass die Mitarbeiter dieses Instituts von einer solchen Studie nichts wissen. Sie ist wohl die freie Erfindung eines Journalisten. Da Transsexuelle »Menschen mit den verschiedensten Lebensgeschichten und Persönlichkeitsausformungen (wie auch sonst in der Bevölkerung)« sind (Udo Rauchfleisch, früherer Leiter der oben genannten Schweizer Einrichtung), unterscheiden sie sich ihre statistischen Werte (so es sie überhaupt gibt) nicht wesentlich von denen der Gesamtbevölkerung. Wer vor der geschlechtsangleichenden Operation depressiv war, dürfte es nach der Operation bleiben, allerdings läuft er Gefahr, mit fortdauernder Wirkung der Hormonpräparate die Depressivität stärker und öfter zu spüren. Das ist ein medikamentöses Problem, kein mentales.
Ein weiterer Schwachsinn, der in Talkshows und Dokumentationen immer wieder verbreitet wird, ist der, dass den Transsexuellen vom Gesetzgeber vorgeschrieben sei, am Beginn ihrer psychotherapeutischen und medizinischen Behandlung und begleitend zu derselben einen wenigstens einjährigen Alltagstest zu durchlaufen. Aber dazu steht im Transsexuellengesetz (Gesetz zur Änderung von Personennamen in besonderen Fällen) vom 10. September 1980 kein Sterbenswort. Das haben sich die behandelnden selbst einfallen lassen, zum Beispiel in den »Standards der Behandlung und Begutachtung von Transsexuellen der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung, der Akademie für Sexualmedizin und der Gesellschaft für Sexualwissenschaft, und dort speziell in den Standards der Indikationsstellung zur somatischen Behandlung«. Darüber warum man die Transsexuellen auf diese pikante Weise ein Jahr lang quälen will, lässt sich trefflich spekulieren (man bedenke, dass bei Beginn des Alltagstest noch keine Hormonsubstitution stattgefunden hat, die Betroffenen also physisch auffällig sind und bestenfalls als die vielgeschmähten Transvestiten durchgehen). Vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist diese Tortur jedenfalls nicht, und auf mich ist sie freundlicherweise auch nicht angewendet worden, wobei wegen der Schwierigkeit, einen Operationstermin festzulegen, nach der amtsgerichtlichen Namensänderung dann doch noch zwei Jahre verstrichen, in denen ich bereits offiziell als Frau lebte, ohne chirurgisch »angeglichen« zu sein.