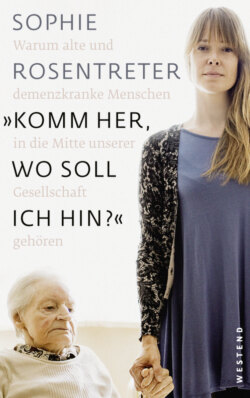Читать книгу "Komm her, wo soll ich hin?" - Sophie Rosentreter - Страница 8
ОглавлениеEinleitung
Den Titel dieses Buches trage ich seit dem Sommer 2010 mit mir herum. Damals war ich in einem Pflegeheim und schaute mit einer kleinen Gruppe an Demenz erkrankter Damen einen meiner Filme an. Ich saß neben einer Frau mit weit fortgeschrittener Demenz. Sie hatte starke Wortfindungsstörungen und war vollkommen auf die Hilfe von Pflegekräften angewiesen. Da saß ich also an ihrer Seite, hielt ihre Hand, als eine andere Frau zum Fernseher ging, um die Ziege zu streicheln, die gerade zu sehen war. Für mich war das ein unglaublich bewegender Moment, und die Dame neben mir spürte wohl, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit nicht mehr ganz bei ihr war. Deshalb erschrak ich fast, als sie plötzlich mit lauter, klarer Stimme sprach: »Komm her, wo soll ich hin?« Sie klang dabei ebenso hilflos wie drängend. Treffender kann man den Zustand, in dem sich Menschen mit Demenz befinden können, kaum beschreiben. Und sie brauchen uns, damit sie ihren Platz finden. Diesen Menschen helfen zu können, ist für mich zur Berufung geworden.
Ich habe selbst die Demenzerkrankung meiner Oma Ilse erlebt und mit ihr durchlebt. Meine Schwierigkeiten, mit ihr zu kommunizieren, als sie schon ihre Sprache verloren hatte, haben mich dazu gebracht, für Menschen mit Demenz Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden, die es vorher noch nicht gab. Ich habe angefangen, Filme ganz speziell für Menschen mit Demenz zu produzieren und daraus ein interaktives Beschäftigungskonzept zu entwickeln. Das hilft inzwischen auch vielen Menschen dabei, einen Weg in die Welt ihrer demenzkranken Angehörigen zu finden.
Und das ist enorm schwer, denn unser heutiges Altersbild ist geprägt von Erwartungen, die eigentlich gar nicht zum Altwerden passen: Wir sprechen von »jungen Alten« oder »best agern«, und die haben gefälligst ein permanentes Anti-Aging-Programm zu absolvieren: sportlich aktiv, immer auf Achse, unternehmungslustig.
Die Fallhöhe ist deshalb enorm, wenn ein alter Mensch und seine Angehörigen dann mit der Realität konfrontiert werden: abnehmende körperliche Leistungsfähigkeit, altersbedingte Erkrankungen, chronische Schmerzen. Diese völlig natürlichen Begleiterscheinungen des Alters empfinden heutige »Senioren« angesichts der übersteigerten Erwartungshaltung viel stärker als Verlust von Lebensqualität, als das früher der Fall war.
Nimmt neben der körperlichen auch noch die geistige Leistungsfähigkeit rapide ab, ist das Entsetzen besonders groß. Wenn die Demenz kommt, geht die Lebensqualität. So stellen wir uns das jedenfalls vor. Deshalb begegnen uns in den Medien dann auch Schlagzeilen wie »Horror Demenz« (SWR), »Abschied auf Raten« (Stern, WAZ), »Dämon Demenz« (Ruhr Nachrichten), »Die unheimliche Krankheit« (SWR).
Aber wie erlebt ein Mensch mit fortgeschrittener Demenz sein Dasein? Fühlt er sich womöglich doch zufriedener, als wir es uns vorstellen können? Diesen Eindruck gewinnen oft diejenigen, die den Betroffenen jeden Tag nahe sind.
So jedenfalls, wie wir in unserer Gesellschaft heute mit diesem Rückgang geistiger und körperlicher Fähigkeiten umgehen, passiert vor allem eines: Wir stigmatisieren die Betroffenen sowie ihre Angehörigen und lassen sie allein damit.
Stattdessen müssen wir dringend neue Wege einschlagen und Denkweisen ändern. Wir müssen lernen, die altersbedingte Abnahme vieler Fähigkeiten als etwas Normales anzunehmen. Alt und/oder demenziell verändert sein, ist ein ebenso unvollkommenes Dasein wie Kind sein, Jugendlicher sein, Erwachsener sein. Wir müssen nicht nur die Betroffenen anhören und ihre Situation verbessern, sondern auch ihre Angehörigen auffangen und uns um sie kümmern. Wir müssen ganz neue Konzepte für Quartiere in Großstädten ebenso wie für kleine Gemeinden entwickeln.
Seit meiner ersten Begegnung mit Dr. Jens Bruder, dem Mitbegründer der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, am Grab meiner Großmutter Ilse habe ich das große Glück, Menschen zu begegnen, die das Gleiche machen wie ich: Sie suchen neue Wege, um die Situation für Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen, ehrenamtlich Betreuende und professionell Pflegende zu verbessern. Nur so haben wir alle eine gesellschaftliche Zukunft: Die wachsende Zahl von Demenzbetroffenen und die immer weniger werdenden Nachkommen.
Sophie Rosentreter
Hamburg, Mai 2012