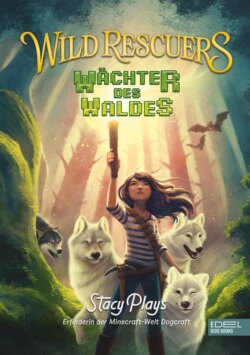Читать книгу Wild Rescuers - Stacy Plays - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 3
ОглавлениеStacy und die Wölfe atmeten erleichtert auf, als Everest und Noah in die Höhle schlenderten. Kein Bauer hatte das Geräusch verursacht, sondern die beiden größten Wölfe des Rudels, die von der morgendlichen Rettungsaktion zurückkamen.
Stacy warf Everest einen Blick zu, der bedeutete, wir müssen uns später unterhalten. Allein. Der große Wolf nickte. Das war das Besondere an Stacys Wölfen. Sie hatte es an dem schicksalhaften ersten Tag im Wald sofort bemerkt. Diese Wölfe verstanden sie, auch wenn sie selbst nicht sprechen konnten. Über die Jahre hatten sie gelernt, sich auf andere Weise mit Stacy zu verständigen, durch Gesichtsmimik oder durch Körperhaltung. Sie konnte sie deshalb sehr gut verstehen.
Weiß Everest vielleicht schon von dem Problem mit den anderen Wölfen? Er hatte einen sechsten Sinn für die Taiga und die Tiere, die dort lebten. Es war, als ob er den Wald lesen konnte, dessen Geist. Vielleicht spürte Everest, dass etwas nicht stimmte. Oder er wollte wegen der riskanten Rettung heute Morgen mit ihr schimpfen. Wie auch immer, beides musste warten.
Stacy verschlang den letzten Bissen ihres Brotes, stand auf und fegte die Krümel von ihrer Jeans. Sie musste lächeln, als Wink sich darauf stürzte und mit wedelndem Schwanz jedes Krümelchen verspeiste.
Am Sonnenlicht auf den Kiefern vor dem Höhleneingang konnte Stacy erkennen, dass es bereits Nachmittag war. Es blieben ihnen noch ein paar Stunden Tageslicht, und es gab noch Arbeit zu tun, bevor es dunkel wurde.
„Zeit für die Hausarbeiten“, verkündete sie und griff nach ihrer Steinaxt, die neben dem Ofen lag. „Addi, kannst du bitte den Hebel drücken?“
Addison trottete zum Wolf-Wähler, einer Art Maschine, die sie und Stacy gebaut hatten. Zuerst war es nur ein Schulprojekt gewesen, aber dann hatte sich die Maschine als sehr nützlich erwiesen, um zu entscheiden, welcher Wolf Stacy bei den täglichen Hausarbeiten helfen musste.
Die Wölfin packte mit den Zähnen den hölzernen Hebel und zog. Der Hebel stieß einen Tannenzapfen aus einem Holzbecher, der in ein altes Vogelnest fiel, das oben auf einem Rad aus gebogenen, miteinander verwobenen Zweigen saß. Durch das Gewicht des Tannenzapfens fing das Rad an, sich zu drehen, der Zapfen fiel in eine Rinne aus Birkenrinde und von dort in eine von sechs Röhren. Gleichzeitig betätigte Stacy einen anderen Hebel, sodass sich die Röhren hin und her bewegten. So wusste sie nie, in welcher Röhre der Tannenzapfen am Ende landen würde. Auf jeden Fall wurde so der Gewinner bestimmt – oder der Verlierer, abhängig davon, welche Arbeiten Stacy für den Tag geplant hatte.
Der Zapfen landete vor einem von sechs Gegenständen. Jeder Gegenstand war einem der Wölfe aus Stacys Rudel zugeordnet. Noahs war ein glatt geschliffenes blaues Glasstück, das er bei einem Ausflug ans Meer, das östlich von ihnen lag, entdeckt hatte. Tuckers war eine glänzende kupferfarbene Geldmünze und Everests ein Stück Quartzgestein. Addisons Gegenstand war ein Bleistift, der so oft gespitzt worden war, bis man nicht mehr mit ihm schreiben konnte. Und Basils eine gelbe Löwenzahnblüte, die Stacy im Wald gepflückt und getrocknet hatte. Zu Wink gehörte ein kleines rotes Taschenmesser, das er in der Nähe eines Zeltplatzes ausgegraben hatte. Die Schneide war rostig und stumpf. Genau vor diesem Messer war der Zapfen auf den Boden geplumpst.
Stacy ging zum Höhleneingang. Tucker hielt sie kurz auf. Er hatte einen Schal im Maul.
„Danke, Tuck“, sagte sie. „Du hast recht, am späten Nachmittag wird es immer noch kühl.“ Sie wickelte sich den Schal um den Hals und sah in die Höhle zurück. „Wo habe ich meinen Beutel liegen gelassen?“
Bevor sie ihn entdeckte, holte Basil Stacys Beuteltasche vom Regal hinten in der Höhle. Sie rannte damit zu Stacy, Addison folgte ihr.
Stacy nahm mit einer Hand den Beutel von Basil entgegen und streckte die andere Addison hin, die das rote Taschenmesser hineinfallen ließ.
„Danke, Basil. Danke, Addison“, sagte sie. „Wink, du bist dran.“
Wink rührte sich nicht. Normalerwiese freuten sich alle Wölfe, wenn sie Stacy bei ihren Aufgaben helfen durften – außer Wink. Er interessierte sich nur für alles, was mit einem Abenteuer verbunden war. Aber heute stand Gartenarbeit und Holz hacken an, und das wusste er.
„Wiiink!“
Umständlich stand der junge Wolf auf, aber Everest ging an ihm vorbei und stellte sich aufrecht neben Stacy.
„Glück gehabt, Wink“, sagte Stacy. „Heute wirst du verschont. Komm, Everest.“
Wink drehte sich erfreut mehrmals im Kreis und ließ sich dann wieder auf den Boden plumpsen, während Everest Stacy aus der Höhle folgte. Stacy wusste, warum der eindrucksvolle Wolf sich freiwillig angeboten hatte, so konnte sie in Ruhe mit ihm sprechen.
Zusammen traten sie in den Wald, und Stacy atmete die nach Fichten und Kiefern duftende Luft tief ein. Sie liebte das. In Büchern und Zeitschriften hatte sie Bilder von Städten auf der ganzen Welt gesehen, ebenso Fotos von tropischen Inseln und Stränden und von Gebirgen. Aber sie konnte sich keine schönere Landschaft vorstellen als den Wald ihrer Taiga.
Stacy und Everest liefen von ihrer Höhle aus in Richtung Süden. Vor Tausenden von Jahren hatte ein Fluss ihre Höhle geformt. Sie war in eine steile Felswand gegraben worden, welche die Kiefern und Fichten überragte. Der Felsrücken war ein guter Aussichtspunkt, von dem aus man Ausschau nach allen Gefahren halten konnte, die Stacy und ihrem Rudel drohten. Sie nannten den Bergrücken daher auch den Patrouillenfelsen. Stacy kletterte gern hinauf, um von dort einen Blick auf die Welt um sie herum zu werfen.
Von oben sah sie, dass der Wald sich nach Süden ausdehnte, so weit das Auge reichte. Im Osten lag eine tiefe Schlucht, welche die Taiga von einem großen Eichenwald trennte. Entlang der Schlucht fanden sich verlassene Eingänge zu einer alten, stillgelegten Eisenmine. Diesen Ort mied Stacy normalerweise, weil es dort leicht zu Höhleneinstürzen kommen konnte. Noch weiter östlich, hinter dem Eichenwald, lag der Strand. Weiter als bis dorthin hatten sie sich noch nie von ihrer Höhle entfernt. Erst ein einziges Mal waren Stacy und die Wölfe dort gewesen – im Sommer, nachdem Stacy zum ersten Mal Die Insel der blauen Delfine gelesen hatte. Sie hatte die Wölfe angefleht, ihr das Meer zu zeigen.
Im Westen, rechts und links vom Fluss, wuchsen hoch aufragende Birken. Noch weiter westlich und etwas Richtung Norden ragten einige Hügel empor, die sich schließlich zu Bergen erhoben. Geradeaus im Norden war der Sumpf, dieser Teil des Waldes war in ständigen Nebel gehüllt. In der Mitte befand sich ein schlammiger See. An den seltenen Tagen, an denen Noah dort und nicht im Fluss fischte, kam er matschverkrustet und nach Algen stinkend nach Hause. Ganz im Norden ragten schließlich hohe schroffe Berge auf, deren Gipfel das ganze Jahr über mit Schnee bedeckt waren. Am Fuße der Berge lag ein Wald, der so dicht war, dass kein Tageslicht hineinfiel, sodass dort nicht endende Nacht herrschte. Stacy nannte ihn den Wald der Ewigen Finsternis. Bisher hatten sie und die Wölfe keinen Grund gehabt, dorthin zu gehen. Die Wölfe hatten vielmehr Stacys immer mal wieder auftauchenden Wunsch, den Wald der Ewigen Finsternis zu erkunden, jedes Mal im Keim erstickt.
Während Everest und sie durch den Taigawald liefen, erzählte sie ihm, was sie in der Zeitung gelesen hatte.
„Wenn wir das wilde Rudel davon überzeugen können, den Taigawald zu verlassen, wird sich die Aufregung bestimmt legen“, sagte sie. „Glaubst du, sie werden gehen?“
Everest schüttelte den Kopf.
„Gibt es woanders kein besseres Jagdgebiet?“, fragte Stacy. Aber sie wusste, dass die Antwort nein war. Es gab mehr als genug Weißwedelhirsche, Maultierhirsche und Elche in der Taiga, um den Hunger der Wölfe zu stillen. Aber warum hatten sie es dann riskiert, von einem Bauern erschossen zu werden?
„Wir sollten sie aber wenigstens vor der Wolfsprämie warnen“, fuhr Stacy fort. „Kannst du es ihnen erklären? In Wolfssprache? Ich begleite dich.“
Everest warf ihr einen Blick zu, der sagte Ja, gut.
Manchmal vergaß Stacy, dass sich nicht alle Wölfe in der Nähe eines Menschen so wohlfühlten wie ihr Rudel. Erst als sie das erste Mal auf die wilden Wölfe getroffen war, hatte sie begriffen, dass Wölfe sich vor Menschen fürchteten und ihre Sprache keinesfalls so gut verstanden, wie das die Wölfe aus ihrem Rudel taten.
Eine Weile liefen sie schweigend weiter. Das Schweigen war nicht unangenehm, es war die Art Stille, die nur zwei sehr gute Freunde miteinander teilen konnten. Sie fühlten sich in der Gesellschaft des anderen sehr wohl, und jeder ließ seine Gedanken wandern. Obwohl Stacy sich ziemlich sicher war, dass Everest niemals völlig in seinen Gedanken versank. Das war das Besondere an ihm. Er war immer wachsam, Stacy immer einen Schritt voraus und hielt stets Ausschau nach Gefahren.
Tränen traten Stacy in die Augen. Sie hatte dem Wolf das Ausmaß der Gefahr, die durch die Prämie über ihnen schwebte, nicht vollständig klarmachen können. Solange sie denken konnte, hatte sie immer Angst gehabt, dass sie die Wölfe eines Tages wieder verlassen musste. Wenn die Menschen sie finden sollten, dann würden sie sie zwingen, ihr geliebtes Leben in der Wildnis aufzugeben. Das war ihr klar, auch wenn sie nicht sicher war, woher sie das wusste. Für andere mochte es seltsam sein, aber Stacy erinnerte sich nicht mehr an ihre Familie. Das Rudel war jetzt ihre Familie – und was sie betraf, war das das Einzige, das zählte. Deshalb löste die Wolfsprämie, wenn sie in die Tat umgesetzt und einer ihrer Wölfe ihr weggenommen oder gar getötet würde, eine neue, viel schrecklichere Angst in ihr aus. Sie konnte den Gedanken daran kaum ertragen und war erleichtert, als sie aufblickte und erkannte, dass sie an ihrem Ziel angekommen waren. Nun konnten sich beide auf ihre Arbeit konzentrieren.
Everest ging zu einer Gruppe hoher Fichten, die so dicht nebeneinander wuchsen, dass man kaum zwischen ihnen hindurchsehen konnte. Er begann zu scharren.
„Ich helfe dir“, sagte Stacy, als sie ihn eingeholt hatte. Sie bückte sich und griff nach einem Geflecht aus Kiefernzweigen und toten Wurzeln, das eine grob gezimmerte Klappe bildete. Zusammen hoben sie die Falltür hoch, darunter kam ein Tunnel in Wolfsgröße zum Vorschein. Everest und Stacy krochen durch den kurzen schmalen Gang, der unter den dicht wachsenden Bäumen hindurchführte, und gelangten auf der anderen Seite auf eine kleine, von der Sonne beschienene Lichtung. Dort, im Schatten der Bäume, lag Stacys Farm. Es war nicht viel, nur ein Stück Erde mit ein paar Karotten, Kürbissen, Kartoffeln und Kräutern, die sie dort anpflanzte, einem Huhn und einem Hahn und ein paar Küken, die herumwuselten. Stacy griff in ihren Beutel und holte eine Handvoll Samen heraus, die sie auf den Boden streute. Fluff, die Henne, und ihre Küken pickten sie gierig auf. Der Hahn, Crow, hielt sich zurück, als ob es unter seiner Würde wäre, sich mit den Küken um die Samen zu streiten. Er kam erst näher, als die Kleinen fertig zu sein schienen.
Aus ihrer Metall-Trinkflasche, die ein Camper vor Monaten an einem Baum hängend zurückgelassen hatte, schüttete Stacy Wasser in eine Schale, die in einer Ecke stand. Everest schubste die Küken liebevoll zu der Trinkschale.
Es war Stacy ein Rätsel, wie der Wolf so freundlich zu etwas sein konnte, das er irgendwann fressen würde. Stacy war sehr zufrieden mit ihrem Speiseplan aus Fisch, Gemüse, Beeren und der ein oder anderen Leckerei, die Addison von einem Zeltplatz stibitzte. Aber die Wölfe vertrugen eigentlich nichts außer Fleisch. Das Rudel hatte aufgehört zu jagen, als es Stacy aufgenommen hatte. Sie gab ihnen von den Beeren ab, die sie im Wald sammelte, wenn sie reif waren, aber das reichte natürlich nicht. Also hatte Stacy angefangen, Hühner für sie zu züchten, denn sie wusste, dass Wölfe zum Überleben Fleisch brauchten. Das war ein Teil des Kreislaufs des Lebens. Deshalb gab es Fluff und Crow. Fluff hatte sie aufgezogen, als die Henne noch ein kleiner gelber Flaumball gewesen war, so wie die Küken, die jetzt um ihre Füße hüpften. Stacy schauderte bei dem Gedanken an die Aufgabe, die sie in ein paar Monaten erwartete, wenn die Küken ausgewachsen waren. Diesen Teil ihrer Arbeit mochte sie nicht und vertrieb den Gedanken daran schnell aus ihrem Kopf. „Wir geben den Küken keine Namen, einverstanden?“, sagte sie halb zu sich selbst. „Schlimm genug, dass ich Fluff und Crow Namen gegeben habe.“
Nachdem die Hühner gefüttert waren, grub Everest mit den Pfoten ein paar Karotten aus, während Stacy mit einer alten Holzhacke eine Kartoffelpflanze entwurzelte. Sie steckte das Gemüse in ihren Beutel, dann verließen Everest und sie die Lichtung durch den kleinen Tunnel und verschlossen den Eingang mit der Falltür aus Zweigen.
Auf dem Rückweg zur Höhle entdeckte Stacy einen Birkenschössling, der ungefähr so groß war wie sie und der zu dicht neben einer Kiefer wuchs.
„Der bekommt nie genug Licht, um groß zu werden, Everest“, stellte sie fest. „Fällen wir ihn und machen Brennholz daraus.“
Stacy griff nach ihrer Steinaxt, die an ihrem Beutel hing, fällte den jungen Baum und zerkleinerte ihn in handliche Stücke.
Als die Sonne hinter die Bäume sank, lud sie die letzten Zweige auf einen Stapel auf Everests Rücken.
„Danke für deine Hilfe heute“, lobte Stacy ihn, als sie den Rest des Weges nach Hause liefen. Sie dachte an die Rettung des Kaninchens. War das wirklich erst heute Morgen gewesen? Everest war immer noch verstimmt, weil er nicht hatte verhindern können, dass sie den Wasserfall hinuntergesprungen war, das spürte Stacy. Wenn sie so darüber nachdachte, war er seitdem ziemlich mürrisch. Sie musste es wiedergutmachen. Und sie wusste genau, womit sie seine Laune aufhellen konnte.
Sie wühlte in ihrem Beutel nach Everests Lieblingsspielzeug – zwei alten Knochen, die Stacy im Wald gefunden und mit einem Stück Faden zusammengebunden hatte. Sie nannte ihn den Wurfknochen.
„Hey, du“, rief Stacy, „willst du Fangen spielen?“
Beim Anblick seines Spielzeugs richtete Everest die Ohren auf. Er schüttelte das Holzpaket ab und rannte los, bevor Stacy auch nur den Arm zum Wurf gehoben hatte. Sie schleuderte den Knochen, so weit sie konnte. Ein paar Sekunden später kam Everest mit dem Spielzeug zwischen den Zähnen zurück. Er sah viel fröhlicher aus als noch ein paar Minuten zuvor.
Die beiden waren so vertieft in ihr Spiel, dass Stacy nicht bemerkte, wie sich das Licht veränderte, bis es so dunkel war, dass sie den Knochen in der Luft kaum noch erkennen konnte. Die Sonne war bereits vollständig hinter den Bäumen versunken.
„Schnell, Everest“, sagte sie. „Wir müssen gehen. Die anderen heulen bestimmt schon nach ihrem Abendessen.“