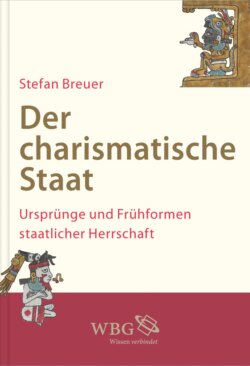Читать книгу Der charismatische Staat - Stefan Breuer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Vorspiel auf dem Theater: Ozeanien Melanesien
ОглавлениеFür eine Deutung auf der von Max Weber vorgezeichneten Linie, wonach Königtum und Staat als Ergebnis einer institutionellen Wendung des Charisma aufzufassen seien,1 scheint Ozeanien einen guten Ausgangspunkt zu bieten. Weber selbst hat den Blick in diese Richtung gelenkt, als er in seiner Religionssoziologie auf die sachliche Verwandtschaft zwischen Charisma und mana hinwies, einer in vielen Regionen Ozeaniens anzutreffenden Konzeption, in der sich der Glaube an übernatürliche oder übermenschliche, in jedem Fall außeralltägliche Kräfte manifestiert.2 Hält man diese Konzeption von der zu Webers Zeit von Marett und Durkheim vertretenen Annahme frei, aus der „tabu-mana-Formel“ eine Minimaldefinition von Religion ableiten zu können,3 so lässt sie sich ohne Weiteres für die Erklärung der Genese von Rangstrukturen heranziehen. Mana, so Roger M. Keesing, „ist ein Begriff, der zwei Lebensumstände unter den frühen Siedlern des Pazifik anspricht: erstens, die essentielle Unvorhersehbarkeit der Auswirkungen menschlicher Anstrengungen – in Krieg, Fischfang, Gartenbau, der Veranstaltung von Festen, Heilung und anderen Aktivitäten; und zweitens: die Ungleichheit der Menschen – in ihren Fertigkeiten und Erfolgen, ihrem Rang und ihrem Zugang zu den Göttern und Geistern“.4
Auf diesem Tatbestand hat der Neoevolutionismus weitreichende Folgerungen aufgebaut. In einer viel zitierten Studie hat Marshall D. Sahlins die These aufgestellt, es gebe in Ozeanien ein Gefälle bzw. eine von Westen nach Osten aufwärtsweisende politische Entwicklung, die von den kompetitiven und egalitären Ordnungen Melanesiens zu den stratifizierten Häuptlingstümern Polynesiens führe. Dieser Unterschied beruhe darauf, dass Macht in Melanesien an die Demonstration persönlicher Überlegenheit gebunden sei, in Polynesien hingegen aus einem Amt erwachse. „Magische Kräfte, wie sie ein melanesischer Big-Man erwerben mußte, um seine Position aufrechterhalten zu können, erbte ein polynesischer Oberhäuptling qua göttlicher Abstammung als mana, welches seine Herrschaft mit einer heiligen Aura versah und seine Person vor den Händen der Gemeinen schützte.“5 In einer anderen Arbeit, in der er die polynesische Ramage mit den segmentären Lineages des Sudans verglich, schlug Sahlins explizit den Bogen zu Weber, indem er mit Blick auf die Letzteren schrieb: „Hier ist Führerschaft eine charismatische persönliche Beziehung. Da sie auf persönlichen Bindungen und Eigenschaften beruht, ist sie nicht vererbbar. Sie ist kein Amt in einer bestimmten Gruppe; sie ist nicht Häuptlingsschaft.“6 Noch deutlicher formulierte Sahlins zeitweiliger Koautor und Mitbegründer des Neoevolutionismus, Elman R. Service, diesen Bezug, indem er Erbcharisma und Amtscharisma zu den institutionellen Errungenschaften erhob, die das Häuptlingstum von den segmentalen Gesellschaften schieden (Service 1977, S. 106ff.).
War noch für den frühen Sahlins mit dem polynesischen Häuptlingstum der Gipfel der soziopolitischen Evolution in Ozeanien erreicht, so machte Service in Hawaii deutliche Anzeichen für „eine etwas höhere politische Entwicklung in Richtung auf den Staat“ aus (ebd., S. 211). Irving Goldman (1970, S. 547) sah Tonga, Tahiti und Hawaii auf dem Weg zu „Proto-Staaten“. Die epigenetische Zivilisationstheorie stufte Hawaii als konischen Klanstaat, Tonga als Prestigegüter-System bzw. „dual State“ ein (Friedman/Rowlands 1977, S. 230f.). Andere, nicht dem evolutionistischen Paradigma verpflichtete Autoren sahen auf den sogenannten hohen Inseln (Tonga, Tahiti, Hawaii) ebenfalls die Ebene des „Proto-Staates“ oder sogar des „frühen Staates“ erreicht.7 In seinen neueren Arbeiten schwenkte auch Sahlins auf diese Linie ein, indem er auf die Kategorie des „göttlichen“ oder „heiligen Königtums“ rekurrierte, dessen Grenzen zum „archaischen Staat“ fließend seien (Sahlins 1992, S. 164). Der Verfasser einer Standardmonografie über das polynesische Häuptlingstum, Patrick V. Kirch, ging den gleichen Weg.8
An Ozeanien lässt sich jedoch studieren, dass die institutionelle Wendung des Charisma nur eine notwendige, keine hinreichende Bedingung für die Herausbildung des Staates ist. Damit aus charismatischer Herrschaft jene Monopolinstitution des legitimen physischen und psychischen Zwangs werden kann, für die in der Einleitung die Bezeichnung Staat/Kirche ins Spiel gebracht wurde, bedarf es bestimmter ökologischer Bedingungen, wie sie in Ozeanien nicht gegeben waren. Von den mehr als 7500 Inseln dieses Raums war die Mehrzahl zu klein, um eine wachsende Bevölkerung zu tragen. Auf den größeren Inseln stieß eine Erweiterung der Anbauflächen auf kaum überwindliche Hindernisse wie Wassermangel, Klimaschwankungen und Bodenbeschaffenheit. Auch eine umweltbedingte Abgegrenztheit im Sinne Carneiros existierte nicht. Wie schon die ersten Siedlungswellen zeigten, war das Meer alles andere als eine Barriere, vielmehr eine Bedingung, die sowohl Kontakte und Austauschbeziehungen als auch Abspaltungen und Wanderungen leicht machte. Als Grenze wirkte es lediglich bei den Außenposten des polynesischen Dreiecks, doch auch hier nicht in einem absoluten Sinne, waren sie doch bis Mitte des 15. Jahrhunderts Teil einer ausgedehnten Interaktionssphäre (Rolett 2002). Institutionelle Wendungen des Charisma waren damit in Ozeanien nicht ausgeschlossen. Wohl aber der Ausbau dieser Institutionen zum charismatischen Staat.
Karte 1: Ozeanien
Reiches Anschauungsmaterial für diese These liefert bereits jener Teil Ozeaniens, der bei Sahlins noch unter der Bezeichnung „Melanesien“ firmiert, einem heute aus hier nicht zu erörternden Gründen problematisierten Terminus.9 Anders als in Sahlins‘ Darstellung war diese Region durch sehr unterschiedliche Verbands- und Herrschaftsformen charakterisiert, deren Bandbreite von den Great Men und Big Men Neuguineas über die Gerontokratien Bougainvilles oder Nord-Vanuatus bis zu den Häuptlingstümern Neukaledoniens und der Trobriand-Inseln reicht.10 Im Hinblick auf die Letzteren ist allerdings eine Eigentümlichkeit festzuhalten. Obwohl es erbliche Ämter und elaborierte Ranghierarchien gab, brachten diese doch nirgends eine nennenswerte Erweiterung des politischen Verbandes mit sich. Die Rangstaffelung der Klans überschritt meist nicht die Ebene des Dorfes; die Klans, obgleich verstreut, erstreckten sich nicht sehr weit, sodass die Mehrzahl der erblichen Häuptlinge Verbänden vorstand, die kleiner als etwa die Territorien erfolgreicher Big Men waren (Allen 1984, S. 25). Die schwache Dynamik und Expansionskraft des melanesischen Häuptlingstums lässt sich deshalb schon daran ablesen, dass es keinerlei Absorptionstendenzen gegenüber benachbarten Verbänden mit geringerer soziopolitischer Kohäsion entwickelte. So waren etwa die Purari von Stämmen umgeben, die sowohl Big Man- als auch Great Man-Charakteristika aufwiesen; das Häuptlingstum von Buin, Bougainville, lag nicht weit von den Siuai entfernt, einer typischen Big Man-Gesellschaft; und die Big Nambas von Nord Malekula waren nur durch eine kurze Seefahrt von Vao getrennt, das von Ältesten geleitet wurde.11 Verglichen mit der Dynamik, die das Häuptlingstum in manchen Gebieten Polynesiens, etwa Tonga oder Hawaii, an den Tag gelegt hat, wirkt es in Melanesien zurückgestaut, beinahe wie eingefroren: als hätte es seine Zukunft nicht vor, sondern hinter sich.
Schon dieser Befund stimmt skeptisch gegenüber Versuchen, die verschiedenen Typen politischer Leitung in eine evolutionäre Sequenz zu bringen, die von Ältesten über Great und Big Men zum Häuptlingstum führt. Die Befürworter einer solchen Konzeption verfahren zumeist folgendermaßen: Sie bringen die Typen in eine bestimmte logische Folge, die sich an der Herausbildung sukzessiver Supra-Systeme orientiert – ‚upward evolution‘ in der Terminologie der Systemtheorie12 –, und suchen sodann nach empirisch-historischen Faktoren, die diese Sukzession erklären: das Bevölkerungswachstum, die Deszendenzsysteme oder die Entwicklung der Produktivkräfte. Besonders der letzte Faktor genießt ein erhebliches Ansehen. So ist etwa für Neuguinea geradezu von einer Revolution die Rede („Ipomean Revolution“), die durch die Einführung der Süßkartoffel Mitte des 18. Jahrhunderts bewirkt worden sei. Dies habe eine Intensivierung der Landwirtschaft und eine Steigerung der Überschüsse ermöglicht, die es wiederum gestattet habe, den Krieg, d.h. den Konflikt um knappe Ressourcen, durch den zeremoniellen Austausch zu ersetzen und damit auch die relative Bedeutung der Krieger zu vermindern. Godelier hat darin die Voraussetzung für die Transformation des Great Man in den Big Man gesehen (1987, S. 246f.). Andere sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben ein „evolutionäres Kontinuum“ konstruiert, das von den Great Men und Despoten des Ostens zu den Big Men des Westens reiche und mit „low-production societies“ auf der einen, „high-production societies“ auf der anderen Seite korreliere (Feil 1987, S. 92, 100). „Führer in Big-Man- und despotischen Gesellschaften repräsentieren daher in einem erheblichen Grad das Niveau des Entwicklungsstandes der Produktivkräfte in den entsprechenden Gesellschaftstypen“ (ebd., S. 108). Nach dieser Logik müssten die Häuptlingstümer, nach Feil ein typisches Küstenphänomen, den vorläufigen Höhepunkt der Evolution verkörpern (ebd., S. 93).
Das aber ist weder logisch noch historisch-empirisch überzeugend. Vergleicht man die verschiedenen Typen miteinander, so fällt der Big Man deutlich heraus. Sein Status ist, wenn auch an manchen Orten genealogische Faktoren einwirken, erworben, während derjenige des Ältesten, des Großen Schamanen und des Häuptlings, zugeschrieben ist. In Bezug auf die Rolle des Rituals führt ebenfalls die Linie vom Ältesten über den Great Man zum Häuptling, wohingegen in Big Man-Verbänden, zumindest im reinen Typus, die rituelle Integration zurücktritt (Liep 1991, S. 32f.). Historisch-empirisch spricht nichts für die Annahme, das westliche Hochland Neuguineas sei irgendwann einmal von Great Men oder Despoten bevölkert gewesen. Soweit die archäologische Forschung in diesem Punkt Aufschlüsse zu gewähren vermag, deutet alles darauf hin, dass diese Region seit Langem, genauer: seit acht- oder neun Jahrtausenden, eine Zone vergleichsweise intensiver landwirtschaftlicher Produktion war – sicher nicht so intensiv wie nach der „Ipomean Revolution“, aber doch weitaus intensiver als das östliche Hochland, die Heimat der Great Men und der Despoten.13 Die geringere Größe und Dichte der östlichen Gesellschaften, ihre Isolation und Instabilität machen es wahrscheinlich, dass wir es bei ihnen weniger mit der ersten oder zweiten Stufe einer „upward evolution“ zu tun haben, als vielmehr mit einem Prozess der Peripheralisierung oder Marginalisierung, wie er in der Geschichte häufig vorkommt.
Wenn jedoch nicht viel für eine Transformation des Great Man in den Big Man spricht, wenn darüber hinaus auch eine Permutation des Big Man in den Häuptling unwahrscheinlich ist, werden andere Szenarien erforderlich, als sie der Evolutionismus zu bieten vermag. John Liep hat in einem instruktiven Vergleich von drei Massim-Gesellschaften – Kiriwina, Nidula (Goodenough) und Yela (Rossel Island) – die These erhärtet, dass Nidula, eine Great Man-Gesellschaft, wie eine geschrumpfte oder verdrehte Rang-Gesellschaft wirke („a telescoped or in some respects inverted Kiriwina“), „als habe ein System mit demselben ursprünglichen Bauplan unter ungünstigen Reproduktionsbedingungen sich selbst zerlegt“ (1991, S. 41); und er hat hieraus, wie auch aus dem Vergleich mit Yela, den Schluss gezogen, die Region sei weniger von evolutionären als von devolutionären Vorgängen geprägt: „ein Theater unterschiedlicher ‚Dekonstruktionen‘ des verallgemeinerten Austauschs und der entsprechenden gesellschaftlichen Hierarchie“ (ebd., S. 37). Ähnliche Überlegungen hat Matthew Spriggs (1986) in einer vergleichenden Untersuchung von Aneityum und Tanna im südlichen Vanuatu angestellt und das politische System des Letzteren als eine devolutionäre Variante des Ersteren interpretiert.14 Mit Nancy McDowell lässt sich deshalb resümieren, es sei äußerst wahrscheinlich, „daß die ozeanischen, austronesischsprachigen Völker, die die Küsten Melanesiens kolonisierten, erbliche Häuptlinge des westpolynesischen Typs besaßen, und daß die Big-Man-Systeme der ethnographischen Gegenwart eine politische Devolution während der vergangenen zwei Jahrtausende widerspiegeln, in denen sich regionale Handelssysteme auflösten“.15
Die neuere archäologische Forschung bietet eine Reihe von Erkenntnissen, die diese Annahme stützen. Obwohl der weitaus größte Teil der Geschichte Ozeaniens nach wie vor im Dunkeln liegt, weiß man doch inzwischen, dass der Raum seit rund 40.000 Jahren besiedelt ist; dass die frühen Siedler seltene Rohstoffe wie Obsidian austauschten und dabei inselübergreifende Netzwerke bildeten, die sich etwa 20.000 Jahre zurückverfolgen lassen; und dass aus diesen Netzwerken, vielleicht aber auch durch Einwanderer aus Südostasien, um 1500 v. Chr. die Lapita-Kultur entstand, der gemeinsame Ausgangspunkt der Kulturentwicklung Melanesiens und Polynesiens (Kirch 1997). Ohne an dieser Stelle auf die anhaltende Debatte über die Ursprünge dieser Kultur und die Modalitäten ihrer Ausbreitung eingehen zu können,16 wird man doch folgende Punkte als relativ unkontrovers festhalten können: Lapita-Keramik taucht plötzlich auf und verbreitet sich in einer sehr kurzen Zeitspanne – etwa 8–10 Generationen – über ein gewaltiges Gebiet, das vom Bismarck-Archipel bis nach Westpolynesien reicht.17 Fernhandel und Kolonisation scheinen dabei Hand in Hand gegangen zu sein, denn zumindest in Westpolynesien stehen die ersten Besiedlungsspuren in einem deutlich Lapita-geprägten Kontext. Die archäologischen Funde deuten auf mobile, von Fischfang und Hortikultur lebende Gemeinden, die nahe der Küste lebten und ein Netzwerk reziproker Austauschbeziehungen unterhielten.18 Die weite Verbreitung von Muschelartefakten und Obsidian macht auch einen Handel mit Prestigegütern wahrscheinlich,19 sodass Friedmans Hypothese eines Prestigegüter-Systems auf tribaler Stufe in diesem wichtigen Punkt von der Archäologie her Sukkurs erhält.20
Das Areal, über das sich die Lapita-Kultur in so kurzer Zeit ausbreitete, war indes viel zu groß, um es den verschiedenen Teilgesellschaften zu erlauben, regelmäßige Kontakte zu unterhalten. Besonders schwierig war es für die Populationen im Hochland von Neuguinea, das nur über gefährliche, langwierige und kostenintensive Wege mit der Küste verbunden war und in dem der Fernhandel außerdem durch die ausgeprägte Feindschaft zwischen den benachbarten Gesellschaften behindert wurde. Dies schloss Handelsbeziehungen über längere Distanzen nicht aus, wie die Zirkulation von Perlmuscheln, Steinäxten und Salz belegt, machte diese aber eher zu einer Angelegenheit von Einzelnen als von jenen kollektiven Handelsexpeditionen, wie sie in den Küstengebieten üblich waren.21 Für die Südküste Papua-Neuguineas gibt es Hinweise auf eine Einbeziehung in das Lapita-Netzwerk (in der ersten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrtausends), das nach seiner Auflösung durch kleinere Systeme wie diejenigen von Motu und Mailu ersetzt wurde.22 Für die östliche Nordküste wurde Ähnliches im Umkreis der Vitiaz Strait nachgewiesen, wo auf ein frühes Netzwerk in der zweiten Hälfte des 1. nachchristlichen Jahrtausends ein Ensemble kleinerer Systeme um Siassi und Sio folgte.23 Weitere Interaktionssphären formierten sich im Massim-Gebiet mit dem berühmten Kula-Ring, in den Salomonen, den Santa Cruz-Inseln sowie zwischen Vanuatu und Neukaledonien.24 „Für die gesamten letzten zweitausend Jahre der Vorgeschichte Melanesiens“, so fasst Kirch diese Entwicklung zusammen, „gibt es Belege für eine allmähliche oder episodische Rückbildung oder Schrumpfung des geographischen Umfangs der Austauschnetzwerke, begleitet von einem folgenden Anstieg in der Größenordnung oder der Intensität des Austauschs im Rahmen dieser zunehmend kleineren Systeme“ (Kirch 1991, S. 155f.; 1997, S. 245).
Die höchst unterschiedlichen Möglichkeiten, die sich aus diesem allgemeinen Trend für die einzelnen Teilgesellschaften der Lapita-Kultur ergaben, verbieten es, die von den Neoevolutionisten postulierte Sequenz Älteste → Great Men → Big Men → Häuptlinge einfach umzukehren. Zwar sprechen linguistische Argumente dafür, bereits für Lapita von der Existenz von Häuptlingstümern auszugehen (Kirch 1997, S. 189), doch wird die folgende „downward evolution“ durch zu viele Faktoren beeinflusst, als dass man hier eine klare Sequenz konstruieren könnte. Eine intensive Landwirtschaft mit hohen Überschüssen, kombiniert mit einer Erschwerung des Fernhandels, begünstigte, wie im Hochland von Neuguinea zu studieren, Formen des Zeremonialtauschs, der wiederum dem Aufstieg von Big Men günstig war. Einmal etabliert, schränkten derartige Systeme die Entwicklungsmöglichkeiten angrenzender Gesellschaften mit schlechteren Produktionsbedingungen ein, sodass hier allenfalls Great Men die Bühne betraten. Big Men und Great Men stehen deshalb nicht in einem wie immer gearteten zeitlichen Sukzessionsverhältnis zueinander, sondern verkörpern eher alternative Entwicklungspfade, deren verschiedene Etappen nur empirisch zu klären sind (Liep 1991, S. 45). Andere Wege eröffneten sich, wenn zur intensiven Landwirtschaft Möglichkeiten des Wassertransports und Tauschpartner in einer die Maximalreichweite nicht übersteigenden Entfernung hinzukamen: Hier bildeten sich komplexe Häuptlingstümer mit hierarchischem Siedlungsmuster, Zeremonialzentren, Befestigungen und Bewässerungsanlagen, die eine dörferübergreifende Mobilisierung voraussetzten und darin in nichts hinter ihren polynesischen Pendants zurückstanden.25 Guiarts Studie über Südostmelanesien macht darüber hinaus einen Entwicklungspfad in Richtung Prestigegüter-Systeme wahrscheinlich, in deren Kontext die soziopolitische Ordnung in einer dualistischen, ‚dyarchischen‘ Richtung abgewandelt wurde (Guiart 1963, S. 41f.). Dass solche Ordnungen freilich auch unter anderen Voraussetzungen entstehen können, zeigt Westpolynesien.