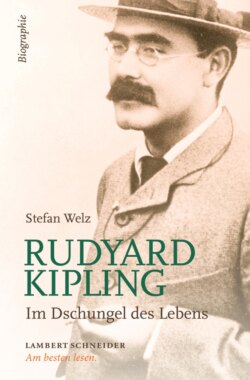Читать книгу Rudyard Kipling - Stefan Welz - Страница 6
Vorwort Rudyard Kipling: Im Dschungel des Lebens
ОглавлениеVor 120 Jahren schrieb Rudyard Kipling mit seinem Dschungelbuch einen Weltklassiker. Seitdem ziehen die Geschichten um Mowgli und seine Tierfreunde immer wieder Generationen von Kindern und Erwachsenen, von Leserinnen und Lesern in England und auf der ganzen Welt in ihren Bann. Das Buch ist eines jener Werke, bei denen die Allbekanntheit des Titels für sich spricht, während der eigentliche Autor in den Hintergrund getreten ist. Vielfältige Adaptionen wie die Disney-Verfilmung aus dem Jahr 1967 haben dem Dschungelbuch zu weiterer Bekanntheit verholfen, seinem Schöpfer hingegen nicht. Ein Epochenumbruch und zahlreiche Vorbehalte gegenüber der Person Kiplings bewirkten, dass er bereits in der zweiten Lebenshälfte den Niedergang seines beispiellosen Ruhms miterleben musste und heute weitgehend vergessen ist. Dabei stand der Schriftsteller zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im Zenit einer bis dahin nie gekannten öffentlichen Anerkennung. Man verglich ihn mit Charles Dickens, man wollte ihn adeln, zum Poeta laureatus krönen; er erhielt Ehrendoktorwürden in Kanada und England und schließlich – als erster englischer Schriftsteller – den Nobelpreis für Literatur. Die Liste der Werke, die Rudyard Kipling in den beiden Dekaden vor und nach der Jahrhundertwende schrieb, las sich für die Zeitgenossen wie eine geniale literarische Erfolgsgeschichte: The Light that Failed (1891; dt. Das Licht erlosch), Barrack-Room Ballads (1892; dt. Balladen aus dem Biwak), The Jungle Books (1894/95; dt. Das Dschungelbuch/Das neue Dschungelbuch), The Seven Seas (1896), Captains Courageous (1897; dt. Fischerjungs), The Day’s Work (1898), Stalky & Co. (1899; dt. Staaks und Genossen), From Sea to Sea (1899), Kim (1901; dt. Kim), Just So Stories (1902; dt. Genau-So-Geschichten), The Five Nations (1903), Traffics and Discoveries (1904), Puck of Pook’s Hill (1906; dt. Puck vom Bucksberg), Actions and Reactions (1909; dt. Spiel und Gegenspiel). Vielen Nachgeborenen hingegen erschienen große Teile davon nur noch als Ausgeburten eines undemokratischen, Gewalt verherrlichenden Imperialisten. Unvoreingenommene finden in Kiplings Büchern Belegstellen für beide Lesarten.
Wie kaum ein anderer Erfolgsautor seiner Zeit identifizierte sich Rudyard Kipling mit dem British Empire, das ihm in seiner glorreichen und fortschrittlichen Rolle als eine für alle anderen Länder beispielgebende Ordnung erschien. Wo immer er diese Ordnung befördern konnte oder sie gefährdet sah, warf er sich in die Bresche. So in Britisch-Indien als Journalist und Warner vor russischen Expansionsgelüsten, in Südafrika als Berichterstatter im Burenkrieg und in England als politischer Eiferer gegen das Selbstbestimmungsrecht Irlands. Kiplings patriotische Gedichte versetzten Briten gleich welcher Herkunft in einen Taumel der Begeisterung. Führende Komponisten vertonten seine Verse zu Hymnen oder Gassenhauern, die Abertausende ergriffen mitsangen oder in den music halls beim Bier grölten. Kiplings Lebenslauf und seine aktive Anteilnahme an den Geschicken des kolonialen Großreiches machten ihn zum Barden des Empire, in dem die Sonne niemals untergeht. Mit Anbruch des 20. Jahrhunderts war es das Deutsche Kaiserreich, dem er angesichts der aufkommenden Rivalität mit Großbritannien misstraute und dem er zunehmend dämonische Qualitäten zuschrieb. Das von ihm während des Ersten Weltkriegs beschworene Bild der Deutschen als Hunnen und Barbaren, an deren Grenzen die europäische Zivilisation ende, sollte Kiplings sinkende Popularität noch lange überdauern.
Die begeisterte Aufnahme, die das Dschungelbuch seit seinem Erscheinen auf der ganzen Welt gefunden hat, stellt es aus Kiplings umfangreichen Schaffen heraus und verleiht ihm den Rang eines universellen Meisterwerks. Die ungebrochene Nachfrage ließ Auflage um Auflage folgen. Ein Auflisten sämtlicher Ausgaben und Übersetzungen würde Seiten füllen. Der heute geläufige Titel Das Dschungelbuch ist nicht ganz zutreffend, denn es handelt sich eigentlich um zwei Kurzgeschichtensammlungen, die Kipling in kurzer Abfolge in den Jahren 1894 und 1895 veröffentlicht hatte. Schon bald fassten findige Verleger beide Sammlungen in einem Band zusammen. Das erzählerische Zentrum bilden acht lose miteinander verknüpfte Geschichten über den Jungen Mowgli und dessen Leben im indischen Dschungel. Sieben weitere Geschichten, die von Begebenheiten mit Tieren erzählen, werden an verschiedenen Stellen eingeschoben. Der zentrale Handlungsstrang verfolgt den Lebensweg des Menschenkinds Mowgli, das nach einem fehlgeschlagenen Angriff des hinterhältigen Tigers Shir Khan von seinen Eltern getrennt wird und Aufnahme beim Sioni-Wolfsrudel findet. Vor dem einberufenen Rat der Wölfe fordert Shir Khan die ihm entgangene Beute ein, doch die Fürsprache des gutmütigen Bären Balu und die Klugheit des Panthers Baghira wenden die Stimmung zugunsten des kleinen Jungen. Er darf bei dem Wolfsrudel bleiben. In seiner Adoptivfamilie lernt Mowgli die Gebräuche und Sprachen der Dschungeltiere kennen und wird in die Geheimnisse des Jagens eingeweiht. Baghira steht ihm als Beschützer zur Seite, Balu lehrt ihm das »Gesetz des Dschungels«. Doch die fortgesetzten Intrigen Shir Khans führen letztlich zu Mowglis Ausschluss aus dem Wolfsrudel. In dieser kritischen Situation wird sich der heranwachsende Junge seines Menschseins immer stärker bewusst. Seine Klugheit, die Herrschaft über das Feuer und der furchtlose Blick signalisieren den Tiergefährten Überlegenheit. Das Trennende zwingt Mowgli zum Verlassen des Dschungels. Betrübt macht er sich auf den Weg zu seinesgleichen, zu den Menschen im Dorf. Aber auch dort findet er keine Ruhe. Der rachsüchtige Tiger trachtet nach einem tödlichen Kräftemessen, das Mowgli durch Mut und List für sich entscheiden kann. Mowglis Kampf gegen den Tiger ist nur eines der gefahrvollen Abenteuer, die er zu bestehen hat. Eines Tages wird er von der gesetzlosen Affenhorde des Bandar-log in eine versunkene Stadt entführt. Erst die Hilfe der Riesenschlange Kaa befreit ihn aus der misslichen Lage. Später kehrt er auf der Suche nach einem Schatz an den Ort zurück. Andere Geschichten erzählen von Mowglis Bewährung in Zeiten der Dürre und im Kampf gegen räuberische Wildhunde. Die Machenschaften eines böswilligen Jägers, der die Dorfbewohner gegen Mowgli und seine leiblichen Eltern aufbringt, zwingen den Jungen, die menschliche Ansiedlung mit Hilfe seiner Tierfreunde zu zerstören. Voller Enttäuschung über die Menschen zieht sich der Herangewachsene einstweilen wieder in die Tiergemeinschaft des Dschungels zurück. Doch kommt der Tag, an dem er sich erneut vor die Wahl seines zukünftigen Wegs gestellt sieht.
Ebenso beliebt wie die Geschichten um Mowgli sind die eingeschobenen Tiergeschichten, von denen manche auch einzeln veröffentlicht wurden. Sie erzählen von Bewährung, Klugheit und Mut der oftmals kleineren Tiere in ihrer Auseinandersetzung mit überlegenen Feinden oder widrigen Verhältnissen. In der Geschichte »Rikki-Tikki-Tavi« nimmt ein unerschrockener Mungo den Kampf mit zwei Kobras auf, um das Heim der Menschen vor Unheil zu schützen. In »The White Seal« (dt. »Die weiße Robbe«) führt das heranwachsende Robbenjunge Kotick seine bedrohten Brüder und Schwestern zu einer paradiesischen Insel, wo sie vor den Grausamkeiten der Robbenjäger sicher sind. In der packenden Schilderung der Lebenswelt der Tiere und dem Zuschreiben menschlicher Eigenschaften vereint Kipling sowohl realistische als auch phantastische Momente. Die märchenhafte Kombination seiner Dschungelgeschichten traf den Nerv eines zeitgenössischen Lesepublikums, das sich gegenüber einer neuen gesellschaftlichen Sicht auf Kind und Tier aufgeschlossen zeigte. Das Kind war inzwischen in den Mittelpunkt der idealisierten viktorianischen Familie gerückt, das Tier war zum Objekt von Fürsorge und Mitleid geworden. Kipling schrieb immer wieder Geschichten für Kinder und über Kinder, denn dieser Status der Freiheit und Unbestimmtheit hatte etwas Magisches für ihn. Dabei präsentieren sich seine literarischen Kinder zumeist als Waisen, die ein wirkliches Familienleben nie kennengelernt haben. Literarisch ist das ein Kunstgriff, der den kindlichen Charakteren Handlungsfreiheit verschafft; es hat aber auch mit der persönlichen Lebensgeschichte des Autors zu tun. Getrennt von den Eltern, die für den britisch-indischen Kolonialdienst arbeiteten, musste Kipling in seiner Kindheit Jahre der Einsamkeit und emotionalen Kälte in England verbringen. Es ist kein Zufall, wenn sich Mowgli in der Zwischenwelt des Dschungels heimisch fühlt, bis er deren Grenzen erkennt. Lange steht der Junge den Tieren näher als seinen eigenen erwachsenen Artgenossen. Darin schwingt Kritik an der hierarchischen Kulturtriade Tier – Kind – Erwachsener mit, die Kiplings Zeitgenossen als anthropologische Selbstverständlichkeit galt. Kipling ist ein Schriftsteller, dessen Phantasie sich am besten in Zwischenzuständen zu entfalten vermag. Seine literarischen Charaktere pendeln zwischen Kindheit und Erwachsenenwelt, Menschen- und Tierreich, Kolonisten und Kolonisierten. In seinem Schreiben schafft er immer wieder derartige Zwischenstadien, sei es die Kindheit, das Empire oder der Dschungel. Ihnen kommt lebensweltliche Bedeutsamkeit zu und sind doch frei für die Imagination, sie kennen feste Regeln und sind doch offen für eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Der versierte Autor Kipling, der im Spannungsfeld unterschiedlicher Kulturen aufwuchs, verstand es, mit seiner scharfen Beobachtungsgabe vielfältige Einflüsse aufzunehmen und in seinem Schaffen zu verarbeiten. Im Dschungelbuch übersetzt er das viktorianische Postulat vom Mitleiden mit der anderen Kreatur, den Kult um das Haustier und darwinistische Gedanken in die exotische Welt Britisch-Indiens. Dort verfiel er bereits als kleiner Junge vor der imposanten Kulisse seiner Geburtsstadt Bombay dem Zauber der indischen Erzähltradition. Er lernte deren reiches Repertoire an Tiergeschichten kennen, in dem auch Erzählungen von Wölfen vorkommen, die kleine Kinder retten, in ihr Rudel aufnehmen und großziehen. Von seinem Vater Lockwood Kipling, der sich als Museumskurator und Indienkenner auch mit dem Verhältnis von Mensch und Tier im Hinduismus beschäftigte, erhielt er reichlich Material für seine Dschungelgeschichten. So vermischt sich im literarischen Erzählen des Sohnes westlicher Forscherdrang mit östlicher Lebensweisheit, aufklärerischer Gestaltungswille mit erzählerischer Phantasie. Kiplings Dschungeltiere zeigen Eigenschaften, die nicht nur einem christlichen Traditionsverständnis entspringen. Während einige der Tiere – wie die verschlagenen, schamlosen Affen des Bandar-log und der starke, machtlüsterne Tiger Shir Khan – der abendländischen Symbolik entsprechen, ist die Baumschlange Kaa in ihrer Gutmütigkeit weit vom Luzifer-Stigma entfernt. Auch der Bär Balu verkörpert keineswegs das Böse oder die Habsucht, wie es ihm traditionell zugeschrieben wird. Kiplings Dschungelwelt überrascht den Leser mit Vertrautem und exotisch Verfremdetem zugleich, mit moralischen Regeln und biologistischen Grundsätzen. Das alles bringt der noch nicht einmal 30-Jährige auf seinem damaligen Wohnsitz in Bratteleboro im Neuengland-Staat Vermont zu Papier. Die Heirat mit seiner amerikanischen Frau Caroline Balestier hatte ihn in den Nordosten der USA verschlagen, der ihm als neue Heimat zusagte. Nach harten Jahren der journalistischen Ausbildung in Indien und einem Zwischenaufenthalt in London, der seiner Karriere als Schriftsteller dienen sollte, baute Kipling an diesem abgelegenen Ort ein erstes Heim für seine junge Familie. Er verlebte dort die glücklichste Zeit seines Lebens. Leider währte sie nur allzu kurz.
Im Dschungelbuch bewohnen die Menschen und die freien Tiere des Dschungels getrennte Lebensbereiche und haben nur wenig Kontakt miteinander. Die Welt der Menschen ist kompliziert und widersprüchlich, ihr Verhalten unberechenbar. Dagegen herrscht innerhalb der tierischen Gemeinschaft ein ethisch-biologistisches Gesetz, das durch Hierarchie, Gehorsam, Solidarität, Respekt und Furcht den Zusammenhalt und das Zusammenleben regelt. Jeder Dschungelbewohner muss sich ihm beugen, denn, so weiß Balu in »Wie Furcht kam«, »das Gesetz sei wie die Riesenliane, die jedem über den Rücken fällt und der keiner entkommen kann«. Kiplings Gesetz lässt sich nicht allein mit sozialdarwinistischen Grundsätzen der Dominanz des Stärkeren und der natürlichen Auswahl erklären, sondern präsentiert sich als unabänderlich ewigliche Notwendigkeit des Lebens. Während die Episoden vom Lernen und Kämpfen und die exotischen Beschreibungen an ein junges Lesepublikum gerichtet sind, weisen das »Gesetz des Dschungels« wie auch Mowglis Pendeln zwischen Menschen- und Tierwelt über gängige Muster der Kinderliteratur hinaus. Die Sympathie, mit der Kipling das Dschungelleben schildert, legt nahe, dass er die Regeln dieses Kosmos den unverständlichen Handlungen und Beweggründen der Menschen vorzieht. Doch als Rousseau’sche Alternative wollte er sie wiederum nicht verstanden wissen, denn am Ende findet Mowgli den Weg zurück zu den Menschen. Die moralisierend-didaktische Absicht des Autors ist unübersehbar. Eigenschaften wie Gesetzestreue, Unterordnung, Pflichtbewusstsein und Selbstbeherrschung sind positiv besetzt, um eine ideale Gemeinschaft aufzuzeigen, die wiederum einen Vergleich mit dem Zustand menschlichen Zusammenlebens anregen soll. Obwohl sich Kiplings phantastische Tierwelt in den Weiten des indischen Dschungels verliert und der immerwährende Wechsel der Jahreszeiten und die Abläufe der Natur sie dem menschlichen Zeitmaß entheben, sind die Geschichten auch seiner eigenen Epoche verpflichtet. Das Insistieren auf exemplarischen moralischen Werten spiegelt Kiplings Sorge um den Zustand des britischen Weltreichs und den vermeintlichen Niedergang männlicher Tugenden wider.
Die Freude jugendlicher Leser liegt weniger im Sinnieren über die Feinheiten eines Verhaltenskodexes, sondern im Entdecken des Dschungelkosmos – jener Parallelwelt, in der das Menschenkind seine Initiation erfährt. Regeln und Rituale wie der Dschungelgruß »Gute Jagd!« tragen zum Wirklichkeitsanspruch bei und stärken die Vorstellungskraft. Die Analogien zu Kiplings praktiziertem Freimaurertum sind unübersehbar. Die vermenschlichten Tiere laden durch ihre Sprachfähigkeit und ihre vertrauten Mentalitäten zur Identifikation und zum Aufbruch in imaginierte Welten, zu Spannung und Abenteuer ein. Menschliche Grenzen im freien Gedankenspiel der Vorstellungkraft zu überwinden und die individuelle Selbstfindung in einem exotischen Umfeld zu erproben – darin liegt der eigentliche Reiz des Dschungelbuchs für junge Leser. Und noch eine weitere Zutat garantiert dessen andauernden literarischen Erfolg: Kipling bringt die märchenhafte Verschmelzung von Orient und Okzident erzählend zustande. Mit der Art seines Erzählens, dem eine universelle Dimension eigen ist, hat er Menschen aus unterschiedlichen Kulturen erreicht. Daher gehören nicht nur viele seiner Geschichten, sondern eigentlich sein Geschichtenerzählen an sich in das Pantheon der Weltliteratur. Kiplings vorzügliche Gaben der präzisen Beobachtung und lebensnahen Imitation erlaubten es ihm, Wirkliches, Ersonnenes und Geheimnisvolles in Form eingängiger Geschichten zu verschmelzen. Seine Erzählweise entsprang unmittelbaren Erfahrungen, denn bereits frühzeitig erfuhr der belesene Junge, dass sein Hineinträumen, sein Sich-Hineinversetzen in eine andere Welt das Erfolgsrezept für sein Bestehen in der realen Welt ist. Seinem Geburtsland Indien muss Kipling gleich in dreifacher Hinsicht für die empfangenen erzählerischen Gaben dankbar sein: Die reiche orientalische Erzähltradition erschloss sich ihm bereits durch seine Kinderfrau, die Geschichten nicht nur erzählte, sondern auch vorspielte. Hinzu kamen die eigenen Eindrücke der verwirrend bunt schillernden, lebendig-quirligen Lebenswelt Indiens, die er als Kind und später als Journalist empfing und in Form von Anekdoten, Schnurren, Geschichten und Berichten sammelte. Und Vater Lockwood eröffnete ihm den Blick für die Legenden und Mythen der uralten Kulturen des Subkontinents. Kipling verfügte über ein feines Gehör für Sprachen, Dialekte und den Fachjargon und wusste diese glaubwürdig zu imitieren. Während seines frühen unfreiwilligen Aufenthalts in England wurde er mit dem Alten Testament vertraut und las die Geschichten aus Tausend und einer Nacht, die in den 1880er-Jahren in neuen mehrbändigen Übersetzungen erschienen waren und sich großer Beliebtheit erfreuten. Kiplings Erzählen bedient sich all dieser Schätze, die in seinen Geschichten als narrative Urmuster von den unglücklichen Liebenden, von David und Goliath, vom Wolfskind oder der Figur des pfiffigen Schalks aufscheinen. Der letzteren Figur des listenreichen, redegewandten Außenseiters, der kindlichen Freiheiten und instinkthaftem Treiben nahesteht, konnte Kipling besonders viel abgewinnen. Immer wieder bricht bei ihm die rebellische Freude am Überlisten und Streichespielen hervor. Jugendliche Schnoddrigkeit, Respektlosigkeit und Rüpelhaftigkeit waren das Wetterleuchten, das die großen Generationskonflikte des 20. Jahrhunderts ankündigte. In Kiplings Texten sind die Grenzen zwischen Spaß, Schabernack, Lausbüberei, Zote und blutigem Ernst fließend. Mowgli ersinnt einen listigen Plan und lässt seinen Gegner Shir Khan in den sicheren Tod laufen, der ihm in Gestalt der wilden Büffelherde unaufhaltsam entgegenrast. Später sind es Kiplings drei Collegekadetten, die zwei Fischerjungs oder Una und Dan aus den Puck-Geschichten, die die Tradition aufrührerischer und selbstbewusster Jugendcharaktere fortsetzen. All das vermag der geniale Erzähler Kipling mit dem Charme der jahrhundertealten Erzählkunst zu vermischen, um den staunenden Leser in seinen Bann zu schlagen:
Nachdem er den Dschungel eingelassen hatte, begann der angenehmste Teil von Mowglis Leben. Er hatte das gute Gewissen dessen, der seine Schulden bezahlt hat; alle im Dschungel waren mit ihm befreundet und hatten ein wenig Angst vor ihm. Die Dinge, die er tat und sah und hörte, wenn er von einem Volk zum anderen zog, mit oder ohne seine vier Gefährten, würden viele viele Geschichten ergeben, jede so lang wie diese. Deshalb werdet ihr nie hören, wie er dem irren Elefanten von Mandla begegnete, der zweiundzwanzig Ochsen getötet hatte, die elf Wagen mit gemünztem Silber zur Schatzkammer der Regierung zogen, und der die glitzernden Rupien im Staub verstreute; wie er mit Jacala dem Krokodil kämpfte, eine ganze lange Nacht in den Marschen des Nordens, und sein Häute-Messer auf den Rückenplatten der Bestie brach; wie er ein neues und längeres Messer am Hals eines Mannes fand, der von einem wilden Keiler getötet worden war, und wie er diesen Keiler aufspürte und tötete, als angemessenen Preis für das Messer; wie er einmal in der großen Hungersnot zwischen die Hirschzüge geriet und in den schwankenden hitzigen Herden fast zu Tode gequetscht wurde; wie er Hathi den Schweigsamen davor bewahrte, noch einmal in einer Grube mit einem Pfahl darin gefangen zu werden, und wie er am nächsten Tag selbst in eine sehr geschickt angelegte Leopardenfalle fiel, und wie Hathi die dicken Holzstangen über ihm in Stücke brach; wie er die wilden Büffel im Sumpf molk, und wie … Aber wir müssen eine Geschichte nach der anderen erzählen.« (Dschungelbücher: 371f.)
Wie Sheharazade weiß Kipling, dass es beim guten Erzählen immer um Leben und Tod des Erzählers geht. Es ist der Erzähler, der die Perspektive seiner Charaktere wählt, ihre Dialoge setzt, Rhythmus und Tempo bestimmt, verheimlicht und verrät. Die Geschichte lebt durch ihn oder geht mit ihm unter. Da Kipling nicht nur Erzähler, sondern auch Dichter ist, schreibt er für seine Geschichten eingängige Songs, die er ihnen voran- oder nachstellt. Sie verstärken das Gesagte effektvoll und schaffen eine besondere Aura. Kiplings Anspruch geht über das traditionelle Erzählen aus Tausend und einer Nacht hinaus. Er erkundet die Möglichkeiten des mündlichen Erzählens, indem er sich der englischen Sprache auf moderne Art und Weise bedient. Dabei schweift sein Blick auch zu anderen englischsprachigen Gegenwartsautoren. Rider Haggards exotisch-phantastische Erzählungen haben ihn ebenso inspiriert wie der kompakte Kurzprosastil des geschätzten Robert Louis Stevenson. Kipling verbindet die alten Geschichten mit neuen Inhalten aus der Welt, die ihn unmittelbar umgibt: mit der Vielfalt der Menschen im gewaltigen Indien, dem Leben der Kolonialherren, der Armee, dem Fortschritt, den Maschinen. In diesem Sinne ist er einer der modernsten Erzähler überhaupt, und es steckt viel mehr Kipling in Hollyrwood, als die Verfilmung seiner Dschungelbücher erahnen lässt.
Kipling wurde vor 120 Jahren anders gelesen als von nachfolgenden Generationen. Etliches in seinem Werk hat den Wandel des Zeitgeschmacks und den Fortgang der Geschichte nicht überdauert. Seine Erzählkunst hingegen, von der das Dschungelbuch bestes Zeugnis ablegt, hat bis heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Dennoch werden heutige Leserinnen und Leser auch in den Dschungelgeschichten manches mit Überraschung und manches mit Stirnrunzeln lesen. Kiplings Vorstellungen von Erziehung sind hierarchisch und schließen körperliche Züchtigung so kritiklos ein, als sei sie naturgegeben. Immer wieder präsentiert sich die Initiation als gefahrvolle Bewährungssituation. Immer wieder ist es die Gestalt des kleinen Jungen, der seinen Platz in der Welt suchen und ihn unter Anstrengungen behaupten muss – sei es der jüngste Elefantentreiber, dem schließlich der Ehrentitel »Toomai, der Liebling der Elefanten« verliehen wird; sei es der kleine Eskimojunge Kotuko, der mit seinem Hund schier Übermenschliches vollbringt, um sein Dorf vor dem Hungertod zu bewahren. Häufig erscheinen die Prüfungen als Kampf auf Leben und Tod, wobei der Kleinere furchtlos den Größeren angreift und letztlich besiegt. Darstellungen des Tötens und Jagens in der Tierwelt sind allgegenwärtig. Das Blut spielt ebenfalls eine Rolle, wenn auch eher in mystischer Bedeutung. Mowgli ist einem sozialen Zugehörigkeitszwang unterworfen, der sich auf Blutsbande begründet und ihn nach seinesgleichen suchen lässt. Es gibt viele unerschütterliche Gewissheiten in der Welt des Dschungels, wie die von alters her feststehenden Hierarchien mit dem Stärkeren an der Spitze, der nur durch den Listigen zu Fall gebracht werden kann. Dennoch erwartet die Leser der Dschungelgeschichten ein solcher erzählerischer Reichtum und eine solche gedankliche Fülle, dass etwaige Unzulänglichkeiten aus heutiger Sicht schnell vergessen sind. Kiplings moralisches Beharren auf Rang, Ordnung und Gehorsam erfolgt nicht um seiner selbst willen, sondern vermittelt edle Botschaften: Es ist das mutige Menschenkind, das den bösen Tiger Shir Khan besiegen kann; es ist die Solidarität der Dschungeltiere, die ihr Überleben in Zeiten der Dürre und Gefahr sichert. Und es ist die Gemeinschaft selbstbewusster, eigenständiger Charaktere, die das Verlangen erweckt, sich ihr anzuschließen. Es gehört zu Kiplings stärksten literarischen Gaben, dass er seinen Geschichten Gefühle von menschlicher Teilhabe und Zugehörigkeit so überzeugend einzuschreiben vermag. Das Dschungelbuch hat das literarische Potenzial, um vor dem zeitlichen Wandel der Lesarten zu bestehen. Die einst unterliegende Idee vom imperialistischen Sendungsbewusstsein ist zugunsten anderer, heutzutage bedeutsamer Momente von Freundschaft, Miteinander und Abenteuer in den Hintergrund getreten. Dazu trugen auch zahlreiche Filmadaptionen bei, die allerdings oft vom Original abweichen.
Bei allem, was in die Dschungelgeschichten hinein- oder aus ihnen herausgelesen werden kann, wird häufig vergessen, dass sie auch biographisches Zeugnis ablegen. Mit ihrer Themenvielfalt des Exotischen, des Jungenhaften, der Initiation, des Abenteuers, des Gesetzes, der Zwischenwelt und des Empire tragen sie unverkennbar die literarische Handschrift des englischen Erfolgsautors. Sie sind das literarische Werk eines jungen, rebellischen Schriftstellers, der mit Anfang dreißig zum ersten Mal er selbst sein kann; eines Mannes, der im British Empire geboren und aufgewachsen ist, aber nirgendwo ein richtiges Zuhause hat; eines Mannes, der in so kurzer Zeit zu spektakulärem Ruhm gelangt ist, dass ihn der Erfolg belastet und verstört. Das Dschungelbuch markiert einen neuen Lebensabschnitt, in den Kipling mit der Heirat und der Gründung eines eigenen Hausstands eintritt. Es ist die Zeit für ein erstes Lebewohl in Richtung Indien und ein Zwischenresümee, das ihn zur Kindheitsthematik führt. Zwei Jahre vor Erscheinen der Sammlung hatte Kipling die Schwester seines besten Freundes Wolcott Balestier geheiratet, und noch im selben Jahr war er erstmals Vater geworden. Die eigene Familie wird von nun an zum Lebensmittelpunkt. Damit lockern sich die sehr engen Bindungen zu den Eltern, die bis in sein Schaffen eingegriffen hatten, indem sie ihn überredeten, ein gewagtes Romanexperiment mit indischer Thematik aufzugeben. Im Dschungelbuch schreibt Kipling in kodierter Form über sich selbst – seine leidvollen Erfahrungen in England, seine Sehnsucht nach einer idealen Phantasiewelt, seine Furcht vor dem Erwachsenwerden, seine Beziehung zu den Eltern und über die Mutterfigur, die in den Geschichten Mowgli beim Übergang in die Menschenwelt behilflich ist. Eine allzu enge Beziehung zwischen Leben und Werk zu unterstellen, ist allerdings auch bei Kipling problematisch. Umso mehr, da er nahezu besessen auf Wahrung seiner Privatsphäre bestand und darin in seiner Frau eine treue Verbündete hatte. Mit Akribie vernichteten die beiden immer wieder persönliche Zeugnisse. Rudyard Kipling, selbst ein Mann der Medien, wusste nur zu gut, was es heißt, eine öffentliche Person zu sein, bei der Ruhm und Gerücht eng beieinander liegen.
Rudyard Kiplings Biographie hat einen hohen kulturhistorischen Wert – nicht nur in der englischsprachigen Welt, wo heutzutage jede neue Lebensgeschichte über ihn zu einem Ereignis wird. Seine Person ist ganz unmittelbar mit einer wichtigen Phase der britischen Geschichte verknüpft. Sein Leben kennt erschütternde Schicksalsschläge, die es zu einem der tragischsten der Literaturgeschichte machen. Sein literarisches Talent ist nach anfänglichem Ruhm zu Unrecht vergessen worden, obwohl sich immer wieder namhafte Schriftsteller auf ihn berufen haben. Kipling erlebte den Aufstieg zur Weltgeltung wie auch den Niedergang. Er erfuhr viel persönliches Leid und nur wenig Erfüllung. Er musste neben dem furchtbaren Verlust zweier Kinder den schleichenden Verfall seiner Wertvorstellungen bewältigen. Mit seinem literarischen Talent, mit seiner Frische, seiner Chuzpe, seiner Neugier stünde ihm ein privilegierter Platz in der Literaturgeschichte zu. Doch dazu hätte er den zahlreichen Autoritäten, denen er zeitlebens unterworfen war, resoluter die Stirn bieten müssen: den Eltern, dem Empire und dem Gesetz, das er sich selbst auferlegt hatte. In diesem Fall hätte das Empire womöglich einen anderen Dichter zu seinem Barden küren müssen und Kiplings literarisches Werk wäre unbeschadeter der Nachwelt erhalten geblieben. Doch der Rudyard Kipling, der er war, blieb vor allem seiner eigenen Zeit verpflichtet. In der letzten Geschichte des Dschungelbuchs wird sich Mowgli aufgrund der Blutsbande immer stärker seines Menschseins bewusst und kehrt mit knapp 17 Jahren in die Zivilisation zurück – in der schmerzhaften Gewissheit, fortan zwischen zwei Welten hin und her gerissen zu sein. Rudyard Kipling hat gewusst, dass er mit dem unausweichlichen Schritt aus der exotisch-idealisierten Tiergemeinschaft in die raue Menschenwelt sein literarisches Geschöpf in einen weit gefahrvolleren, unberechenbareren Dschungel schickt – in den Dschungel des Lebens.