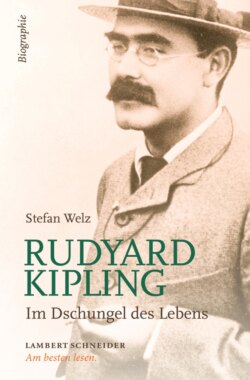Читать книгу Rudyard Kipling - Stefan Welz - Страница 7
1. Ostwärts und westwärts Kindheit in Indien – Schulzeit in England
(1865–1882)
ОглавлениеAm 11. Mai des Jahres 1865 entstieg ein nicht mehr ganz junges englisches Paar von Sues kommend dem P&O-Dampfer Rangoon im Hafen von Bombay. Der stämmige Mann mit üppigem Vollbart und die gesetzt wirkende, attraktive Frau reisten mit nur wenig Gepäck. Der Sueskanal war noch im Bau, weshalb sie den Großteil ihrer Habseligkeiten über die lange Route via Kapstadt verschifft hatten. Später mussten sie feststellen, dass die Fracht offenbar verlorengegangen war. Doch dieser Verlust wurde durch die große Hoffnung der beiden auf eine neue Lebensperspektive in der reichen indischen Handelsmetropole mehr als wettgemacht. Alice Kipling, geborene Macdonald, hatte den Mann an ihrer Seite drei Jahre zuvor bei einem Picknick am Lake Rudyard nahe Burslem in der englischen Töpferregion von Staffordshire kennengelernt. Schon bald gingen sie gemeinsam nach London, um der Provinzialität zu entfliehen, an die familiäre Verpflichtungen sie gebunden hatten. Das Department of Science and Art in South Kensington und das dortige Museum, an dem John Lockwood Kipling bereits früher als Modellierer gearbeitete hatte, sollte dem Paar als soziales Sprungbrett in ein unabhängiges Leben dienen. Ab Juni 1863 fand Lockwood dort erneut Anstellung als Architekturdesigner. Schon im Dezember des darauffolgenden Jahres bot sich die erhoffte Karrieremöglichkeit, als ein hoher Richter aus Bombay mit besonderem Interesse an künstlerischer Bildung auf Besuch in London weilte und an den öffentlichen Schulen Ausschau nach geeigneten jungen Leuten für den Staatsdienst in Britisch-Indien hielt. Lockwood Kipling, der sich im Verlauf einer siebenjährigen Ausbildung über erste Berufserfahrungen in einer Töpferei und Abendkurse an der Stoke School of Art emporgearbeitet hatte, ließ sich gerne und vielleicht auch ein wenig naiv für einen Posten im fernen Indien rekrutieren. Seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Designer und Architekturmaler Godfrey Sykes hatte ihn nachdrücklich empfohlen. Ein während dieser Zeit entstandener Fries ist noch immer im Hof des heutigen Victoria and Albert Museum in London zu sehen.
In der näheren Verwandtschaft des Paares gab es einige Männer und Frauen, die eine Meinung zu dem Vorhaben der beiden Indien-Reisenden hatten, aber kaum jemanden, der etwas über den Civil Service auf dem Subkontinent oder anderswo in den Weiten des British Empire aus unmittelbarer Erfahrung hätte sagen können. In den Stammbäumen der Macdonalds und der Kiplings fanden sich bis dahin keine Militärs und Staatsdiener, sondern Bauern und Männer der Kirche – namentlich Methodisten. Sie waren Anhänger einer protestantischen Erneuerungsbewegung, die im georgianischen England ihre Wurzeln hatte. Gleich den Macdonalds konnten auch die Kiplings ihren Stammbaum auf Ursprünge in der alten Grafschaft Yorkshire zurückführen. Die Kiplings waren alteingesessene Farmer, deren Name im 18. Jahrhundert nördlich von Whitby und andernorts in der Region nachweisbar ist. Lockwood Kiplings direkte Vorfahren entstammten dem kleinen Dorf Lythe. Als Bauern und Prediger blieben sie dem Boden und dem Glauben verbunden. Erst Lockwood brach mit der Tradition. Über seine fünf Geschwister ist kaum etwas bekannt.
Die Region Yorkshire im Nordosten Englands gilt als rau und unwirtlich. Hochmoore und Heideland bestimmen das Bild. Im Westen wird sie von den Gebirgszügen der Penninen, im Osten von der Nordsee begrenzt. Jahrhundertelang bäuerlich geprägt, entstanden im Maschinenzeitalter Textilmanufakturen, Kohlebergwerke und Stahlfabriken, die den Takt der Industriellen Revolution in England maßgeblich mitbestimmten. In jenen Jahren schrieben die Brontë-Schwestern Anne, Emily und Charlotte in dem kleinen Ort Haworth ihre späterhin berühmten Romane. Darin setzten sie der Landschaft und dem dort lebenden Menschenschlag ein bleibendes Denkmal. Das keltische Erbe der Brontës wurde auch von Alice Macdonald geteilt, die ihre Vorfahren bis zu den schottischen Clans zurückverfolgen konnte. Die meisten Verwandten ihrer Generation, unter ihnen nicht wenige berühmte Persönlichkeiten, waren allerdings in London ansässig. Die Schwester Georgiana hatte mit Ned Jones einen Mann geheiratet, der als Sir Edward Burne-Jones zum Inbegriff der präraffaelitischen Malerei wurde. Eine weitere Macdonald-Schwester namens Louisa war mit dem Stahlhändler Alfred Baldwin aus Worcestershire verheiratet. Ihr Sohn Stanley wurde Rudyard Kiplings Spielgefährte und avancierte später zum britischen Premierminister. Agnes, die vierte Macdonald-Schwester, war eine Ehe mit dem Künstler Edward Poynter eingegangen. Dessen Leistungen wurden mit einem Adelstitel gewürdigt. Als Sir Edward stieg er 1896 zum Präsidenten der Königlichen Akademie auf.
Im englischen Mutterland verankert und überwiegend liberal gesinnt, standen die Macdonalds der Überseeunternehmung ihrer Tochter und Schwester reserviert gegenüber. Noch am Vorabend der Abreise mühte sich Lockwood, die Bedenken von Alices Verwandtschaft hinsichtlich der Sicherheit und eventueller gesundheitlicher Risiken zu zerstreuen. Henry (Harry) Macdonald, Alices Bruder, hatte das traurige Beispiel eines Freundes im Indian Civil Service angeführt, der in der unwirtlichen Fremde den Tod seiner Frau beklagen musste. Die zum Indien-Abenteuer Entschlossenen ließen sich von derartigen Geschichten aus zweiter Hand nicht abschrecken. Harry hingegen suchte – nach anfänglichem Interesse an einer Karriere im Indian Civil Service – sein Glück lieber in Amerika. Eine solche Ausgangslage stellte das Paar fortan unter Rechtfertigungsdruck, der sich immer wieder auf die Familienpläne auswirken sollte. Es galt nicht nur die Richtigkeit der getroffenen Entscheidung für Indien zu beweisen, sondern auch mit den erfolgreichen Daheimgebliebenen mitzuhalten. Deren Ansichten wiederum sind aus einer Bemerkung Agnes’ zu erahnen, in der sie sich angesichts einer Ausstellung von Skulpturen aus Indien im South Kensington Museum »zunehmend beschämt über Johns Mission in diesem Land« (zit. in: Allen: 65) äußerte. Hinzu kam ein weiteres Moment, das die beiden Zweckoptimisten allerdings erst im Verlauf ihres neuen Lebens in der Fremde erkennen sollten. Mit ihrer Wahl für Indien begaben sich Lockwood Kipling und Alice Macdonald in einen Zwiespalt zwischen ihren eigenen Ambitionen, die überwiegend künstlerisch-intellektueller und sozialer Natur waren, und dem in der Familientradition weitgehend unbekannten, strengeren Regiment des Staatsdienstes im Empire. Dieser Zwitterstatus verlangte ihnen viel an Kompromissen und Mühen beim Knüpfen von Beziehungen ab, sollte ihrem berühmten Sohn hingegen zu einem wesentlichen Antrieb seines literarischen Schaffens werden.
Am 18. März 1865, nach fast zweijähriger Verlobungszeit und wenige Wochen vor ihrer Abreise nach Indien, hatten Alice und Lockwood geheiratet. Als die jungvermählte Frau knapp zwei Monate später den steinernen Pier im Hafen von Bombay entlangschritt, dachte sie vielleicht auch an ihre Schwangerschaft, die ihr erst vor kurzem zur Gewissheit geworden war. Der Sohn, den sie einen Tag vor Ablauf des Jahres zur Welt brachte, sollte gemäß der Kipling’schen Familientradition Joseph heißen. Auf Drängen von Alices Schwester Louisa, der auserwählten Patentante, erhielt er den Zunamen Rudyard als Verweis auf den Ort, wo sich die Eltern kennengelernt hatten. Auch John Lockwood blickte bei seiner Ankunft auf dem Subkontinent verheißungsvoll in die Zukunft. Die eindrucksvolle Silhouette der großen indischen Hafenstadt erschien ihm wie ein architektonisches Versprechen auf Teilhabe. Er fieberte der neuen, auf drei Jahre befristeten Stelle an der Sir Jamsetjee Jeejeebhoy School of Art and Industry entgegen. Als Lehrer für angewandte Bildhauerkunst und Modellieren sollte er indische Studenten in den traditionellen Handwerkskünsten unterrichten und dabei englische Expertise und Akkuratesse einbringen. Gleichzeitig standen die Lernziele in ganz praktischer Beziehung zu der regen Bautätigkeit der Stadt. Unter Lockwoods Leitung arbeiteten seine Studenten an der Gestaltung des Victoria Terminus, des Royal Alfred Sailor’s Home und der Universität von Bombay mit. Dem inzwischen ausgewiesenen Zeichner und Gestalter dürfte die neue Aufgabe ebenso reizvoll erschienen sein wie die Aussicht auf 450 Pfund Jahresgehalt zuzüglich einiger Vergünstigungen in Form von freier Unterkunft und bezahlten Schiffspassagen. Dass er damit dennoch am unteren Ende der Hierarchie des anglo-indischen Beamtenapparates rangierte, schien dem romantisch gesinnten, von der Kunst besessenen Mann in den ersten Monaten seines Indienaufenthalts kaum zu stören. Nüchtern betrachtet, hatte er jedoch weder Aufstiegschancen oder einen verbrieften Pensionsanspruch, noch zählte er etwas in der politischen und sozialen Rangfolge Britisch-Indiens.
So sehr das Schicksal des Paares Widrigkeiten und Zufällen unterworfen war, so lässt sich doch auch etwas Allgemeingültiges jener Zeit darin erkennen. Das allmähliche Heraustreten aus den ursprünglichen religiösen Familienbanden und das Aufschließen zum Kreis der Eliten zeigen exemplarisch die Möglichkeiten einer neuartigen sozialen Mobilität, die das moderne viktorianische England gerade auch durch seine imperiale Selbstdefinition freigesetzt hatte. Insofern wird an der Entwicklung von einer nonkonformistischen Außenseiterstellung hin zur Mitwirkung in den staatstragenden Institutionen des Empire mehr ablesbar als die bloße Entscheidung über einen individuellen Lebensweg in Rudyard Kiplings Elternhaus.
Die Kiplings gelangten in ein Indien, das noch immer an den Wunden und dem Misstrauen krankte, die der Sepoy-Aufstand 1857/58 hinterlassen hatte. Die britische Seite spielte die Ausmaße dieses Aufstands gegen ihre koloniale Herrschaft als mutiny (Meuterei) herunter, die vornehmlich von muslimischen Sepoy-Soldaten angezettelt worden sei. Dabei hatten sich beträchtliche Teile der indischen Bevölkerung und ganze Fürstenstaaten der Rebellion angeschlossen. Im englischen Mutterland waren die von Indern begangenen wie auch die ihnen angedichteten Gräueltaten detailversessen kolportiert worden. Das war eher ungewöhnlich für den abwägenden viktorianischen Geist, diente jedoch der moralischen Rechtfertigung von Vergeltungsmaßnahmen und strikteren Herrschaftsmethoden vor Ort. Vorwürfe und Beispiele von Folter, Vergewaltigungen und Massakern an Frauen und Kindern ließen sich wirksam gegen ein barbarisches Indien ins Feld führen. Sie belasteten allerdings auch das Zusammenleben derer, die sich wenig später in dem komplizierten ethnischen und sozialen Gefüge Indiens erneut gegenüberstanden. Doch sieben Jahre nach den Ereignissen hatte sich auch manches verändert. Die Kiplings gelangten in eine Stadt, die einen rasanten Aufschwung zur kosmopolitischen Handelsmetropole Asiens erlebt hatte. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sprudelten die Einnahmen aus dem Handel mit Tee, Seide und Opium – vor allem mit China. Die jüngeren wirtschaftlichen Verheißungen gründeten sich auf die gewachsene Nachfrage nach Baumwolle. Die Hausse stand in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Verlauf des amerikanischen Sezessionskrieges und der von den Nordstaaten verhängten Handelsblockade gegen den Baumwolle produzierenden Süden. Durch den verstärkten Anbau in Indien versuchte das Empire der Knappheit zu begegnen. Das begehrte Rohmaterial wurde in den englischen Textilfabriken weiterverarbeitet und dann auf dem großen indischen Markt wieder verkauft. Den Import und Export wickelten die Händler vorrangig über Bombay ab. Auch politisch war die Handelsmetropole ein sicherer Hafen. Die dortigen indischen Hilfstruppen galten als loyal, standen sie doch während des Sepoy-Aufstands unter Befehlsgewalt der Ostindien-Kompanie fest an der Seite Englands.
Im August 1858 erfolgte ein weiterer Schritt zur Festigung der britischen Macht in Indien. Die Ostindien-Kompanie wurde nach über 250 Jahren Existenz und 100 Jahren direkter Herrschaft auf dem Subkontinent aufgelöst. Die Regierungsgewalt ging vollständig an die Britische Krone über. Ein Großteil Indiens wurde Kronkolonie. Die Bedeutung, die einer zentralisierten Indienpolitik nunmehr zukam, lässt sich an populären Büchern wie Sir John Robert Seeleys The Expansion of England (1883; dt. Die Ausdehnung Englands) ablesen. Der Cambridge-Professor verglich Indien mit den gewaltigen Imperien Roms und Napoleons, um es den Engländern verstehbar zu machen. Er ordnete British India in das historisch gewachsene Kolonialsystem ein, stellte es als Ausgleich für das verlorengegangene Amerika dar und wertete seine Aneignung durch England als einen gleichsam natürlichen Vorgang. Seeleys Idee der imperialistischen Ausbreitung Englands, die sich vom liberalen Fortschrittsdenken vor der mutiny absetzte, fand auch im kaiserlichen Deutschland Beachtung. Im Umfeld Wilhelms II. kannte und schätzte man den englischen Autor und sein Werk. Das Buch wurde nicht nur aus Sympathie für die Geschicke der verwandten Dynastie gelesen, sondern als Lehrstück mit vielfältigen Parallelen zu den eigenen politischen Ambitionen. Seeley stand in der kolonialen Tradition eines anglozentrischen Blicks auf Indien. Für die historischen und kulturellen Leistungen der anderen gab es da kaum Platz. Die zeitgleichen Studien des deutschen Oxford-Professors Friedrich Max Müller zeigten eine andere Sichtweise. Müller hatte sich intensiv mit der indischen Geschichte und Kultur beschäftigt und erkannte deren Reichtum. Der Sprach und Religionsforscher setzte sich für eine europäische Wertschätzung der alten Zivilisation ein. Auch John Lockwood Kipling war in Fragen der Kunst und Kultur eher ein Mann von diesem Schlag.
Die imperialistische Aufwertung Indiens als Großbritanniens Kronjuwel begründete dessen Vormachtstellung innerhalb des British Empire. Als größtes Imperium aller Zeiten wollte man auch in Fragen des Titels für die höchste Monarchin nicht hinter anderen zurückstehen. Die Krönung der englischen Königin Viktoria zur Kaiserin von Indien (Kaiser-i-Hind) am Neujahrstag des Jahres 1877 sollte es allenthalben sichtbar machen. Der Hindustani-Titel der englischen Königin in Indien verdankte sich den linguistischen Kenntnissen Gottlieb Wilhelm Leitners. Der englische Orientalist mit österreichischen Wurzeln war als weithin anerkannte Sprachkoryphäe in dieser Frage zuvor konsultiert worden. Während seiner Zeit in Lahore sollte Lockwood Kipling noch so manchen Strauß mit dem ihm unsympathischen Indienexperten auszufechten haben.
Im Sommer des Jahres 1876 kamen Lord Lytton, der seinerzeit amtierende Vizekönig von Indien, und Premierminister Benjamin Disraeli darin überein, das epochale Ereignis der Kaiserkrönung in Delhi mit einer grandiosen Imperial Assemblage zu feiern. Der Pomp sollte wohl auch ein wenig darüber hinwegtäuschen, dass die Königin selbst zum großen Ereignis gar nicht anreisen würde. Die Feierlichkeiten waren gedacht als ein »Spektakel von solchen Ausmaßen, das die Orientalen beeindruckt«, und sollten gleichzeitig eine Demonstration des »gezogenen Schwertes, dem wir eigentlich vertrauen« (zit. in: Allen: 89) sein. An diesem Punkt war auch Lockwood Kiplings Expertise gefragt. Ihm fiel die Aufgabe zu, Wappenbanner für die große Zeremonie im englischen Stil zu erstellen. Es galt, 63 Lokalfürsten – Maharadschas, Radschas und Nawabs – sowie den Vizekönig, den Commander-in-Chief und die fünf Gouverneure und Lieutenant-Gouverneure auszustatten. Banner aus bestickter chinesischer Seide mit Titeln und Wahlsprüchen in persischen Buchstaben mussten es sein. Neun Wochen arbeiteten Lockwood und Alice fieberhaft mit einem ganzen Stab von Schneidern in Lahore an dem Auftrag. Er brachte ihnen 500 Rupien ein, für Lockwood eine Silbermedaille sowie eine Einladung zur Zeremonie in Delhi, die beide aus der dritten Reihe miterleben durften. Was jedoch weit mehr zählte, war die wohlwollende Kenntnisnahme des Paares – vor allem von Alice – durch den höchsten Vertreter ihrer Majestät in Indien.
Vermutlich hatten sich die Kiplings vor ihrer Abreise nach Indien weder mit dem jüngeren historischen Geschehen noch mit den darüber entbrannten Debatten näher beschäftigt. Doch der Schock, den die Ereignisse des Sepoy-Aufstandes in England ausgelöst hatten, kann nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen sein. Die Diskussionen brandeten gerade auch in Alice Macdonalds intellektuell wachem und liberal gesinntem Bekannten- und Verwandtenkreis auf. Zu ihm gehörten der befreundete Cormell Price, die Maler Edward Burne-Jones, William Holman Hunt und Ford Madox Brown sowie die Schriftsteller und Dichter William Morris, Robert Brownig und Algernon Charles Swinburne und – nicht zu vergessen – der charismatische Bohemien Dante Gabriel Rossetti. Dessen Schwester Christina schrieb ein melodramatisches Gedicht über eine wahre Begebenheit in der Stadt Jhansi während der Unruhen des Jahres 1857, die sie natürlich nur vom Hörensagen kannte.
Lockwoods und Alices unumstößliche Entscheidung für Indien legt nahe, dass beide eher traditionellen Vorstellungen nachhingen. Darin erschien das riesige Land als ein geheimnisvolles Reich mit unvorstellbaren Schätzen, dessen Bewohner mehrheitlich sanft und friedfertig waren. Das Alltagsleben und die Kultur standen allerdings in dem Ruf, von primitivstem Aberglauben durchsetzt zu sein. Ein solches Bild hatte sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in England durch die Evangelisierungsbemühungen der Ostindien-Kompanie und die Petitionen des Evangelisten William Wilberforce verfestigt. Die liberal gemeinten Bildungsreformen, die der Politiker Thomas Babington Macaulay in Indien einführte, taten ein Übriges. Macaulay war der Meinung, dass ein einziges Regal einer gut ausgestatteten europäischen Bibliothek so viel wert sei wie die gesamte originäre Literatur Indiens und Arabiens. Dabei ging es dem indienerfahrenen Mitglied des obersten Rates der East India Company um den Fortschritt in einem als zutiefst rückständig wahrgenommenen Land – freilich in Gestalt der zivilisatorischen Mission Englands.
Neben derartigen Ideen, die gleichsam in der Luft lagen, lässt sich auch über die methodistischen Elternhäuser von Alice und Lockwood der Bezug zu einem traditionellen Indienverständnis herstellen. William Wilberforce, der manchen methodistischen Grundsätzen näher stand als der offiziellen Anglikanischen Kirche, hatte sich seit seiner inneren Bekehrung auch für die Christianisierung in Indien eingesetzt. Überzeugt von der Überlegenheit seines Glaubens über einen grausamen und lasterhaften Hinduismus mit solch abscheulichen Institutionen wie dem Kastenwesens und den abstoßenden Praktiken der Witwenverbrennung, der Polygamie und dem Kindermord, plädierte er für eine verstärkte Missionarsarbeit in Verantwortlichkeit der East India Company. Wilberforces Eifer und sein tief wurzelnder Konservatismus brachten ihm den Respekt vieler Methodisten ein. Sowohl bei den Kiplings als auch bei den Macdonalds war dieser Glaube Hausreligion.
Der Methodismus, der eng mit den Namen John Wesleys und dem seines jüngeren Bruders Charles verbunden ist, geht auf eine Gruppe junger Männer zurück, die sich einem frommen und asketischen Leben verschrieben hatten. Sie versammelten sich in Oxford um den charismatischen älteren Wesley, der dort als Prediger im Dienst der Anglikanischen Kirche stand. Wachsende Vorbehalte gegenüber dem Anglikanismus ließen ihn, der kurzzeitig auch Anhänger der Herrnhuter Brüdergemeinde war, mit der Methodist Church eine eigene religiöse Bewegung aufbauen, deren spirituelles Zentrum im protestantischen Ethos begründet lag. Alice Macdonalds Großvater James hatte sich noch unter dem direkten Einfluss des Methodisten-Vaters dem Glauben zugewandt. Gleiche strikte Grundsätze für Arm und Reich verhießen aus der Sicht eines hart arbeitenden Yorkshire-Bauern Gerechtigkeit im Diesseits und Hoffnung für das Jenseits. Noch in der Elterngeneration von Alice und Lockwood war der Methodismus gelebte Praxis: Reverend George Browne Macdonald und Reverend Joseph Kipling waren beide Methodistenpfarrer.
Alice und Lockwood Kipling hingegen hatten den strengen Methodismus ihrer Vorfahren weitgehend abgelegt. Von Alice wird berichtet, sie hätte einmal eine Locke von Wesleys Haaren mit der Bemerkung ins Feuer geworfen: »Das Haar von dem Hund, der uns gebissen hat.« (zit. in: Lycett 1999: 10) Daraus auf ihre völlige Abkehr von religiösen Fragen zu schließen, ginge allerdings zu weit. Die Kiplings waren wie viele Viktorianer – insbesondere viktorianische Anglo-Inder – leidenschaftslose Gläubige. Der Kirchgang blieb eher die Ausnahme als die Regel. Die respektvolle Distanzierung, die in religiösen Fragen im Hause Kipling herrschte, schloss aber nicht aus, dass in den Lebens- und Wertvorstellungen manche Grundsätze der einstigen Lehre ihren Nachhall fanden. Arbeitsethos und Selbstverantwortung waren die säkularen Restbestände, die mit einer Bestimmtheit gelebt wurden, die dem religiösen Eifer der Vorfahren in nichts nachstand. Auch daheim in England praktizierte man im Burne-Jones-Kreis die Kunst mit dem gleichen Eifer wie die vorhergehenden Generationen den Methodismus. Das entsprach einer weitverbreiteten spätviktorianischen Geisteshaltung, die danach trachtete, das schwindende Religionsinteresse durch eine gesteigerte Leidenschaft für die Künste zu kompensieren.
Wesley hatte das Evangelium der Arbeit unter strikter Ablehnung von Müßiggang und Frivolität als ernsthaften, religiös inspirierten Lebenssinn propagiert und meinte damit, dass sich Methodisten schwierigen Aufgaben stellen, harte Arbeit verrichten und sich aufopfern sollten. Christliche Tugenden wie Fleiß, Genügsamkeit und Ordnungsliebe sollten sich in Harmonie mit der vorgefundenen Gesellschaft entwickeln. Diese Haltung war weit mehr als ein notwendiges Paktieren mit dem weltlichen Übel. Auch Lockwood Kipling lebte und arbeitete in diesem Geiste. Das von John Ruskin propagierte Ideal der Handwerkskunst mit seiner Wertschätzung manueller Fertigkeiten und seiner Würdigung menschlicher Arbeit in Abgrenzung zur maschinellen Produktion galt ihm als Richtschnur. Durch Fleiß und Beharrlichkeit brachte er es auf seinem Gebiet bis zum künstlerischen Berater Königin Viktorias. Alice Kipling tat alles, um das Familienschiff aus eigener Kraft auf Kurs zu halten und voranzubringen. Durch ihre verweltlichten moralischen Grundsätze schimmert Wesleys Diktum vom Streben nach Glück hindurch. Ein vernünftiges und vor allem selbstbeherrschtes Leben schien ihr der Weg zur Erfüllung. Sie war aber auch ehrgeizig und umtriebig. Das Streben nach sozialem und finanziellem Erfolg – in der frühen Lehre sind sie von Gott gegeben – erwies sich als ein wesentlicher Beweggrund ihres Handelns. Nicht zuletzt waren die Kiplings in politischer Hinsicht dem methodistischen Erbe verpflichtet. Wesley als High Church Tory glaubte daran, die wachsenden sozialen Konflikte seiner Zeit überwinden zu können, indem er alle Menschen unterschiedslos denselben religiösen Verpflichtungen unterwarf. Streiks und andere kollektive Protestformen lehnte er als Manifestationen des Mobs kategorisch ab. Die damit einhergehenden Vorbehalte gegenüber demokratischer und liberaler Politik fielen auch in der Kipling-Familie auf fruchtbaren Boden.
Die ersten Monate in Bombay gestalteten sich für die Kiplings schwieriger als erwartet. Anstatt des erhofften komfortablen Bungalows mussten sie gemeinsam mit anderen Europäern in notdürftig hergerichteten Verschlägen auf Bombays Esplanade hausen. Wenig später erlebte die schwangere Alice erstmals die Hitzeperiode in Indien. Daran schloss sich im Juli die Regensaison an, die ihre Wohnstätte feucht und die Umgegend sumpfig werden ließ. Die Wohnsituation der Kiplings glich der von Flüchtlingen, war aber nur Teil eines größeren Dilemmas, das mit einem wirtschaftlichen Abschwung allerorten zutage trat. Die bis dahin blühende Handelsmetropole Bombay war ins Taumeln geraten. Der Preis für Baumwolle fiel unaufhaltsam, und mit ihm schwand die Spekulation auf weiteres ungehemmtes Wachstum. Der Umschwung verdankte sich der entscheidenden Wende im amerikanischen Bürgerkrieg, herbeigeführt durch die Kapitulation von General Lees Armee. Die angespannte Finanzlage Bombays bekamen die öffentlichen Einrichtungen – und insbesondere die mit den Künsten befassten – zuerst zu spüren. Zwar wurden ursprüngliche Planungen weitergeführt, doch fehlte der Schwung.
Trotz der sozialen Kontakte, die die Kiplings nach dem Bezug eines solideren eigenen Heims aufbauen konnten, und einer beginnenden Alltagsroutine wurden sie sich mehr und mehr ihrer bescheidenen Lage bewusst. Lockwoods Einkommen erlaubte es kaum, die laufenden Haushaltskosten zu decken. Zu Beginn des Jahres 1868 unterschrieb er einen zweiten Vertrag, der seine Lehrtätigkeit um weitere drei Jahre verlängerte. Von nun an war es ihm jedoch nicht mehr gestattet, Privatunterricht zu erteilen. Auch die künstlerischen Gestaltungsvorschläge, die er dem Public Works Department anbot, um ein wenig hinzuzuverdienen, wurden jetzt abgewiesen – nur um späterhin ohne Vergütung kopiert zu werden. In dieser Situation versuchte sich Lockwood als Reporter und Journalist. Im Frühjahr 1870 unternahm er eine längere Reise in die North-Western Provinces, um Skizzen von indischen Handwerkern bei der Arbeit anzufertigen. Bei dieser Gelegenheit traf er mit George Allen und Reverend Julian Robinson zusammen, den beiden Gründern des Pioneer, der führenden englischsprachigen Zeitung der Region mit Sitz in der Provinzhauptstadt Allahabad. Die Klientel der Zeitung war überwiegend englisch: Plantagenbesitzer, Händler, Geschäftsleute, Ingenieure sowie Beamte im Kolonial- und Militärdienst. Dementsprechend war die geistige Ausrichtung: anglozentrisch, konservativ, kolonial. Anders als später der Sohn, für den die Verbindung zum Pioneer zur weichenstellenden Lebensstation werden sollte, verstand der Vater seine Tätigkeit eher als Mittel zum Zweck. In diesem Sinne begann Lockwood Kipling, Zeitungsartikel über die gesellschaftlichen Ereignisse in Bombay für den Pioneer zu schreiben. Er berichtete von Bällen, Konzerten, Regatten, Club- und Theaterveranstaltungen – kurzum: von den Banalitäten des Alltagslebens der Anglo-Inder.
Als Anglo-Inder bezeichnete man zu Zeiten der Kiplings jene Engländer, die englischer Abstammung waren und Dienst in Indien versahen oder dort Geschäften nachgingen, sowie deren Kinder, die in Indien geboren waren oder dort aufwuchsen. Aus der Vermischung von Engländern und Indern hervorgegangene Nachkommen nannte man dagegen Eurasier. Verbindungen zwischen Engländern und Einheimischen, wie sie noch zu Zeiten der East India Company aufgrund des Frauenmangels nicht unüblich waren, wurden mit dem schrittweisen Eintreffen einer größeren Anzahl englischer Frauen zunehmend seltener. Nach den Ereignissen der mutiny waren sie verpönt, zum Teil sogar gesetzlich eingeschränkt.
John Lockwood Kiplings Ansichten über das zeitgenössische Indien gingen weitgehend konform mit den allgemeinen Vorurteilen. Er teilte die Geringschätzung der indischen Wissenschaft und Philosophie, die aus englischer Perspektive als wertlos, weil von Aberglauben durchdrungen, erachtet wurde. Eine generelle zivilisatorische Überlegenheit Großbritanniens stand auch für ihn außer Frage. Ob John Ruskins Gleichsetzung von hoher Kunst und hoher Moral, derzufolge die Inder nach den kolportierten Grausamkeiten der mutiny als unzivilisierte Barbaren erscheinen mussten, so auch von Lockwood Kipling mitgetragen wurde, ist eher fraglich. Er hatte über das Zeichnen, das Studium der Kunst und die handwerkliche Praxis einen artistischen Zugang zur indischen Kultur, und in seiner Lehrtätigkeit gewann er unmittelbaren Kontakt zu Einheimischen. Gleichwohl blieb er in vielen Fragen ein Kind seiner Zeit. In einem Brief an die Schwägerin Edith Macdonald vom 12. Dezember 1866 kommentierte Lockwood seine Beobachtungen:
Haus der Kiplings in Bombay
[…] ein Hindu nimmt eine eindeutige Sache aufs Korn & trifft oder verfehlt je nach Zufall, so dass keins der Ergebnisse ganz richtig erscheint – kein Steinquader ist winklig, kein Zaun gerade, keine Straße eben, kein Gericht schmeckt so, wie es sollte […] Man lebt wie in einem Traum, in dem die Dinge irgendwie passieren, aber niemals richtig geschehen. (zit. in: Allen: 38)
Lockwood Kiplings exzellente Kenntnisse der indischen Kunst und des Handwerks brachten ihm die Freundschaft mit dem Aristokraten Henry Rivett-Carnac ein. Henry hatte all das, was den Kiplings zur sozialen Anerkennung fehlte: einen berühmten Namen, einen langen Stammbaum mit Vorfahren im Dienste der East India Company sowie ausgezeichnete soziale Verbindungen. Die Skandalgeschichten, die die weitverzweigte Familie erschütterten, setzten erst später ein. Traditionsgemäß bekleidete Rivett-Carnac exponierte Posten in der Hierarchie des Civil Service. Schon als junger Mann war er Cotton Commissioner für die Central Provinces. Seine eigentliche Leidenschaft galt jedoch der Archäologie. Sein größter Stolz war eine Sammlung indischer Kunstschätze mit einer berühmten Kollektion von Münzen. Die Kiplings schätzte er als ein umgängliches, humorvolles Paar, das sich durch sehr gute Landeskenntnisse, vor allem auf den Gebieten der Religion und Kunst, auszeichnete. Das Kompliment kann als ein Beleg für Lockwoods unermüdlichen Bildungshunger gewertet werden. Seit der Zeit in Kensington zog sich diese Konstante durch das Leben des Selfmademans. Und auch Alice wurde offensichtlich von einem Bildungsehrgeiz angespornt. Die gesellschaftlichen Kontakte, die der Familienfreund und Förderer Rivett-Carnac vermittelte, waren für den weiteren sozialen Aufstieg der Kiplings von existenzieller Bedeutung. Sie halfen den Neuankömmlingen mehr als einmal über schwierige Phasen hinweg, brachten sie mit der lokalen Elite Bombays zusammen und sorgten schließlich dafür, dass Lockwood und Alice nicht mehr durch die Maschen des anglo-indischen Netzwerks hindurchfielen.
Die Anstrengungen und Sorgen der Eltern fechten Joseph Rudyard Kipling, der seit Beginn des Jahres 1866 als Ruddy die kleine Welt der Kiplings bereichert, wenig an. Der Junge ist glücklich mit seiner Ayah, einem Kindermädchen aus Mangalore, einem Ort an der Malabar-Küste südlich von Bombay. Sein Boy Meeta, den Kipling in der Erinnerung als großen Surti-Diener mit einem rot-goldenen Turban beschreibt, erfüllt ihm jeden Wunsch. Beide Bedienstete erzählen Märchen und Geschichten; manchmal spielen sie diese sogar vor. Zwei Jahre später wird Rudyards Schwester Alice geboren. Die vertraute Dienerschaft bringt den Kipling-Kindern Urdu bei, das ihnen als Geheimsprache dient. Kiplings frühe Prägung durch eine der ältesten mündlichen Erzähltraditionen der Welt wirkt in seinen späteren Geschichten nach und trägt zu jenem universellen Gestus bei, der so typisch für sein Schreiben wird. Die Kinderfrau und der persönliche Diener sind das emotionale Zentrum in Ruddys früher Kindheit. Noch als 70-Jähriger erinnert er sich in der Selbstdarstellung seines Lebens zuerst an diese beiden Personen:
Mein erster Eindruck ist der vom Erwachen des Tages, von Licht, von Farbe und von goldenen und purpurnen Früchten in der Höhe meiner Schulter. Er ist die Erinnerung an frühe Morgenspaziergänge auf den Obstmarkt von Bombay mit meiner Ayah und später mit meiner Schwester in ihrem Kinderwagen und an unsere Rückkehr mit unseren auf seinem Bug hoch aufgestapelten Einkäufen. Unsere Ayah war eine römisch-katholische Portugiesin, welche – und ich an ihrer Seite – an jedem am Wege stehenden Kreuz betete. Meeta, mein Hindudiener, ging zuweilen in kleine Hindutempel, wo ich, noch zu jung einer Kaste anzugehören, seine Hand hielt und auf die nur undeutlich erkennbaren freundlichen Götter schaute. (SOM: 33)
In Indien war es Brauch, die Dienerschaft nach ihren jeweiligen Funktionen zu benennen. Der eigentliche Name von Kiplings Kinderfrau war Mary – ein unübersehbarer Hinweis auf ihre Verbundenheit mit dem römisch-katholischen Glauben, der in Indien insbesondere von der portugiesischen Kolonie Goa ausging. Auch in Bombay lebte traditionsgemäß eine starke Bevölkerungsgruppe dieser Konfession. Da das Goa-Christentum im Verlauf seiner 450-jährigen Geschichte von hinduistischen Praktiken durchdrungen und überlagert wurde, liegt es nahe, dass auch Kiplings Ayah diese Mischkultur verkörperte und weitergab. Mary war eine erfahrene Kinderfrau, die nach den Kiplings noch anderen europäischen Familien in Bombay diente, wie späterhin ihre Tochter auch. Ruddys Meeta war, wie an seinem Namen erkennbar, ein Angehöriger der niedrigsten Hindu-Kaste, der sich bestenfalls als Straßenkehrer verdingen durfte. Üblicherweise waren es Muslime, die als Träger und Diener arbeiteten. Vermutlich zwang der schmale Geldbeutel die Kiplings zu diesem Verstoß gegen die Konventionen.
Rudyards Eltern waren entweder zu beschäftigt oder zu unerfahren in kolonialen Angelegenheiten, als dass sie der engen und innigen Beziehung ihrer Kinder zu Einheimischen Einhalt geboten hätten. Sie störten sich nicht daran, dass ihre Kinder eine seltsame Mischung von hinduistischen und katholischen Glaubensgrundsätzen von der Dienerschaft aufschnappten. Das Leben in Indien hatte ihren inneren Abstand zur religiösen Praxis weiter vergrößert, denn im Allgemeinen nahmen die Anglo-Inder das Christentum eher von der leichten Seite. Vielleicht spielte aber auch ein wenig Reue mit hinein, denn die Eltern meinten, ihren Kindern etwas vorzuenthalten, das für andere englische Kinder daheim selbstverständlich war: jenes England im Original, jenes Lebensmuster, das zwar nachgeahmt werden konnte, aber durch keinen Club und keine Zeitung im ganzen Empire zu ersetzen war. Und so herrschte im Hause Kipling eine gewisse Großzügigkeit in Glaubensfragen, Verhaltensweisen und Normen, die für englische Kinder daheim wiederum kaum denkbar gewesen wäre. Ruddys frühe Eskapaden und kleine Respektlosigkeiten sind daher nicht nur aus dem ungestümen Temperament des Jungen zu erklären. Zum Entsetzen der Familie in England fährt der Knirps während seines ersten Besuchs im Mutterland wie ein indischer Monsunsturm durch die wohlsituierte Welt der Verwandtschaft. Zum ersten Mal seit dem Aufbruch nach Indien hatte Alice Kipling am 10. März 1868 wieder heimatlichen Boden betreten. Der Aufenthalt in England dauerte bis Anfang November. Das Verhalten ihres Sohnes bei Tante Georgiana und Onkel Ned wie auch bei ihren Eltern in Worcestershire brachte sie wiederholt in Verlegenheit. Als der nicht einmal dreijährige Ruddy das Haus seiner Großeltern mit dem vom Tod gezeichneten Großvater George in Bewdley inspiziert, bemerkt er kritisch, dass diese das beste Zimmer für sich selbst genommen hätten. All das forderte Alice nicht wenig Beschwichtigung und Energie ab. Dabei musste sie doch all ihre Kraft für die bevorstehende Entbindung von Ruddys Schwester sammeln. Die Tochter wurde am 11. Juni 1868 geboren und erhielt denselben Namen wie ihre Mutter, doch alle nannten sie schon bald nur Trix.
Ob dieser England-Besuch ausschlaggebend dafür war, dass sich die Kiplings später für eine zeitweilige Trennung von den Kindern entschieden, bleibt Spekulation. Es war nichts Ungewöhnliches, wenn Staatsdiener in den Weiten des Empire ihre Kinder zur Ausbildung ins Mutterland zurückschickten, um ihnen englische Tugenden anerziehen zu lassen und einem ungewollten Einleben in die fremde Kultur, jenem gefürchteten going native, entgegenzuwirken. Im Fall der Kiplings überraschen jedoch die Umstände. Alice beließ die beiden Kinder zusammen. Doch anstatt sie bei der zahlreichen und wohl auch aufnahmewilligen Verwandtschaft einzuquartieren, wie es naheliegend und üblich gewesen wäre, antwortete sie auf eine Zeitungsannonce. So kam es, dass ein unbekanntes älteres Paar mit einem 12-jährigen Sohn in Southsea ab Dezember 1871 als Ersatzfamilie für die Kipling-Kinder ausgewählt wurde. Was genau die Kiplings zu diesem Schritt bewog, hat immer wieder Anlass zu Spekulationen gegeben. Von den Gründen, die sich anführen ließen, erscheinen zwei besonders stichhaltig: Zum einen dauerte der Wettbewerb innerhalb der Macdonald-Familie an – wenigstens mit den Zweigen, mit denen sich Alice verglich. Zum anderen war die Zeit in England nicht stehengeblieben, und die Zustände und Entwicklungen innerhalb der Verwandtschaft entsprachen nicht in jedem Fall dem, was die kurzzeitige Heimkehrerin 1868 gerne vorgefunden hätte.
Es waren sechs Jahre seit dem Beginn des Indien-Abenteuers vergangen, als die Kiplings erstmals wieder gemeinsam englischen Boden betraten. Das Jahr zuvor hatte sich schicksalhaft gestaltet: Im April 1870 hatte Alice nur wenige Tage nach der Geburt ihr drittes Kind, einen Jungen namens John, verloren. Die Angst um die Gesundheit war für die Kiplings zum ständigen Begleiter des Lebens in Indien geworden, und der Tod des Babys schürte sie einmal mehr. Tödliche Krankheiten wie Typhus waren in den großen indischen Städten an der Tagesordnung. Nur wenige Monate zuvor waren Lockwood, Ruddy und Trix während ihres ersten Sommeraufenthalts in der heiligen Hindu-Pilgerstätte Nassik an Wechselfieber erkrankt. Das Fieber war vergleichsweise harmlos und konnte mit Abführmitteln und Chinin bekämpft werden, denen zur besseren Bekömmlichkeit für die Kinder Honig und Marmelade beigemengt wurden. Kaum waren sie wieder nach Bombay zurückgekehrt, wurde Rudyard von einem Keuchhusten geplagt. Die tagtägliche Sorge um den Gesundheitszustand der Kinder war mehr als das Zünglein an der Waage, sie im sicheren Heimatland aufwachsen zu lassen.
Lockwood und Alice standen inzwischen in der Mitte ihres vierten Lebensjahrzehnts und stießen an Grenzen. Beruflich und sozial war ihnen der Durchbruch in Indien nicht gelungen. Lockwoods Karriere kam nicht voran, weshalb er im Frühjahr 1871 aus Mangel an Alternativen eine weitere Verlängerung seines Vertrags mit der Sir Jamsetjee Jeejeebhoy School of Art unterzeichnete. Zwar war die Familie gewachsen, doch stellte sich damit die Frage nach dem »Wie weiter?«. Auch daheim war die englische Verwandtschaft gewachsen, mehr noch, sie prosperierte. Die Burne-Jones hatten nach ihrem Erstling Philip inzwischen ein zweites Kind bekommen. Es hieß Margaret und wurde später Rudyards vertraute Korrespondentin. Nachwuchs hatte sich auch bei den Baldwins mit Sohn Stanley und bei den Poynters mit Sohn Ambrose eingestellt. Der Vater des Letzteren, der Maler Edward Poynter, hatte 1866 Alices sechs Jahre jüngere Schwester Agnes geheiratet. Nach dem Erfolg seines ersten historischen Gemäldes Israel in Egypt (1867) hatte er in der Royal Academy fest Fuß gefasst und war nunmehr mit dem zweiten Monumentalgemälde The Visit oft the Queen of Sheba to King Salomon (1871–75) befasst, das ihn auf Jahre beschäftigen sollte. Was mochte Lockwood mit seinen erstklassigen Kenntnissen orientalischer Kulturen von dem akademisch reüssierenden Schwager gehalten haben? Die Debatte um die Authentizität des Dargestellten, die sich an Poynters idealisierendem Malstil entzündet hatte, war dem Experten selbst im fernen Indien nicht entgangen. Doch der Schwager in England bekam nicht nur einträgliche Auftragswerke, sondern auch den Posten eines ersten Professors an der Slade School of Fine Arts als Ausdruck der öffentlichen Anerkennung. Er sollte ihn bis 1875 bekleiden.
Edward Burne-Jones bewohnte mit seiner Familie inzwischen ein repräsentatives frühgeorgianisches Haus mit großem Garten im Londoner Stadtteil Fulham. Der charismatische Maler war zu einer umstrittenen Berühmtheit avanciert. In Familienkreisen wurde das Anwesen The Grange genannt, und die Kipling-Kinder verbrachten manche selige Stunde dort. Erfolg zeigte sich also allerorten. Aber gerade in dem Künstlerhaushalt der Burne-Jones gab es etwas, das aus der Perspektive der Kiplings, namentlich Alices, eine Gefahr darstellte. Burne-Jones durchlebte seit Ende der 1860er-Jahre eine schwierige Zeit, in der er nicht ausstellte. Wiederholt wurde er in der Presse angegriffen. Gleichzeitig hatte er mit seinem exotischen griechischen Modell Maria Zambaco eine leidenschaftliche Affäre, die erst mit einem verhinderten Selbstmordversuch beider ihr Ende fand. Als geborene Cassavetti entstammte Maria einer prominenten anglo-griechischen Händlerfamilie, die Burne-Jones’ künstlerisches Schaffen großzügig unterstützt hatte. Die gekränkte Georgiana fühlte sich in der Dramatik der Ereignisse zu dem ansonsten blutarmen William Morris hingezogen, dessen Frau Jane wiederum in Dante Gabriel Rossetti verliebt war. Alle Paare blieben dennoch zusammen. Die gesellschaftlichen Zwänge der viktorianischen Gesellschaft und selbst auferlegte Moralnormen waren noch intakt, zumindest dem äußerlichen Anschein nach. Das amouröse Imbroglio im Hause Burne-Jones mag Alice Kipling während ihres dortigen Sommeraufenthalts verstört haben. Die Streitereien um ein Aktbild mit dem Kopf von Burne-Jones’ Geliebter wirkten nach. Der Meister zog sich im September nach Italien zurück; Georgiana ging mit ihren zwei Kindern zu Louisa Baldwin nach Worcestershire. Dort war weder Platz für weitere Kinder, noch wollte Alice ihren eigenen den Makel eines ländlichen Dialekts mit auf den Weg ins Leben geben. Auf Lockwoods Seite wiederum schien es trotz seiner fünf Geschwister noch weniger Möglichkeiten zu geben, zumal die verwitwete Mutter Frances auf die siebzig zuging. Außerdem war da der Stolz als Erstgeborener, der sein Glück in der Welt versucht hatte. Vor diesem Hintergrund und angesichts der unaufschiebbaren Rückkehr nach Indien wird der Entschluss der Kiplings verständlicher. Im Oktober 1871 war es dann entschieden, dass die Kinder allein bei der Ersatzfamilie in Southsea bleiben sollten. Die emotionalen Härten, die mit der über fünf Jahre währenden Trennung für alle Beteiligten verbunden sein würden, wogen aus der damaligen Perspektive noch nicht so schwer.
Captain P. A. Holloway, ein Marineoffizier in Rente, und seine Frau gehörten zu jenen Bewohnern der englischen Südküste, die ihre geringen Alterseinkünfte durch die Aufnahme von Pflegekindern ein wenig aufstocken wollten. Zu ihrem Haushalt gehörte ein später Sohn namens Harry, fünf oder sechs Jahre älter als Rudyard. Harrys behäbige Auffassungsgabe ging Hand in Hand mit einer unkontrollierten Neigung zu körperlicher Gewalt. Der Haushalt der Holloways wurde nach strengen evangelischen Grundsätzen geführt. Dieses Regiment sollte sich nach dem Tod des alten gutmütigen Kapitäns noch verschärfen. Alice und Lockwood Kipling stellten das ältere Paar gemäß anglo-indischer Gepflogenheit den Kindern als Tante Rosa und Onkel Harry vor.
Die Ausgangslage für die geplante Langzeitpflege der Kipling-Kinder war denkbar schlecht. Der Abschied von den Eltern am 1. Oktober des Jahres 1871 verlief kühl. Lockwoods sechsmonatige Freistellung neigte sich dem Ende entgegen, und gemeinsam mit Alice war er bereits im Aufbruch nach Indien begriffen. Sie hatten die Kinder in nichts auf den abrupten Wechsel vorbereitet. Der sechsjährige Ruddy durchlebt eine gewaltige Umstellung. Seine Sinne kämpfen noch mit dem Umschwung vom sonnendurchfluteten Indien zum trüben England. Nunmehr schlägt seine gesamte Weltsicht von einem Licht- in ein Schattenbild um. Vormals ein freies, verwöhntes und bisweilen despotisch über die Dienerschaft herrschendes Kind, ist er jetzt ein zu bedingungslosem Gehorsam verurteilter Zögling. Ob Mrs. Holloway gegen die charakterlichen Eigenheiten und anglo-indischen Freiheiten des Jungen aus religiöser Berufung vorging, ob ihr ein sadistischer Zug eigen war oder beides, sei dahingestellt. Es lief auf dasselbe hinaus: Ruddy stürzt aus einem orientalischen Paradies in eine Hölle voller Schrecken, die der evangelischen Eiferin als notwendiges Gegengift gegen die Verderbnis auf Erden galt. Die Schwester Trix ist noch zu klein, um das ganze Ausmaß dieser Veränderungen zu begreifen, doch Ruddy spürt und erfasst, gefühlsmäßig wie auch geistig, die Ungeheuerlichkeit dessen, was die Eltern den Kindern angetan haben. Dennoch liebt er sie auch weiterhin über alles. Die Bedeutung des Familienkreises kommt ihm erst hier in der kalten Fremde voll zu Bewusstsein – nicht zuletzt deshalb, weil er von der Mutter mit einem Verantwortungsbewusstsein für seine jüngere Schwester geimpft worden ist. Trix wiederum steht ihm bei und tröstet ihn, so gut sie es in ihrem Alter vermag. Ruddys kindlicher Zorn richtet sich daher zuerst gegen die Mutter, die er aus den Wirren dieses psychologischen Dilemmas heraus bestrafen will. Er hat seine Sicht auf die traumatischen Jahre in Lorne Lodge zeitlebens nicht geändert. Noch in seinen Erinnerungen nennt er den Ort »Haus der Trostlosigkeit« (SOM: 37). In der autobiographischen Kurzgeschichte »Bäh-bäh Schwarzes Schaf« aus dem Jahr 1888 erinnert er sich der Erniedrigung und ständigen körperlichen Züchtigung mit aller ihm zu Gebote stehenden Dramatik:
Das schwarze Schaf überschlug die Kosten. Nur eine große Tracht Prügel wird es geben, und dann wird sie mir eine Tafel mit der Aufschrift ›Lügner‹ auf den Rücken heften, wie sie es schon getan hat. Harry wird mich verhauen und für mich beten und sie wird mich in ihre Gebete einschließen und mir sagen, ich sei ein Kind des Teufels, und mir Psalmen zu lernen aufgeben. (MWK 193)
Die Erzählung ist ein Konstrukt mit lebensweltlicher Wechselwirkung. Aus der Lebenserfahrung ins Literarische übertragen, hat sie wieder prägend auf Kiplings Selbstrechtfertigung zurückgewirkt. Die Apotheose der wiedergefundenen, reuevollen Mutter – literarisch auf mehreren Seiten der Kurzgeschichte ausgebreitet – ist ein beredtes Beispiel dafür. Dahinter steht eine Lebenspraxis, die sich Rudyard Kipling frühzeitig zu eigen gemacht hat: ein Sich-Hineinversetzen in die Fiktion mit einer Unbedingtheit und Rückhaltlosigkeit, die alle Widrigkeiten des Lebens vergessen macht und gleichzeitig die Trennlinie zwischen Realem und Herbeigewünschtem verwischen lässt. Ein derartiges Verständnis teilt Kipling auch mit anderen Schriftstellern und Künstlern. Doch nur wenige konnten es so effektvoll und präzise wie er in ihrem literarischen Schaffen umsetzen, um damit Millionen von Lesern zu überzeugen und zu begeistern.
Ob der junge Ruddy, der als verzogen und vorlaut galt, in Lorne Lodge tatsächlich in dem Maße gelitten hat, wie er es in der Geschichte beschreibt, oder ob es sich nicht doch um eine Einbildung als Folge der harten fünfeinhalbjährigen Trennung handelt, ist von zahlreichen Biographen unterschiedlich bewertet worden. Rudyards Schwester hat die vermeintliche Qual anscheinend besser überstanden. Neben den Schikanen und manchen Schlägen gibt es in jenen Jahren aber auch Gewinn. Ruddy lernt lesen und schreiben und entdeckt das Reich der Bücher für sich. Er vertieft sein Wissen über die Bibel und übt sich im Gebrauch des evangelischen Idioms – allerdings anders, als es die gottesfürchtige Mrs. Holloway gerne gesehen hätte. Doch schließlich erleidet der empfindsame Junge einen gesundheitlichen Zusammenbruch. Die dramatische Verschlechterung seiner Sehfähigkeit, die erst bei einem Besuch von Tante Georgiana festgestellt wird, ist der Auslöser. Die Ursachen liegen in der Überlagerung schwerwiegender psychologischer Probleme. Eins davon ist der kindliche Wunsch nach Bestrafung der Eltern für deren Abwesenheit. Alice Kipling, von ihrer Schwester durch einen Brief alarmiert, reagiert sofort. Sie reist umgehend nach England und verschafft sich vor Ort einen Überblick über die Situation. Ruddy wird einem Augenarzt vorgestellt, bekommt eine Brille mit extrastarken Gläsern verschrieben und beendet sein Zöglingsdasein in Southsea. Im März 1877 darf er nach fünf Jahren und drei Monaten Martyrium zusammen mit seiner Schwester und seinem Cousin Stanley auf einem Bauernhof nahe Loughton in Epping Forest einen wunderbaren Frühling verleben. Das Herumtollen und Ponyreiten dauert bis in den Sommer hinein. Alice Kipling, die sich zu dieser Form von emotionaler Wiedergutmachung entschlossen hatte, bewertet die Vorgänge auf Lorne Lodge jedoch anders als ihr phantasiebegabter Sohn, denn während Rudyard in die Kadettenschule Westward Ho! aufrückt, bleibt Trix noch weitere Jahre in der Obhut der Witwe in Southsea.
Rudyard Kipling als Junge
Westward Ho! ist eine kleine, im Jahr 1863 gegründete Gemeinde, die nach dem gleichnamigen historischen Abenteuerroman von Charles Kingsley benannt wurde. Der Kirchenmann und Erfolgsautor schrieb Mitte der 1850er-Jahre eine karibische Piratengeschichte, die ihren Ausgang im nahe gelegenen Bideford nimmt. Damit machte er die dem Meer zugewandte Region im Norden Devons weithin bekannt. Ruddy zählt den Romancier zu seinen Lieblingsschriftstellern und hat zweifellos auch diesen populären Roman gelesen, in dem die Engländer zu Zeiten von Königin Elisabeth I. über die Spanier triumphierten. Das 1874 im gleichen Ort gegründete United Services College hätte kaum einen passenderen Namensgeber finden können, denn Kingsley stillte nicht nur das Verlangen junger Leser nach Abenteuer und Fernweh. In seinem späteren Leben bekannte er sich kompromisslos zu einer imperialistischen Traditionslinie. Aus der Sicht von Kiplings Eltern, die durch eine Anzeige im Pioneer auf die neue Institution aufmerksam geworden waren, hatte die Schule gleich mehrere Vorteile. Sie war, wie der Ort mit dem eigenwilligen Namen, eine Neugründung und somit modernen Maximen insofern aufgeschlossen, als hier ein weniger rigider Klassengeist herrschte, als er für England ansonsten typisch war. Kiplings spätere Lobpreisung der Anstalt als eine Schule, die ihrer Zeit voraus gewesen sei, ist allerdings romantisiert.
Das United Services College stand den Kindern von Militärangehörigen und Beamten des britischen Kolonialdienstes offen, die sich keine der renommierten Privatschulen leisten konnten. Sein Auftrag bestand in der Nachwuchsgewinnung für das British Empire und dementsprechend war der vorherrschende Geist. Die etwa 200 eingeschriebenen Schüler stritten um Gehorsam und eine strikte Rangfolge. Raufereien waren an der Tagesordnung. Der alles entscheidende Vorteil des Colleges aus Sicht der Kiplings lag in der Person des Direktors Cormell Price. Er war ein guter Freund der Macdonald-Familie. Gemeinsam mit Ned Burne-Jones und Henry Macdonald hatte er die Schulbank der King Edward VI Grammar School in Birmingham gedrückt. Die Kontakte wurden auch späterhin in London gepflegt, wenngleich Price im Unterschied zu den Freunden nach dem Studium die Arztlaufbahn gewählt hatte. Er erwies sich dafür schon bald als gänzlich ungeeignet, da er die Atmosphäre des Operationssaals nicht vertragen konnte. Froh, zu Beginn der 1860er-Jahre auf eine Stelle als Tutor nach Russland entkommen zu sein, kehrte er nach nur knapp vier Jahren wieder zurück, um am Haileybury College eine Anstellung als Master anzunehmen. Haileybury war in seinen Anfängen eine Ausbildungseinrichtung der East India Company und blieb auch späterhin mit Britisch-Indien verbunden. 1874 wechselte Price als Direktor zum neugründeten United Services College, wohin er auch eine kleine Gruppe ehemaliger Schüler mitnahm. Die Wahl eines geistig offenen und humanistisch gebildeten Nonkonformisten an die Spitze einer derartigen Anstalt war überraschend, standen doch Prices politische Positionen in einem gewissen Gegensatz zur erklärten Erziehungsaufgabe. Doch der neue Direktor schaffte den Spagat. Seine Maxime, die Jungen als Individuen zu behandeln, kommt auch dem jungen Kipling zugute, der im Januar 1878 in das College aufgenommen wird. In diesem Punkt handelte Alice Kipling diesmal nicht im Alleingang, sondern vertraute neben dem anglo-indischen Netzwerk auch ihren Familienkontakten.
Als Freund der Bücher kann sich Rudyard der Aufmerksamkeit des Direktors sicher sein. Die pazifistischen Ansichten des Lehrers, der auf Distanz zu einem schrillen Imperialismus ging, lassen den Jungen einstweilen unberührt. Seine wachsenden Privilegien begründen sich weniger auf Alice Kiplings stilles Wirken im Hintergrund, sondern auf eine wahre Sympathie zwischen Lehrer und Schüler. Wie nötig das war, zeigen Ruddys frühe Briefe, in denen er die Eltern darum bittet, das College sobald wie möglich wieder verlassen zu dürfen. Seit der Zeit in Lorne Lodge muss Ruddy eine Brille mit extrem dicken Linsen tragen, womit er sich den Spitznamen »Gigger« einhandelt. Der geht auf den englischen Begriff giglamp zurück, was Scheinwerfer bedeutet. Da er im Sport und bei den obligatorischen Wettkämpfen mit den anderen nicht mithalten kann – oder will –, versenkt er sich am liebsten in die Bücher. Das waren beste Voraussetzungen, um schnell zum Außenseiter zu werden. Kiplings doppelte Verklärung dieser Zeit aus der Perspektive der 15 Jahre später verfassten Collegegeschichten sowie seiner autobiographischen Lebenserinnerungen feiert sowohl die Notwendigkeit des rigiden Regimes, dem die Jungen unterworfen werden, als auch die Notwendigkeit, sich über dessen Regeln hinwegsetzen zu können. Nur so ist sein Credo von der kollektiven Gebundenheit des Einzelnen als Voraussetzung seiner schöpferischen Selbstverwirklichung zu verstehen. Der Kreis, in dem das geschehen kann, ist bei Kipling immer ein Kreis von Auserwählten. Am Ende der Schulzeit sind die Kadetten dazu geworden: »Ein Kreis von hochherzigen Knaben, wie man sich ihn nicht besser wünschen kann […] Ein wenig unmoralisch zwar, aber: Jungens sind Jungens!« (Staaks und Genossen: 167)
Während der Zeit am United Services College befindet sich der junge Kipling im Auge des Tornados von zwei widerstreitenden Denkrichtungen, die ihn umtosen. Die imperialistische Doktrin stimmt auf den Dienst im Empire ein, das liberale Denken bestimmt die künstlerischästhetische Traditionslinie seiner Verwandtschaft. Eine Zeit lang scheint es, als würde Letztere den Ausschlag für Kiplings weiteren Weg geben. Vieles von dem, was der von seinen Eltern getrennte zwölfjährige Junge in England bewundert, findet er im intellektuellen Zirkel seiner Tante Georgiana und seines Onkels Ned. In deren Haus The Grange verlebt er einen Großteil seiner Ferientage. Die Ausgelassenheit und Lebensfreude, die ihn dort umwehen, machen die Trennung von den im fernen Indien lebenden Eltern erträglich und lassen die in calvinistischer Strenge verbrachten Jahre in Lorne Lodge schnell verblassen.
Der Einfluss, den der liberal und sozialistisch gesinnte Künstlerkreis auf Rudyard Kipling ausübt, gehört zu den frühen prägenden Momenten. Derart angeregt, gestaltet er sogar sein Zimmer in Westward Ho! im Stil des Arts and Crafts Movement, jener künstlerisch-handwerklichen Bewegung im spätviktorianischen Großbritannien, von der so starke Impulse für die dekorative Formgebung ausgingen. Im Haus seines berühmten Onkels Ned Burne-Jones wird er mit den Ideen und Werken von Thomas Carlyle, Ralph Waldo Emerson, John Ruskin, Gabriel Dante Rossetti, Robert Browning, Algernon Charles Swinburne und vor allem William Morris, dem verehrten Uncle Topsy, vertraut. Deren Bilder vor Augen und deren Texte im Ohr, stellt der Junge erste eigene poetische Versuche an, die im familiären Kreis Gehör und Ermutigung finden. Gemeinsam mit den Kindern von Burne-Jones und Morris verfasst er kleinere Texte und Verse für den Scribbler, einer handgeschriebenen Familienzeitung, die Morris’ Tochter Jenny herausgibt.
Neben dem Verwandtenkreis dürfen die aus der Ferne wirkenden Leitbilder, die Kipling in der Person des Vaters und der Mutter hat, nicht unerwähnt bleiben. Sie schreiben regelmäßig und schicken Bücher. Vermutlich wirken sie bisweilen auch als Korrektiv zu den allzu liberal gesinnten und moralisch freizügigen Bohemiens in England. Zwischen der englischen Verwandtschaft und den Eltern in Indien herrscht ungeachtet der geographischen Distanz ein intensiver Gedankenaustausch. Auch nach Rudyards Rückkehr nach Indien im Jahre 1882 findet der rege Briefwechsel seine Fortsetzung. Das engere und weitere verwandtschaftliche Umfeld hätte den jungen Rudyard künstlerisch wie auch politisch eigentlich in eine andere Richtung lenken müssen, als er sie späterhin einschlägt. Jedoch erweisen sich die lebenspraktischen Einflüsse, die seine Vita wie auch sein Schaffen in Indien dominieren, letztlich als stärker. Kiplings erstes zaghaftes Aufbegehren nimmt sich daher eher das liberale Künstlermilieu seiner berühmten Verwandtschaft zum Ziel als den rauen, aber verheißungsvollen Gegenentwurf des Empire. Die am United Services College neu entdeckte Gruppenidentität von Gleichgesinnten, die gleichsam natürlich dem kolonialen Milieu entstammten, wirken ebenso als Gegengewicht wie der allgemeine Geist der Einrichtung.
Die intellektuelle Prägung, die der junge Kipling durch Cormell Price und William Carr Crofts, seinem Lehrer für Englisch und Alte Sprachen, am United Services College erfährt, reicht über ein Heranführen an die englische Literatur von Shakespeare bis zur Gegenwart und das Vertiefen der ästhetischen und philosophischen Ideale der Präraffaeliten hinaus. Price war ein sensibler und kultivierter Viktorianer, der ebenso in der englischen wie in der russischen, deutschen und französischen Literatur und Kultur belesen und beschlagen war. Er bereitete den jungen Kipling zielgerichtet auf eine literarische Karriere vor. Im Juni 1881 betraut er den ehrgeizigen Literaten mit der Wiederbelebung des USC Chronicle, einer sechsseitigen Collegezeitschrift. Rudyard wird Herausgeber, Organisator, Beiträger und Notnagel in einer Person – kurz: Hansdampf in allen Gassen. So gewinnt er Geschmack am journalistischen Arbeiten. Er lernt frühzeitig die ganz praktischen Verbindungen zwischen Literatur und Journalismus kennen und macht sich so mit einem Berufsprofil vertraut, das typisch war für viele zeitgenössische, vornehmlich amerikanische Autoren.
In seiner Kadettenzeit liest der junge Kipling neben der Pflichtlektüre des Collegekanons neugierig kreuz und quer. Er darf die Bibliothek im Studierzimmer des ihm wohlgesonnenen headmaster nach Belieben nutzen. Das kindliche Lesevergnügen, das er in Lorne Lodge als Refugium entdeckt hatte, baut er nunmehr zur Parallelwelt aus. Er lebt im Zauberreich der Direktorenbibliothek:
Da standen Bände und Bände alter Dramatiker. Da standen die Reisebeschreibungen Hukluyds; französische Übersetzungen russischer Autoren, wie Puschkin und Lermontoff; da waren berauschende und erregende kleine Erzählungen mit eingestreuten merkwürdigen Liedern – Peacock war der Autor; da standen Borrows »Lavengro«; dann ein wunderliches Ding, das eine Übersetzung zu sein schien und »Rubaiyat« überschrieben war und von dem der Direktor sagte, dass es noch lange nicht genug gewürdigt sei. Da standen hunderte Bände Lyrik: Crashaw, Dryden, Alexander Smith, Lydia Sigourney, Fletscher und die purpurne Insel, Donne, Marlows »Faust« und Miltons »Verlorenes Paradies« […] Da standen »Atalanta in Calydon« und Rosetti, um nur einiges aufzuzählen. (Staaks und Genossen: 146)
Unter Anleitung Crofts wendet sich der begabte Junge Horaz, den Romantikern und großen literarischen Namen seiner Zeit zu, darunter Thomas Babington Macaulay, Charles Kingsley, Walter Scott und Matthew Arnold. Naheliegend, dass er auch die ›Hausfreunde‹ wie Morris und die beiden Rossettis liest. Allerdings lässt die Collegegesinnung die Ästheten zugunsten von Robert Browning und Alfred Lord Tennyson schrittweise in den Hintergrund treten. Amerikaner spielen in Kiplings Lektüre eine wichtige Rolle. Er schult seinen Stil an den Werken von Edgar Allen Poe, Henry Wadsworth Longfellow, Charles Leland, Joel Chandler Harris und Bret Harte. Rudyard liest nicht nur, er imitiert, parodiert und reift an den Vorlagen. Er kennt keine Berührungsängste zwischen Klassischem und Populären, was ihm gelegentlich Kritik und Spott einbringt, ihn aber zu einem ausgesprochen modernen Dichter und Autor macht. Kiplings Unbekümmertheit in ästhetischen Fragen führt in der Folgezeit immer wieder zu Extremurteilen, in denen sein Schreiben als bloßes Handwerk abgetan wird. Seine fortgesetzten Lese- und Schreibversuche werden von den Collegemitstreitern zumeist mit Unverständnis und Argwohn betrachtet. Doch er kann und will nicht bedingungslos oder unbedarft dazugehören. Westward Ho! vermittelt Kipling aber auch Attitüden von Englishness, die das Erbe seiner freien und zügellosen Kindheit zurückstutzen. In seine Gedichte fließt jetzt eine gehörige Portion Patriotismus ein. Und er verinnerlicht die Bedeutung von Regeln – was aber nicht heißt, dass es ihm damit auch immer ernst ist. In seinen Geschichten sind gerade diejenigen erfolgreich und bewundert, die sich auch über starre Regeln hinwegsetzen können. In der Lehrerschaft sind jene geachtet, die potenziellen Übeltätern zu verstehen geben, dass ihnen keine Übertretung entgeht, und die doch auf allzu kleinliches Maßregeln verzichten.
Das Jahr, in dem Rudyard seine Studien am United Services College beginnt, hält für ihn eine weitere wichtige Erfahrung bereit. Im Frühjahr 1878 trifft der Vater Lockwood in England ein. Er ist in den Genuss einer längeren Freistellung gekommen, um den Aufbau der Arts-and-Crafts-Ausstellung im indischen Pavillon der Pariser Weltausstellung zu beaufsichtigen. Im Sommer nimmt der Vater den Sohn mit nach Paris. Auf dem Marsfeld präsentierte sich ein Frankreich, das sich schnell von der Niederlage im Preußisch-Französischen Krieg erholt hatte. Das noch junge Deutsche Kaiserreich war nicht auf der Ausstellung vertreten. Rudyard bestaunt eine Eismaschine, elektrisches Licht und den kolossalen Kopf von Bartholdis Freiheitsstatue, deren Körper erst später vollendet werden wird. Während des Aufenthalts sind dem zwölfeinhalbjährigen Jungen kaum Grenzen gesetzt. Er kann nach Belieben auf Erkundung gehen. Einmal mehr profitiert er von Lockwoods freizügigem Erziehungsstil, der auch später in Lahore seine Fortsetzung findet. Der Aufenthalt auf der Weltausstellung legt den Keim für Rudyard Kiplings lebenslange Liebe zu Frankreich. Nachdem die Einflusssphären zwischen den beiden Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien einvernehmlich abgesteckt worden sind, gewinnt das Nachbarland für Kipling den Status eines Verbündeten. Er folgt damit einem gängigen Muster seiner Zeit. Je größer die Sympathie für Frankreich, desto mehr geht er auf Distanz zum preußischen Deutschen Reich. Frankreich wird schon bald zu Kiplings bevorzugtem Reiseland. Viele Aufenthalte bis ins hohe Alter hinein sollen der frühen Paris-Erfahrung noch folgen.
Was taten die Eltern in den Jahren der Abwesenheit ihrer Kinder? Das entscheidende Ereignis war der Umzug von Bombay nach Lahore im Jahr 1875, wo John Lockwood Kipling eine Doppelfunktion als Rektor der neu eingerichteten Mayo School of Industrial Art und Museumskurator des Lahore Museum übernehmen sollte. Bombay, das er zum Ende seines Vertrags im März verlassen hatte, bot ihm keine Alternative mehr. Die Karriere stagnierte und die praktische Lehrtätigkeit an der Sir Jamsetjee Jeejeebhoy School of Art war zum Erliegen gekommen. Die neuartige Doppelverpflichtung, die sich einmal mehr den Verbindungen Rivett-Carnacs verdankte, entsprach viel eher seiner Natur. Lockwood zögerte keine Minute und verließ Bombay so schnell, dass es Alice allein überlassen blieb, den Hausrat zu packen und ihm später nachzureisen. Schon im April arbeitete er sich in die neuen Aufgabengebiete ein. Er fand auch ein neues Domizil für die Familie. Es war ein großer Bungalow im Punjabi-Stil mit 14 Zimmern. Alice empfand das Haus anfangs als ungemütlich und überdimensioniert. Doch die Kiplings lebten sich ein und nannten ihr neues Heim fortan das Bikaner House. Geographisch hatten sie sich von der kosmopolitisch geprägten Hafenstadt Bombay in die North-Western Provinces bewegt. Das brachte auch eine Veränderung im gesellschaftlichen Status mit sich, denn sie waren nunmehr zum Herzen Britisch-Indiens vorgestoßen. Allein das schien wie eine Bestätigung ihrer Zugehörigkeit nach Jahren einer letztlich doch beliebigen Randexistenz.
Die Kämpfe der Vergangenheit forderten aber auch ihren Tribut. John Lockwood versenkte sich immer tiefer in seine Arbeit, und Alice gab sich immer öfter depressiven Anwandlungen hin. Die Abwesenheit der Kinder war ein Grund, doch bisweilen flammte der Unmut über das widerspenstige Indien auf, und der Zweifel, ob man tatsächlich am richtigen Platze sei, nagte nach wie vor an ihr. Im Eheleben gewann eine freundschaftlich-distanzierte Routine die Oberhand. Gleich ihrem Mann, suchte auch Alice nach neuen Betätigungsfeldern. Eins davon war die Literatur. Sie ermunterte nicht nur Lockwood zu derartigen Arbeiten; sie wusste auch die aufkeimende literarische Begabung ihres Sohnes – anfangs gegen dessen Willen und Wissen – in die entsprechenden Bahnen zu lenken. Im Dezember 1881 ließ sie in Lahore 50 Exemplare eines Gedichtbändchens unter dem Titel Schoolboy Lyrics auf eigene Kosten drucken. Alice hatte darin 23 Gedichte Rudyards zusammengetragen. Einige waren ihr als Briefbeigabe zugeschickt worden, andere hatte sie sich von der Verwandtschaft kopieren lassen. Sie verschickte die kleinen Bändchen beflissen an ausgewählte Persönlichkeiten, bis hin zu Englands führendem Poeten Algernon Charles Swinburne. Allerdings hielt sich die Nachfrage in Grenzen, denn beim Weggang von Kiplings Eltern aus Indien waren später noch stapelweise Exemplare vorhanden. Rudyard erfährt erst bei seiner Rückkehr nach Indien von all dem. Er ist verärgert über die Eigenmächtigkeit der Mutter und zweifelt an der Qualität der gedruckten Verse. Die Gedichte sind respektlose Stilübungen und Parodien, in denen Zynismus und eine Außenseiterperspektive vorherrschen.
Die Kiplings taten auch weiterhin, was sich in ihrer Situation gebot: Sie knüpften Kontakte. Das Umfeld des Pioneer sollte sich dabei als besonders wichtig erweisen. Lockwood und Alice wollten ihren Sohn heimholen und sahen ihn als künftigen Journalisten. Aufschlussreich, dass dieser von dem Vorhaben wieder nur als Letzter erfährt und eigentlich ganz andere Pläne für seine Zukunft hegt. Rudyard denkt an London und träumt von einer journalistischen Laufbahn in der Hauptstadt; auch ein Jahr in Deutschland als Tutor erscheint ihm nicht abwegig. Doch am meisten zählt für ihn seine informelle Verlobung mit einem Mädchen namens Florence Violet Garrard. Der 14-jährige Rudyard hatte das zwei oder drei Jahre ältere Mädchen gelegentlich eines Besuches bei seiner Schwester Trix im Haus von Mrs. Holloway im Sommer 1880 kennengelernt. Flo war ein weiterer Schützling in Lorne Lodge. Rudyard hatte sich auf der Stelle in das Mädchen mit den grauen Augen, langen Haaren und der elfenbeinfarbenen Haut verliebt. Schwester Trix beschrieb sie später als eine verkleidete Prinzessin in der Schäferhütte. Die angebetete Flo wich Rudyards Werben jedoch aus, und die romantischen Gefühle des jungen Liebenden blieben trotz wiederholter Anläufe unerwidert.
Angesichts der kaum hoffnungsvollen Situation lebt Rudyard seine Leidenschaft in Versen und Gedichten aus. Lockwood Kipling wird von einem dieser Liebesgedichte seines Sohnes aufgeschreckt. Ein Brief, in dem ihm Heiratsabsichten mitgeteilt werden, alarmiert ihn aufs Äußerste. Mit einer gepfefferten Antwort schiebt er das Kartenhaus seines Sohns beiseite. Die Kiplings haben in den zurückliegenden Jahren ihre Lektion gelernt und geben ihre Erfahrungen an Rudyard weiter: Herzenssachen haben im unerbittlichen Gerangel um gesellschaftlichen Aufstieg keinen Platz oder bestenfalls in der hinteren Reihe. Obwohl ihm Flo Garrard nicht so schnell wieder aus dem Kopf geht, verinnerlicht Rudyard die Rangfolge für den Rest seines Lebens.