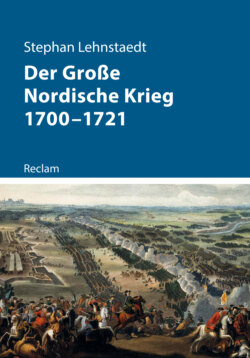Читать книгу Der Große Nordische Krieg 1700–1721 - Stephan Lehnstaedt - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die schwedische Armee
ОглавлениеBevor Russland überhaupt die ersten Soldaten ins Feld geführt hatte, war Dänemark als Bündnispartner schon aus dem Krieg ausgeschieden. Karl XII.Karl XII., König von Schweden hatte energisch gehandelt und sowohl die Einsatzbereitschaft als auch die Fähigkeiten seiner Armee eindrucksvoll gezeigt. Immer wieder sollte er in den kommenden Jahren beweisen, dass die Ostsee für ihn kein Hindernis darstellte, sondern ganz im Gegenteil schnelle Truppenverlegungen ermöglichte. Diese Mobilität war auch deshalb vonnöten, weil die schwedische Armee mit insgesamt gut 61 000 Mann gar nicht so groß war. Das hatte sie schon im 17. Jahrhundert daran gehindert, in Polen größere Gebiete zu besetzen. Im Großen Nordischen Krieg bedeutete es letztendlich, dass KarlKarl XII., König von Schweden zwar in der Lage war, jedem Gegner einzeln gegenüberzutreten: AugustAugust, Kurfürst von Sachsen, als August II. König von Polen kommandierte 26 000 Sachsen und bis zu 24 000 Polen; Russland hatte anfangs im Westen etwa 30 000 Soldaten, Dänemark oder Brandenburg je etwas über 20 000 Mann. Aber Schweden konnte die gegnerischen Armeen nicht gleichzeitig, sondern höchstens nacheinander schlagen. Folglich stellte nicht die geografische Ausdehnung seines Reiches KarlsKarl XII., König von Schweden eigentliches Problem dar, sondern die Vielzahl seiner Feinde.
Ein Großteil der schwedischen Truppe wurde durch Konskription rekrutiert, das heißt von den einzelnen Landesteilen gestellt; bezahlte Söldner waren in der Unterzahl. Schwedischer Artillerist, Grenadier und Dragoner, um 1700. Farblithographie von Richard Knötel, Ende des 19. Jahrhunderts
Bedeutsamer als die Truppenstärke aber waren allemal deren Schlagkraft und Einsatzfähigkeit. Das hatte Schweden in den zurückliegenden Jahrzehnten mehr als einmal bewiesen, doch die Zeitgenossen schätzten die Armee trotzdem nicht: Die europäischen Fürstenhäuser setzten auf Berufssoldaten und Söldner, aber gerade die konnte sich das [25]vergleichsweise arme Agrarland Schweden – ähnlich wie Russland – nur in sehr begrenztem Maße leisten. Lediglich 12 000 Söldner dienten in KarlsKarl XII., König von Schweden Heer, meist als Besatzung der Festungen im Baltikum und in [26]Pommern. Der Großteil seiner Truppe wurde durch Konskription rekrutiert. Die Schweden sprachen vom Einteilungswerk (indelningsverket) und meinten damit ein System, das die Regionen des Landes zur Stellung von je einem Regiment von etwa tausend Mann verpflichtete.
Karl XI.Karl XI., König von Schweden (1655–1697) reformierte die Organisation des schwedischen Militärsystems. Gemälde von David Klöcker Ehrenstrahl, 1676
Diese Organisation ging wesentlich auf Karl XI.Karl XI., König von Schweden zurück, der damit die Kosten für die Staatskasse gering halten wollte: Die Entlohnung der Soldaten oblag den Provinzen, die sich wiederum in Roten gliederten – je zwei oder drei Güter mussten einen Mann versorgen, ihm ein bescheidenes Haus und Land für den Ackerbau zur Verfügung stellen; sie waren [27]auch für Ersatz verantwortlich, falls der Rekrut fiel oder als Invalide zurückkehrte. Diese Art Garnisonsdienst war für die Monarchie also äußerst billig. Mit einem durchaus modernen Ansatz erlaubte man außerdem die Heirat der Soldaten. Das sollte ihre Moral heben, sie an Heimat und Familie binden und im Verbund mit den Kameraden aus der Umgebung der Desertion vorbeugen, die in den meisten Armeen der Zeit ein großes Problem war. In Verbindung mit der konfessionellen Homogenität und dem gelebten protestantischen Glauben erzeugte dieses System einen Zusammenhalt in der Truppe, der seinesgleichen suchte.
Tatsächlich trug das Einteilungswerk sogar zum gesellschaftlichen Frieden bei. Einerseits gefiel es den Adligen, denn ihr Besitz war davon ausgenommen, Soldaten zu stellen; die Kavallerie wurde lediglich auf den Krongütern rekrutiert, und die Einziehung und Verstaatlichung zahlreicher Lehen machte diese Waffengattung ziemlich schlagkräftig. Andererseits waren auch die Bauern nicht unzufrieden, denn sie durften Ersatzleute stellen und sich so vom Kriegsdienst freikaufen. Dienen mussten also vor allem Ärmere, aber sie erhielten so nicht nur ein Auskommen für sich und ihre Familie, sondern hatten überdies Teil am sozialen Prestige des Militärs. Die Bevölkerung gerade des hohen Nordens und des finnischen Reichsteils, dessen Landwirtschaft wenig ertragreich war, profitierte daher vom Einteilungswerk.
Schweden konnte auf diese Weise sechs Kavallerie- und 16 Infanterieregimenter für den Feldzug gegen Sachsen und Russland mobilisieren, Finnland zusätzlich drei der Kavallerie und acht der Infanterie. Ein Regiment bestand aus je zwei Bataillonen mit vier Kompanien von jeweils etwa 125 Mann, also zusammen 1000. Außerdem verfügte Karl XII.Karl XII., König von Schweden über ein Garderegiment, dessen drei Bataillone jeweils sechs statt vier Kompanien umfassten. Die restliche Armee war vor allem in Festungen stationiert. Bei der Invasion Dänemarks hatte sich dies als höchst effizientes System erwiesen, das eine schnelle Reaktion auf äußere Bedrohungen erlaubte. Es war für die Verteidigung und die kurzfristige Abwehr von Angreifern gedacht, nicht aber für ausgedehnte Feldzüge – im Unterschied zu den stehenden Heeren anderer europäischer Fürsten, deren Unterhalt stets anfiel und die deshalb sehr wohl dafür eingesetzt werden konnten und auch wurden.
Der über zwanzig Jahre dauernde Große Nordische Krieg deckte aber auch Schwächen der schwedischen Rekrutierungspraxis auf. Durch [28]Konskriptionsraten von zehn Prozent blutete das Land regelrecht aus, zumal immer neue Einberufungen stattfanden, um die stetig steigenden Verluste auszugleichen. Der Sollbestand des Heeres erhöhte sich zeitweise auf bis zu 115 000 Mann, was fünf Prozent der Bevölkerung entsprach. Es ist kaum überraschend, dass die Staatskasse nicht in der Lage war, so viele Menschen über einen längeren Zeitraum zu besolden – das Einteilungswerk war geschaffen worden, um einem territorial gesättigten, nicht expandierenden Staat in Friedenszeiten ein großes Heer mit niedrigen Ausgaben zu ermöglichen. Wenn sie zum Einsatz kam, musste die Truppe ganz wesentlich aus den Einkünften der besetzten Territorien bezahlt werden. Karl XII.Karl XII., König von Schweden forderte deshalb nachdrücklich Kontributionen ein und ließ im Staatsauftrag plündern.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt unterschied das schwedische Militär von dem seiner Gegner: Es war für Schlachten ausgelegt, die der Gegenseite maximalen Schaden zufügten, um so ein schnelles Ende des Krieges zu erzwingen. Im Optimalfall, so wie in Dänemark, reichte die Androhung des Gewaltpotenzials bereits aus. Andernfalls setzten KarlKarl XII., König von Schweden und seine Offiziere die Männer ohne Rücksicht auf eigene Verluste ein: Gefallene mussten nicht auf Kosten der schwedischen Staatskasse ersetzt werden, sondern von den Regionen und Gutsbesitzern. In Verbindung mit der hohen Moral und dem Zusammenhalt der Soldaten lag in dieser Radikalität eine entscheidende Ursache für die schwedischen Erfolge in der ersten Hälfte des Großen Nordischen Krieges.
Der aggressiven strategischen Ausrichtung, der auch die vielen Kavallerieregimenter dienten, entsprach die Bewaffnung der Soldaten. Sie unterschied sich in wesentlichen Dingen von der anderer europäischer Armeen: Jeder Infanterist führte ein Schwert mit sich, das er im Angriff nutzte. Es war den ansonsten üblichen Musketen mit ihren Bajonetten im Nahkampf überlegen und passte hervorragend zu einer Taktik, die Verluste in Kauf nahm, um entscheidende Siege erringen zu können: Anstatt auf Feuergefechte setzten KarlKarl XII., König von Schweden und seine Generale auf das direkte Aufeinandertreffen der Soldaten.
Die Blankwaffe spielte im Kampf eine herausragende Rolle. Kolorierte Kreidelithographie mit dem Titel Karl XII. Karl XII., König von Schwedenvon Schweden stürmt die dänische Küste, 1832
Ganz ähnlich sah es bei der Kavallerie aus. In Europa war der letzte taktische Schrei im Kampf mit anderen berittenen Einheiten das Karakolieren – die Männer stürmten mit ihren Pferden auf die gegnerischen Reiter zu, feuerten aus kurzer Entfernung ihre Pistolen und drehten dann ab. Wurde das Manöver von gut ausgebildeten Kavalleristen [30]ausgeführt, bot sich ein eindrucksvolles Schauspiel, das aber vergleichsweise wenig durchschlagkräftig war, schlicht weil die damaligen Pistolen selbst aus geringer Distanz – zumal wenn vom Pferderücken aus geschossen wurde – wenig Schaden anrichteten. KarlKarl XII., König von Schweden verringerte während des Krieges die Zahl seiner derart ausgestatteten Kürassiere deutlich. Stattdessen bevorzugte er Dragoner, die anstelle von Pistolen Musketen mit sich führten; zum Schießen mussten sie allerdings absitzen, sodass sie eher als eine Art berittene Infanterie dienten. Außerdem verzichteten die Schweden auf das Karakolieren und setzten auf den Angriff mit der Blankwaffe, der auf beiden Seiten zu deutlich höheren Verlusten führte.
Zu diesem Vorgehen passte der weitgehende Verzicht auf Artillerie. Die damaligen Kanonen mit relativ geringer Reichweite bei hohem Gewicht waren für den schnellen Vormarsch auf einem Schlachtfeld nicht geeignet und wurden von KarlKarl XII., König von Schweden daher kaum eingesetzt. Deshalb warb er Kanoniere als Söldner an und nutzte schwere Geschütze hauptsächlich bei Belagerungen. Dieser waffentechnische Pragmatismus setzte sich bei der Infanterie fort: In den Kompanien trug üblicherweise ein Drittel der Männer Piken – weniger für den Nahkampf als zur Abwehr von Kavallerieangriffen. Zum Austausch vieler veralteter Luntenschlossmusketen kam es erst im Laufe des Krieges, als mit diesen bereits eindrucksvolle Siege eingefahren worden waren. Pikanterweise ließ KarlKarl XII., König von Schweden 1703 auf der Leipziger Messe moderne Steinschlossmusketen im sächsischen Suhl ordern – sehr zum Ärger AugustsAugust, Kurfürst von Sachsen, als August II. König von Polen, dessen eigene Aufträge von seinen geschäftstüchtigen Untertanen einfach zurückgestellt wurden; freilich ließ er immer wieder Lieferungen für seinen Kriegsgegner beschlagnahmen.
Nicht zuletzt verweigerten sich die Schweden den mitteleuropäischen Konventionen hinsichtlich ihrer Uniformen, die so gar nicht der Barockmode entsprachen. Aber die blauen Wollmäntel mit gelbem Futter und Kupferknöpfen waren nicht nur kostengünstig und wenig prunkvoll, sondern vor allem warm und im Norden dementsprechend nützlich – genau wie die Zipfelmützen, die meist anstelle schicker Dreispitze auf den Köpfen saßen.
All dies entsprang weniger der Ablehnung der aktuellen Konventionen als vielmehr der nüchternen Einsicht in die eigenen Stärken und Schwächen. Und die Schweden nahmen die jüngsten militärischen [31]Entwicklungen auf dem Kontinent durchaus wahr: Zwar erfreute sich das Land seit 1679 weitgehend friedlicher Zeiten, aber gerade deshalb waren die Offiziere gezwungen, ihr Geld im Ausland zu verdienen und dort Erfahrungen zu sammeln. Der spätere Feldmarschall Carl Gustav RehnskiöldRehnskiöld, Carl Gustav (1651-1722) etwa diente in der niederländischen Armee – und kehrte wie viele seiner Kollegen bei Kriegsbeginn 1700 in die Heimat zurück: Wie die Soldaten selbst war auch das schwedische Offizierskorps loyal und homogen.