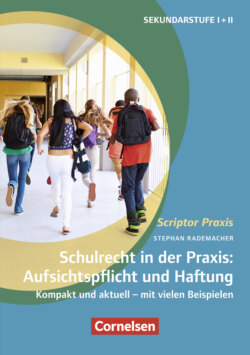Читать книгу Schulrecht in der Praxis: Aufsichtspflicht und Haftung - Stephan Rademacher - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinleitung
Empfinden Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei dem Gedanken an die schulische Aufsichtspflicht ein gewisses Unbehagen? Haben Sie das Gefühl, dass die Inhalte dieser doch so wichtigen Dienstpflicht recht konturlos und wenig greifbar sind?
Dann sind Sie nicht allein! Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sind unsicher darüber, wie sie sich in verschiedenen Situationen des Schulalltags verhalten müssen, um ihre Aufsichtspflicht zu erfüllen. Sie meinen häufig, den strengen Vorgaben der Gerichte ohnehin nicht nachkommen zu können, weshalb sie glauben, regelmäßig mit „einem Bein im Gefängnis“ zu stehen.
Worauf ist diese Unsicherheit zurückzuführen? Zum einen sicherlich darauf, dass die einzelnen Bundesländer die Inhalte der Aufsichtspflicht nur ansatzweise durch Rechtsvorschriften konkretisiert haben. So beschränkt sich z. B. der bremische Schulgesetzgeber darauf, in § 8 Abs. 1 der Lehrerdienstordnung auf die Aufsichtspflicht hinzuweisen: „In Wahrnehmung ihrer Fürsorgepflicht üben die Lehrerinnen und Lehrer die Aufsicht über die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler aus.“ Verwaltungsvorschriften, die das genauere „Wie“ der Aufsichtsführung regeln, finden sich dagegen kaum. Zum anderen – und das ist gewissermaßen der Hintergrund für die nur spärlich vorhandenen Rechtsvorschriften – werden Inhalt und Umfang der Aufsichtspflicht vor allem durch Gerichtsentscheidungen konkretisiert („case law“). Die Richter treffen am Einzelfall orientierte Entscheidungen, für die dann jeweils geprüft werden muss, inwieweit sie sich auf andere Bereiche übertragen lassen.
Das Hauptanliegen dieses Buches ist es, Ihnen das Unbehagen vor der schulischen Aufsichtspflicht weitgehend zu nehmen. Die Rechtsprechung stellt für die Beantwortung der Frage, ob eine Lehrkraft ihrer Aufsichtspflicht genügt hat, weitgehend darauf ab, wie sich Eltern in einer vergleichbaren Situation hätten verhalten müssen. Insoweit verlangen die Gerichte von den Lehrkräften also nichts Unmögliches, sondern sie fordern im Grunde nur das, was ohnehin von einer vernünftigen Aufsichtsperson zu erwarten ist. Welche Handlungen das genau sind, soll im weiteren Verlauf an zahlreichen Beispielen verdeutlicht werden.
Die folgenden Ausführungen teilen sich in vier Kapitel, zwei größere (Grundlagen der schulischen Aufsichtspflicht und die Aufsichtsbereiche) sowie zwei kürzere, die sich mit den möglichen Rechtsfolgen einer Aufsichtspflichtverletzung befassen und auf die Besonderheiten von Erste-Hilfe-Maßnahmen für Lehrkräfte eingehen.
„Lehrer haften für ihre Schüler!“ – aber nicht immer!
Wir kennen die etwas einschüchternden gelben Schilder vor Baustellen und fremden Grundstücken: „Betreten verboten. Eltern haften für ihre Kinder!“ So unmissverständlich sie in ihrer Formulierung sein mögen, so rechtlich unzutreffend sind sie auch – und zwar sowohl für den Bereich der elterlichen Haftung als auch für die Haftung der Lehrkräfte im Schulalltag! Der Grund dafür besteht darin, dass die Schilder im Hinblick auf die Haftungsfolgen einen Automatismus suggerieren, den es aus rechtlicher Sicht so gar nicht gibt:
Aber nur wenn sie gegen ihre Aufsichtspflicht verstoßen!© Shutterstock/hanohiki
Zunächst einmal können Eltern oder andere aufsichtspflichtige Personen im Falle eines Schadenseintritts immer nur dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie gegenüber dem zu beaufsichtigenden Kind diejenige Sorgfaltspflicht außer Acht gelassen haben, die man von einer verständigen Aufsichtsperson in der konkreten Situation erwartet hätte. Haben sie sich hingegen genau so verhalten, wie man es von verständigen Aufsichtspflichtigen verlangen würde, und kommt es dann trotzdem zu einem Personen- oder Vermögensschaden, so können sie dafür nicht haftbar gemacht werden. Mit anderen Worten: Wir dürfen nicht die „Schere im Kopf“ haben, dass mit einem Schadenseintritt automatisch auch eine Haftungsfolge zulasten des Aufsichtspflichtigen verbunden ist.
Zugegeben: Das ist nicht so einfach, und insbesondere wir Lehrkräfte tun uns damit hinreichend schwer. Wenn es zu einem Schaden kommt, mag das gerade im Falle eines Personenschadens wie Körperverletzung oder gar Tötung ungeheuer belastend und mit erheblichem Leid verbunden sein – und trotzdem muss die aufsichtspflichtige Person nur dann dafür einstehen, wenn ihr auch ein Vorwurf gemacht werden kann.
Die ersten beiden Kapitel dieses Buches widmen sich daher genau der Frage, wann dem Aufsichtspflichtigen ein solcher Vorwurf gemacht werden kann, weil eine unrechtmäßige Aufsichtsführung vorliegt. Dazu wird in Kapitel 1 zunächst ausführlich auf allgemeine Grundlagen zur Aufsichtsführung eingegangen, bevor dann in Kapitel 2 wichtige Aufsichtsbereiche aus dem Schulalltag im Vordergrund stehen.
Darüber hinaus gibt es aber auch keinen Automatismus dergestalt, dass jede unzureichende Aufsichtsführung immer auch zu einer Haftung führt. Hat z. B. eine Lehrkraft ihre Pausenaufsicht nachweislich nicht angemessen geführt und wurde währenddessen ein Auto durch einen Steinwurf vom Schulhof aus beschädigt, muss das nicht unbedingt mit haftungsrechtlichen Konsequenzen verbunden sein.
Im Rahmen der rechtlichen Prüfung sind nämlich vorab noch weitere wichtige Fragen bzw. Tatbestandsvoraussetzungen zu klären, bevor endgültig über eine Haftung für den eingetretenen Schaden entschieden werden kann. Dazu gehört unter anderem die Frage, ob der Schaden auch eingetreten wäre, wenn die Aufsichtsführung durch die Lehrkraft rechtmäßig erfolgt wäre – juristisch ausgedrückt geht es um die Frage nach der Kausalität der mangelhaften Aufsichtshandlug für den eingetretenen Schaden.
Käme in unserem kleinen Beispielsfall eine Richterin oder ein Gutachter zu dem Ergebnis, dass das fremde Auto auch dann beschädigt worden wäre, wenn die Lehrkraft in unmittelbarer Nähe zu dem Steine werfenden Schüler gestanden hätte, weil sie ihn nämlich aufgrund der Schnelligkeit der körperlichen Bewegungen ohnehin nicht hätte aufhalten können, dann fehlt es aus rechtlicher Sicht an der erforderlichen Kausalität. Denn warum sollte eine unzureichende Aufsichtsführung zu einer Haftung für einen Schaden führen, wenn dieser doch auch bei einer rechtmäßigen Aufsichtsführung eingetreten wäre? Auf diese und weitere Fragen wird im vorletzten Kapitel näher eingegangen (vgl. dazu insbesondere Abschnitt 3.1).
Schließlich ist von großer Bedeutung, dass sich Ansprüche einer verletzten Person nur selten gegen die Lehrkraft persönlich richten, denn entweder findet eine Haftungsüberleitung auf die Gesetzliche (Schüler-)Unfallversicherung statt oder die Anstellungskörperschaft (bei Beamten) bzw. der Arbeitgeber (bei Beschäftigten) leistet im Wege der sog. Amtshaftung. Einzelheiten dazu finden Sie ebenfalls im dritten Kapitel dieses Buches (vgl. Abschnitt 3.3).
Die vorgenannten Feststellungen sollen Sie nun nicht dazu verführen, das Thema Aufsichtspflicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil Sie für sich nun zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Ihnen im Falle einer unzureichenden Aufsichtsführung kaum etwas passieren kann. Das wäre gewiss nicht meine Intention gewesen! Vielmehr habe ich versucht aufzuzeigen, dass das Thema „Aufsichtspflicht“ zu keiner Hysterie in unserem Schulalltag führen darf und dass sich Kolleginnen und Kollegen im Falle der Verletzung einer Schülerin bzw. eines Schülers nicht sofort eine Schuld daran geben dürfen. Gleichwohl sollte es unser eigener Anspruch sein, dieser so wichtigen Dienstpflicht in unserem Berufsalltag so gut es uns möglich ist nachzukommen!