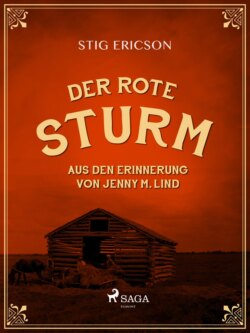Читать книгу Der Rote Sturm: aus den Erinnerung von Jenny M. Lind - Stig Ericson - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Indianerbaum
ОглавлениеViele Gemeinden haben ihre besonders gefährlichen und unheimlichen Orte, wo es angeblich in bestimmten Nächten spukt, wo die Eule bei Vollmond dreimal hintereinander ruft.
Diese Orte haben oft etwas mit Gewalt und Blut und Tod zu tun.
Auch die kleine Siedlergemeinde am Bluewater kam zu einem solchen Ort. Er lag am Fluß, drei oder vier Meilen nach Osten.
Da stand eine riesige, verwachsene Baumwollpappel, deren knorrige Zweige und rissige Rinde die Spuren von vielen Jahrzehnten von Stürmen und Grasbränden trugen. Der Baum wuchs so nah am Fluß, daß die klauenähnlichen Wurzeln bis ins Wasser reichten.
Eines Tages hing da ein Mensch, ein junger Indianer.
Es geschah an einem klaren, sonnigen Herbsttag, ein paar Tage, bevor ich zehn Jahre alt wurde. Ich verstand zuerst gar nicht, was geschehen war.
Ich sah, wie Menschen mit gesenktem Kopf vorüberritten, und als eine der Nachbarsfrauen in die Küche kam, begrüßte sie mich nicht, und Mutter schickte mich hinaus, ehe sie miteinander sprachen. Es lag etwas in der Luft, etwas Schreckliches und Beängstigendes, und hinterher war Mutter ganz anders als sonst. Sie hatte Angst im Gesicht, obwohl Vater nicht zu Hause war. Ich konnte keinen Augenkontakt mit ihr bekommen.
Und ich fragte mich natürlich, was wohl passiert war.
„Laß mich in Ruhe“, zischte sie, wenn ich sie fragte.
„Aber Mutter, Liebe...“
Sie schlug nach mir.
„Ach Kind. Häng mir nicht am Rockzipfel. Raus.“
Mutter kam aus Deutschland und hatte die neue Sprache nicht richtig gelernt. Sie verwendete oft deutsche Wörter.
Raus bedeutete, daß ich verschwinden sollte, daß sie mich nicht sehen wollte...
Irgendwie bekam ich dann doch heraus, daß man an diesem sehr sonnigen Morgen in der Nähe von Bluewater einen Menschen getötet hatte, daß man jemandem einen Strick um den Hals gebunden hatte und ihn an einem Baum hochgezogen hatte, so daß er erdrosselt wurde.
Wenn es niemand sah, band ich mir das Brunnenseil um den Hals und versuchte, mir vorzustellen, wie es sich anfühlte, erhängt zu werden.
Es ging nicht.
Ich erinnere mich auch an etwas, was Vater sagte, als er und Mutter ausnahmsweise miteinander sprachen. Es muß ein paar Tage später gewesen sein.
„Sie waren keine Menschen, als sie es taten“, sagte er. „Sie waren ein Mob.“
Mob.
Das war ein neues Wort, über das ich viel nachdachte.
Vater war dabei, als sie den Indianer hängten, aber er erzählte nicht, was geschehen war. Das erfuhr ich erst viele Jahre später von anderen. Vater erzählte selten oder fast nie etwas.
Es hatte etwas mit gestohlenen Pferden zu tun.
In diesem Sommer waren drei oder vier Pferde von den Höfen in der Gegend verschwunden, und Pferde waren der wertvollste Besitz. Man lieh sich Geld gegen hohe Zinsen, um die Ochsen gegen ein paar Pferde eintauschen zu können.
Die Pferde waren ein Zeichen dafür, daß man auf dem besten Weg war, es zu schaffen, daß man sich durch die ersten Schwierigkeiten hindurchgearbeitet hatte. Wer ein Pferd besaß, mit dem mußte man rechnen.
Eines Morgens war der Schotte McBride früh auf, und da sah er einen Indianer im Pferdegehege. Ich erinnere mich an McBride als einen grobschlächtigen, rothaarigen Mann mit harten Augen und tiefen Falten zwischen Mund und Wangen. Der Indianer rannte davon, trat aber in ein Kaninchenloch und fiel hin. McBride übermannte ihn und rief Leute zusammen, indem er drei Schüsse in die Luft abgab.
Das war die übliche Art, um Hilfe zu rufen.
Als genug Leute beisammen waren, warf man den gefesselten Indianer auf einen offenen Wagen, um ihn zum Sheriff nach Valentine zu bringen. Die Eisenbahn war damals noch nicht weiter gekommen.
Aber nun war es ein ungewöhnlich warmer Morgen, und es war weit bis nach Valentine. Das Korn stand reif auf dem Feld, man war mitten in der Erntearbeit, und für viele war es die erste Ernte in dem neuen Land. Man konnte nie wissen, wie das Wetter am nächsten Tag war. Die Herbstregen kamen sicher bald.
Man sprach darüber, während der Indianer schwieg und der Karren auf dem primitiven Weg vorwärtsknirschte. Man fluchte über die Wärme und darüber, daß ein guter Arbeitstag verloren gehen würde. Konnte McBride diesen Transport denn nicht alleine machen?
Das konnte McBride nicht. Es gab bestimmt noch mehr Rothäute in der Nähe, und er wollte nicht riskieren, von einer Horde mörderischer Wilder überfallen zu werden...
Man verfluchte alle Indianer, dieses Diebes- und Banditenpack, das oben im Reservat gut lebte, das Essen und Kleider bekam, ohne auch nur einen Finger zu rühren, während ehrliche, christliche Leute schufteten, daß ihnen das Blut unter den Nägeln hervortrat. Man schaute sich die schwieligen Hände an, die Sonne stieg immer höher, und ein Wort gab das nächste.
Die gestohlenen Pferde würden nie mehr zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurückkommen; die waren wohl oben im Reservat verkauft worden, um Geld für den sündigen Whisky zu bekommen. Sie soffen ja wie die Schweine, die Rothäute. Und wenn sie nicht soffen, dann stahlen sie ehrlichen Leuten die Pferde...
Warum es nicht auf der Stelle erledigen? Er würde ja doch gehängt werden.
Es kann sein, daß es wie ein Scherz anfing, so wie Männer sich gegenseitig zeigen, wie stark sie sind, und sicher haben viele protestiert. Mein Vater muß einer von denen gewesen sein. Er hatte zusammen mit Indianern gejagt und zollte ihnen einen gewissen Respekt. Außerdem konnte er Leute mit vorgefaßten Meinungen nicht ausstehen, obwohl er selbst dazugehörte.
Aber dieses Mal haben nicht viele auf Onkel Charles gehört.
Als man an die Stelle kam, die noch sehr lange Zeit ‚Der Indianerbaum’ genannt wurde, warf jemand ein Seil über den untersten Ast.
Hinterher wollte niemand sagen, wer es war, aber es ging das Gerücht, daß es ein älterer Mann war, der schon 25 Jahre zuvor im Bürgerkrieg gekämpft hatte und ‚Der Korporal’ genannt wurde.
„Die Stelle ist so gut wie jede andere.“
„Ja, los, rauf mit ihm.“
„Dann haben wir es hinter uns.“
„Laßt den Schuft tanzen.“
„Die Familie soll nicht hungern müssen.“
„Es reicht schon mit der gewöhnlichen Plackerei...“
Ungefähr so wird es gewesen sein.
Die gewöhnliche Plackerei, das Gefühl, den Kampf gegen die magere Erde und das Schlechte nicht gewinnen zu können, jahrelang die enttäuschten Augen von Frauen, die von Heiratsannoncen im Omaha Daily Bee und anderen Zeitungen hergelockt worden waren, die ständige Angst vor dem Versagen und Untergang... dies und vieles andere, was sich nicht in Worten ausdrücken läßt, muß hinter dem blinden Haß der folgenden Minuten gelegen haben, dem Haß gegen jemanden, der einer anderen Rasse angehörte, dem man sich überlegen fühlte.
Eine Ansammlung ganz normaler Männer, von denen viele bestimmt jeden Tag in der Bibel lasen, hatte sich in einen Mob verwandelt.
Der Indianer war jung und mager und sprach schlecht englisch. Zuerst hatte er geschwiegen, aber jetzt versuchte er zu erklären, immer wieder. Er wußte nichts von gestohlenen Pferden, er war nur neugierig gewesen...
Als ihm die Augen der Männer sagten, daß er verurteilt war, bespuckte er die, die am nächsten standen, und dann begann er ‚schreckliche und heidnische’ Lieder in seiner eigenen Sprache zu singen.
Man knüpfte eine Schlinge und zog ihn in den Baum hoch – er wand sich und zappelte wie eine Klapperschlange, die man gerade erschlagen hat – und dann verschwand man schnell.
Alle schwiegen. Man vermied es, einander anzuschauen. Einer setzte sich mit dem Kopf zwischen den Knien an den Wegrand...
Der Körper des toten Indianers verschwand schon in der folgenden Nacht.
Die gestohlenen Pferde tauchten unten in Alliance, einen Tagesritt südwärts, wieder auf. Ein paar weiße Cowboys von einer der großen Ranchen hatten versucht, sie zu verkaufen. Sie verschwanden sehr schnell, als sie merkten, daß der Käufer mißtrauisch wurde.
McBride verschwand mit seiner Familie nach dem ersten Herbststurm, und nur ein paar Tage danach brannte sein Haus.
Auf dem Hof fand man einen roten Pfeil.
Für manche Familien begann die Angst vor den Indianern schon jetzt – obwohl es noch viele Jahre dauern sollte, bis die Indianer oben im Reservat um ihre Feuer tanzten.
Und bald ging auch das Gerücht, daß der tote Indianer bei der Baumwollpappel, dem Indianerbaum, spukte, daß er keine Ruhe in seinem unbekannten Grab finden würde, bis er gerächt worden wäre. Besonders gefährlich war es, wenn Vollmond war und die Eule dreimal rief.