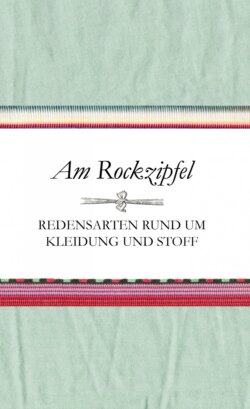Читать книгу Am Rockzipfel - Susanne Schnatmeyer - Страница 4
Оглавление»Da freuen sich sogar Männer, wenn die Frauen die Hosen anhaben.«
Strumpfhosenwerbung, 1959
Jacke wie Hose
Die Hosen anhaben
»Männer mögen die Hosen anhaben, aber die Frauen entscheiden welche« – der Spruch spielt mit einem uralten Thema, dem sogenannten ›Kampf um die Hose‹. Traditionell war die Hose das Kleidungsstück des Mannes. Ihm stand nach alter Vorstellung auch die Führungsrolle in einer Ehe zu. Hatte stattdessen seine Frau das Sagen und damit ›die Hosen an‹, so war das regelwidrig. Schon im Mittelalter drehten sich viele Geschichten und Anspielungen um die Hose als Metapher der Macht. Das Bild hielt sich über Jahrhunderte und gab immer wieder zu Herrenwitzen Anlass: »Männer, deren Frauen die Hosen anhaben, haben in der Regel Freundinnen mit Pelzmänteln«. Wohl weil Frauen inzwischen zu allen Gelegenheiten Hosen tragen, verschiebt sich die Bedeutung der Redewendung. Inzwischen hat die Hosen an, wer allgemein den Ton angibt. »Halbfinale zwischen den Klubs, die die Hosen anhaben« oder »Wenn Katzen die Hosen anhaben« schreiben Zeitungen dann.
Tote Hose
Der Ausdruck spielt eigentlich darauf an, dass sich in der Hose nichts mehr regt. Aus der Impotenz im männlichen Kleidungsstück wurde in den 1980er Jahren dann ein Slogan für Langeweile und Ereignislosigkeit. Die Punkband »Die Toten Hosen« wurde trotz des Namens extrem erfolgreich. Bei ihrem ersten Konzert Ostern 1982 glaubte der Veranstalter aber noch, sich verhört zu haben und kündigte »Die toten Hasen« an.
Herz in der Hose
Das Herz in der Hose ist lateinischen Ursprungs. Dort gilt: Animus in pedes decidit, der Mut fällt in die Füße. Der Mut ist beherzt, er sitzt in der Brust und rutscht vor Schreck nach unten. Dem Ängstlichen wird ganz flau in der Magengrube, der ganze Körper zittert, sogar die Hosenbeine schlottern.
Die Hosen voll
Üble Begleiterscheinung der Angst ist ein unruhiger Darm. Das Problem wird seit Jahrhunderten in vielen Varianten umschrieben, wie beim Hosenscheißer, der aus Furcht die Hosen gestrichen voll hat. Wenn ein Vorhaben misslingt, geht es daneben – es geht in die Hose. Der Fußballer Paul Breitner berichtete: »Da kam dann das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief’s ganz flüssig.«
Ausbüxen
In vielen Dialekten heißt die Hose auch Büx oder Buxe. Die Buxe ist eine Zusammenziehung von buckhose, einer Hose aus Bocksleder. Wen man bei der Büx kriegt, den hält man fest, damit er nicht ausbüxt, also aus der Buxe ausreißt und verschwindet. Ausbüxen kommt im allgemeinen Sprachgebrauch erst in den letzten Jahrzehnten häufiger vor.
Die Spendierhosen anhaben
Bereits im 17. Jahrhundert sind Spendir-Hosen oder Spender-Buxen scherzhaft für Großzügigkeit des Trägers verantwortlich. Um Reichtum in der Hose geht es auch bei einem Angeber, der einen auf dicke Hose macht. Hier ist die Hose entweder mit einem prallen Geldbeutel gefüllt, oder mit einem prächtigen Geschlechtsteil.
Hosenboden und Hosenlatz
Wer sich auf den Hosenboden setzt, lernt auf einem Stuhl am Arbeitstisch fleißig für eine Sache. Faulen Schülern drohten Lehrer früher an, ihnen die Hosen strammzuziehen. Das war eine verharmlosende Umschreibung für Prügel, denn auf dem faltenlosen Hosenboden sollten die Stockschläge besonders schmerzen. Schläge gab es auch beim an den Latz knallen. Der Latz war die Klappe, mit der Hosen früher vorn oder hinten verschlossen wurden. Dieser Hosenlatz wurde vermutlich mit einer Tür verglichen, weshalb auch heute noch der Hosenschlitz als Hosentür oder Hosenstall bekannt ist – als ob dahinter ein Tier wohnt.
Hose auf halb acht
Wenn die Hose auf halb acht hängt, dann sitzt sie nicht richtig. In der Seefahrersprache bezeichnet achtern das Heck, den hinteren Teil des Schiffes. Auf halb acht könnte ›halb-achtern‹ bedeuten, die Hose hängt also am Hinterteil. Dazu passt, dass tiefsitzende Jeans auf Englisch ebenfalls maritim pants at half-mast heißen, Hosen auf Halbmast.
Die Forderung »Alle müssen die Hosen herunterlassen« verlangt von den Beteiligten, bisher verdeckte Tatsachen offenzulegen, sie sollen sich ganz nackt machen. Mit abgeschnittenen oder abgesägten Hosen steht da, wer sehr geschröpft wurde und nun mittellos ist.
Hosenmatz oder auch Hemdenmatz wird wohlmeinend ein Matz, also ein kleiner Matthias, als Kind genannt. Wer sich wie ein Matz benimmt, macht Mätzchen.
Jacke wie Hose
»Das sind zwei Hosen eines Tuchs« hieß es in einer älteren Redewendung, wenn zwei Dinge austauschbar waren. Die Variante ›Jacke wie Hose‹ ist ab 1676 belegt. Ob damit Anzüge gemeint waren, bei denen der Schneider für Jacke und Hose dasselbe Tuch verarbeitet hatte? Das ist fraglich, denn solche einheitlichen Herrenanzüge verbreiteten sich erst im 19. Jahrhundert, lange nach Aufkommen der Redensart. Vielleicht ging es auch einfach nur um zwei aus ähnlichem Material gefertigte Dinge. Gebräuchlich waren auch Varianten wie ›Hucke wie Hose‹ oder ›Jacke wie Wams‹.
Die Jacke vollkriegen
Die Jacke wird verprügelt, und damit gleichzeitig der Mensch. Kleidungsstücke stehen oft als Teil für das Ganze, als pars pro toto. Ähnlich ist es bei ›die Hucke vollkriegen‹, wo mit der Hucke, der auf dem Rücken huckepack getragene Last, eigentlich der Rücken gemeint ist. Wird jemand schwerwiegend belogen, so wird ihm die Hucke oder die Jacke vollgelogen.
Weiße Weste
Weiß ist traditionell die Farbe der Unbescholtenheit. Die Vorstellung von weißer Brustbekleidung als Kennzeichen eines reinen Gewissens gab es schon 1700. Das weiße Männerhemd unter der Oberbekleidung war ein wichtiges Statussymbol, es gehörte in allen Schichten zum Prestige dazu, die sichtbar getragene Wäsche so rein wie möglich zu präsentieren. Bis heute steht die reine, saubere, unbefleckte Weste für Unschuld.
Etwas unter die Weste jubeln
Geschickte Betrüger können anderen Menschen unbemerkt etwas zustecken, wenn sie das Opfer mit Jubel und Trubel ablenken – sie sind Profis im Unterjubeln. »Haben sie nicht aufgepasst, was ihnen unter die Weste gejubelt wurde?« heißt es dann. Der Ausdruck ist erst seit etwa 50 Jahren gebräuchlich und ähnelt dem ›in die Schuhe schieben‹.
Westentasche und Hosentasche
Sind in Kleidungsstücke Taschen eingenäht, lassen sich darin gut Kleinigkeiten wie Uhren, Münzen und Zigaretten mitnehmen. Man findet sich blind zurecht, weil man oft hineingreift und den Inhalt fühlend erspürt. Irgendwann kennt man dann auch die Straßen in seinem Viertel wie seine Westen- oder Hosentasche. Weil wohlhabende Leute früher in den Taschen auch immer reichlich Bargeld greifbar hatten, konnten sie ohne Schwierigkeiten etwas aus der Westentasche bezahlen. Die Dinge, die man in den Taschen der Kleidung mitnimmt, sollten maximal Westentaschenformat haben.
Rock des Vaterlands
Bis vor hundert Jahren war ›Rock‹ auch der Name eines männlichen Kleidungsstücks in Form einer langen Überjacke. Wer den grauen Rock anzog, ging in Soldatenuniform zum Militär. Noch in den 1960er Jahren mussten Wehrpflichtige für die Bundeswehr den Rock des Vaterlands anziehen, wie es damals hieß.
Am Rockzipfel hängen
Hier denkt man sofort an ein Kind, das den Rock seiner Mutter nicht loslassen möchte. Auf Französisch heißt es sogar ganz genau: Ne pas quitter les jupes de sa mère – die Röcke seiner Mutter nicht verlassen. Mit Rockzipfel konnte früher aber auch der Rockschoß gemeint sein, der untere, meist geschlitzte Teil im Rücken einer Männerjacke. Am Rockzipfel oder an den Rockschößen hängen stand dann für ein Abhängigkeitsverhältnis von einem Mann. Nachdem inzwischen auch Frauen Hosenanzüge tragen, sind neue und eigentlich verdrehte Wendungen wie ›an den Rockschößen der Kanzlerin hängen‹ ungewollt stimmig.
Mantel der Nächstenliebe
Bis in das 18. Jahrhundert waren Mäntel ärmellose Umhänge. So ein Umhang konnte etwas schützend bedecken, aber auch heuchlerisch vertuschen. Das Motiv des schützend umhüllenden Mantels ist sehr alt. Nach dem Rechtsbrauch des Mantelschutzes konnten Verfolgte bei hochgestellten Persönlichkeiten um Asyl bitten. Das Umlegen eines Mantels galt als Zeichen der Begnadigung. Kinder konnten als sogenannte ›Mantelkinder‹ ehelich werden, wenn sie unter dem Umhang der Eltern mit vor den Traualtar traten. Wer aus Mitgefühl ohne viel Aufhebens über Fehltritte anderer hinweggeht, der deckt den Mantel der Barmherzigkeit darüber. Heute wird die Redewendung etwas mit dem Mantel der christlichen Nächstenliebe zudecken oft auch ironisch gebraucht.
Mit dem Deckmantel bemänteln
Vom Mantel der Nächstenliebe, den man über eine Verfehlung deckt, ist es nicht weit zum täuschenden Deckmantel. Ende des 13. Jahrhunderts wird das Wort ›Deckmantel‹ erstmals bildlich im Sinne einer Heuchelei gebraucht. Was mit dem Deckmantel zugehängt wird, wird bemäntelt, wird verborgen, beschönigt und verharmlost. Unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit geschehen wahrscheinlich unerlaubte Dinge, und wer sich ein Mäntelchen umhängt versucht, einen bestimmten Eindruck zu erwecken.
Mantel nach dem Wind hängen
Die Redensart, die einen charakterlosen Menschen beschreibt, beruht auf einem Sprichwort. Schon 1200 heißt es: »Man soll den Mantel kehren als das Wetter geht.« Wer damals im Sturm stand, musste seinen Umhang am besten so drehen und verschließen, dass der Wind die Öffnung nicht auffliegen ließ. Das Sprichwort hatte noch keinen negativen Beigeschmack, es war einfach klug, sich in die Gegebenheiten zu fügen. Später bekommt die Wendung einen abfälligen Beigeschmack. Ähnlich wie beim Fähnchen im Wind dreht auch derjenige den Mantel nach dem Wind, der seine Einstellungen den jeweiligen Machtverhältnissen anpasst.
Mops im Paletot
»Lebe lustig, lebe froh, wie der Mops im Paletot« war ein beliebter Albumvers im 19. Jahrhundert. Der Mops hat es sich hier in einem Mantel gemütlich gemacht, denn der Paletot war ein meist zweireihiger Herrenmantel aus Wolle, auch Überzieher genannt. Bekannter ist noch die Variante: »Lebe lustig, lebe froh, wie der Mops im Haferstroh.«
»Man soll dem anderen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, in den er hineinschlüpfen kann.«
Max Frisch