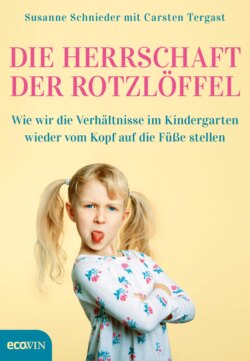Читать книгу Die Herrschaft der Rotzlöffel - Susanne Schnieder - Страница 6
Ein Wort vorweg
ОглавлениеEs ist Herbst 2019. Die Tinte unter den Verträgen ist trocken, wir beginnen mit der Arbeit an diesem Buch. Die Marschrichtung ist klar: Wir werden über eine Krise schreiben, die Krise im System der Kindergärten und Kindertagesstätten, die sich hartnäckig hält, die Familien genauso belastet wie Erzieher in den Einrichtungen. Während wir schreiben, laufen die Kitas im Land im Normalbetrieb, kämpfen tagtäglich viel zu wenige Erzieher mit viel zu großen Gruppen von Kindern und mit Rahmenbedingungen, die oft alles andere als guter Arbeit zuträglich sind. Wir schreiben auch deshalb darüber, weil diese Krise längst business as usual geworden ist, der Normalbetrieb ist weit entfernt von einem Idealbetrieb. Wenn wir also im Herbst 2019 an Krise denken, dann gilt unser Gedanke eben diesem Normalbetrieb in den Kindertagesstätten.
Zeitsprung.
Es ist Frühsommer 2020. Das Manuskript ist fertig und draußen in der Welt scheint nichts mehr, wie es noch ein halbes Jahr zuvor gewesen ist. Wenn wir jetzt an Krise denken, über Krise sprechen, dann über eine, die alle anderen Krisen in den Hintergrund gerückt hat. Diese eine wird Corona-Krise genannt, ein griffiger Ausdruck, irgendwann von irgendeinem Journalisten zum ersten Mal benutzt und schließlich zur Beschreibung dessen geworden, was sich seit dem Beginn des Jahres wie ein grauer Schleier über die ganze Welt legt.
Zu dieser Welt gehören auch die Kitas und Kindergärten, zu ihr gehören die Kinder, die Eltern, die Erzieher, die Träger der Einrichtungen und die Politiker, die Entscheidungen über die Arbeit dieser Einrichtungen zu treffen haben. Während solche Entscheidungen sich jedoch bisher damit beschäftigten, wie viel Geld ins System fließen soll, wie die Arbeitsbedingungen vor Ort aussehen oder wie man dem Fachkräftemangel entgegenwirken kann, geht es im April, Mai und Juni 2020 vor allem darum, wann und in welcher Form Kitas und Kindergärten wieder öffnen dürfen.
Dabei legt diese Diskussion ganz verschiedene Probleme offen, die vorher häufig nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert wurden. Da ist zum einen das Anspruchsdenken mancher Eltern, das von Politikern, sei es aus Unkenntnis, sei es aus Wahlkampftaktik, noch gefördert wird. So zitiert der Spiegel den sächsischen Kultusminister Christian Piwarz während der Diskussion um die ersten Lockerungen mit den Worten:
»Gerade für Eltern kleinerer Kinder sei die Zeit der Schließung von Kitas enorm belastend, erklärte der Minister. ›Für nicht wenige ist die Schmerzgrenze erreicht.‹ Aber auch für die Kinder sei es ›von elementarer Bedeutung, spielen, toben und lernen zu können.‹ ›Der Erwerb der grundlegenden Kulturtechniken ist weder im Selbststudium möglich noch kann diese Aufgabe den Eltern übertragen werden‹, begründete Piwarz die Öffnung der Kitas und Schulen.«
Das mag, im ersten Moment nachvollziehbar klingen, doch schon beim zweiten Lesen beginnt das Stirnrunzeln über die Zuschreibung, die der Minister hier vornimmt. Nicht nur, dass er das Grundgesetz nicht zu kennen scheint, nach dem »Pflege und Erziehung der Kinder« nicht nur »das natürliche Recht der Eltern«, sondern auch »die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht« sind. Darüber hinaus bildet diese Äußerung eines hohen deutschen Bildungspolitikers sehr schön die aus dem Ruder gelaufene Anspruchshaltung gegenüber Kindertageseinrichtungen ab. Die ursprüngliche Funktion einer sinnvollen Ergänzung zur elterlichen Erziehung ist längst von einem Anspruch auf Rundumversorgung abgelöst worden. Die Diskussionen um ständige Erweiterungen von Öffnungszeiten, um Frühstück, Mittagessen und Abendbrot in der Kita oder um ständig wachsende Kompetenzen von Erziehern hat in der Corona-Krise dazu geführt, dass ein zeitweiliger Ausfall all dieser scheinbaren Selbstverständlichkeiten katastrophale Zustände in vielen Familien auslöst.
Damit wir uns richtig verstehen: Der plötzliche ungeplante Wegfall von Kinderbetreuungsmöglichkeiten hat natürlich zu organisatorischen Schwierigkeiten und sicher auch zu einer nervlichen Mehrbelastung bei vielen Eltern gesorgt. Das soll überhaupt nicht kleingeredet werden. Doch offenbart die Krise auch, dass die Annahme, Erzieher seien die sprichwörtliche Eier legende Wollmilchsau offenbar falsch war. Sie offenbart, dass in einer nicht eben kleinen Anzahl von Familien zwar das Kinderkriegen selbstverständlich war, nicht aber der entsprechende Aufwand für Pflege und Erziehung. Man hat sich daran gewöhnt, die Kinder vor allem in den entspannten und guten Momenten um sich zu haben. Das Bewusstsein dafür, dass es mit Kindern immer auch andere, schwierige, traurige und bisweilen nervenzerfetzende Momente gibt, ist dem Outsourcing von Erziehungsleistungen zum Opfer gefallen und kehrt nun zurück.
Das mag für einige Eltern hart sein, für unser Anliegen, die Problemstellungen in der Welt der Kitas und Kindergärten ins Licht zu rücken, ist diese Krise vielleicht sogar zuträglich. Denn wie kann etwas offenbar so wichtig und für das Seelenwohl vieler Familien so entscheidend sein, das doch bisher meist unter dem Radar von Politik und Gesellschaft lief? Viel ist vom Begriff der Systemrelevanz gesprochen worden in dieser Krise, und natürlich waren erst mal wieder Banken, Automobilkonzerne oder Fluggesellschaften gemeint. Erst im Laufe der Diskussion ging dann manchem ein Licht auf. Menschen, die in der Pflege und in anderen medizinischen Bereichen arbeiten, schienen wohl plötzlich doch auch systemrelevant zu sein, Verkäufer im Supermarkt ohne Möglichkeit, ins Homeoffice zu wechseln und sich der Ansteckungsgefahr zu entziehen, waren es irgendwie ebenfalls. Und, ja, auch Erzieher und Lehrer müssen wohl doch irgendwie systemrelevant sein, wenn ihre Dienstleistung nach nur wenigen Wochen bereits so schmerzlich vermisst wird.
Wie wohl alle Menschen hoffen auch wir, dass es ein »nach Corona« geben wird, das mit unserem vorherigen Leben noch möglichst viel zu tun hat. Während der Drucklegung dieses Buches ist vieles noch nicht absehbar, auch der Betrieb in den kurz zuvor wieder geöffneten Kitas und Kindergärten ist zu diesem Zeitpunkt ein mit vielen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten gepflasterter Weg. Und doch lässt sich sagen, dass wir aus dieser Krise etwas für die Zukunft mitnehmen sollten. Nämlich die Erkenntnis, dass Kindertageseinrichtungen besonders dann gute Arbeit leisten können, wenn sie einerseits nicht mit unrealistischen Erwartungen überfrachtet werden und andererseits die tägliche Leistung, sowohl von Elternseite aus als auch von der politischen Ebene, sehr viel stärker gewürdigt und unterstützt wird. Viele Eltern verhalten sich hier vorbildlich, und auch manchem Politiker ist sein ehrliches Bemühen anzumerken. Und doch ist hier viel Luft nach oben, gibt es viele Wünsche und Bedürfnisse, die kein Luxus, sondern Notwendigkeit sind.
Wenn also irgendwann »nach Corona« wieder so etwas wie ein Normalbetrieb in den Kindertageseinrichtungen möglich ist, wäre es schön, wenn die Erfahrungen der Krise in die Neugestaltung dieses Normalbetriebs eingehen würden und ihn zum Vorteil aller Beteiligten, Kinder, Eltern und Erzieher verändern würden.